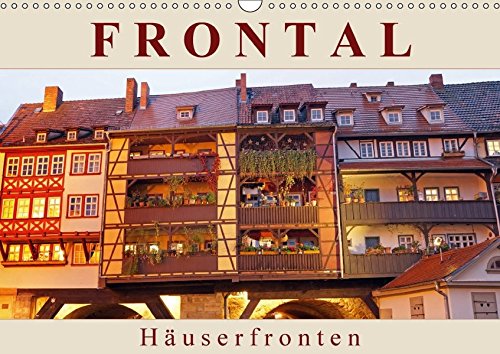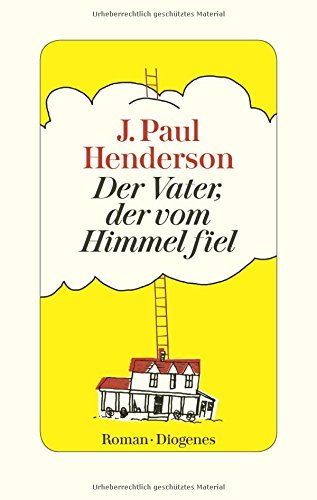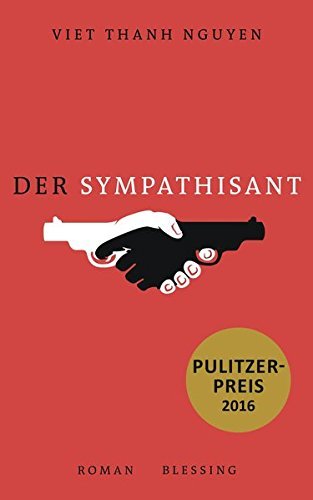
Ich habe nichts getan
Der Autor Viet Thanh Nguyen wurde 1971 in Südvietnam geboren, floh kurz vor dem Fall Saigons mit Eltern und Bruder in die USA, promovierte später in Berkeley in Anglistik und ist somit weitgehend als Amerikaner geprägt. Aber seiner vietnamesischen Wurzeln war er sich immer bewusst. Sie spiegeln sich in seinem 2016 erschienenen, jetzt von Wolfgang Müller übersetzten Debütroman »The Sympathizer«  , der nicht nur erhebliches Aufsehen erregte, sondern auch gleich mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde.
, der nicht nur erhebliches Aufsehen erregte, sondern auch gleich mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde.
Nun gibt es bereits genug beachtliche und ernst zu nehmende Literatur und Filme über das dunkle Kapitel des Vietnam-Krieges. Doch alle kreisen im Wesentlichen um die Traumata, die Amerika erlitten hat. Viele Werke setzen den erbarmungslosen amerikanischen Vernichtungsaktionen Bilder vom Heroismus des patriotischen US-Soldaten entgegen, der die Freiheit eines fernen Landes unter Einsatz seines Lebens verteidigt. Sein Feind ist der Vietcong, anfänglich kleine revolutionäre Partisanengruppen des kommunistischen Nordens, schlecht ausgerüstet, aber geschickt im Guerillakampf im Dschungel, wo sie nahezu unsichtbar und nicht weniger erbarmungslos agieren. Weder die Entlaubung ganzer Landstriche noch die Vernichtung ziviler Dörfer kann ihren Vormarsch nach Süden stoppen.
Als die kommunistischen Truppen Ende April 1975 die südvietnamesische Hauptstadt Saigon einnehmen, setzt ein dramatischer Exodus ein. Soldaten und Zivilisten, die Beziehungen, Schmiergelder oder Kraft genug haben, drängen in die letzten Armeehubschrauber, die unter heftigem Beschuss Saigon verlassen. Erschütternde Fernsehbilder von der Evakuierung tragen Amerikas Schmach um die Welt.
Viet Thanh Nguyens Roman ist erstaunlicherweise der erste, der die Vorgänge aus der Sicht eines Vietnamesen schildert. Aber er zeichnet nicht einfach ein Gegenbild zu den amerikanischen Epen, sondern ein komplexes Bild der Wahrheit, die umso schwerer zu fassen ist, als sie aus der schillernden Perspektive einer vielfach gebrochenen Persönlichkeit berichtet wird. »Ich bin ein Spion, ein Schläfer, ein Maulwurf, ein Mann mit zwei Gesichtern, [...] ein »Mann mit zwei Seelen«, so bekennt sich der Protagonist ohne Namen gleich in den Eingangssätzen zu seiner dubiosen Rolle.
Mit der Selbstbezichtigung beginnt der Mann seine Niederschrift, ein gefordertes Geständnis, das er als Häftling in einem kommunistischen Umerziehungslager zu verfassen hat. Der Südvietnamese kam nach Kriegsende in Amerika mit revanchistischen Gruppen in Kontakt und wurde beauftragt, eine Handvoll Männer in das Vereinte Vietnam einzuschmuggeln, wo der Widerstand gegen das neue Regime angestachelt werden soll. Dass es sich dabei um ein »Himmelfahrtskommando« handeln würde, war allen klar; dass es tatsächlich eines wurde, dafür sorgte der Anführer selber, indem er das Vorhaben an den Vietcong verriet.
Trotz dieser Tat muss er im Lager seine wahre Gesinnung beweisen. Um der Erwartungshaltung des Kommandanten entgegenzukommen, biegt er die Wahrheit kräftig zurecht. Denn natürlich passt es besser zu einem aufrechten Klassenkämpfer, dass er in Saigon sein Dasein in einer streng bewachten Einzelzelle habe fristen müssen, als zu enthüllen, dass er als ranghoher Mitarbeiter der Geheimpolizei in einer noblen Villa samt eigener Putzfrau residierte.
Doch ein feiger Duckmäuser ist der Erzähler nicht. Durchaus »aufmüpfig« beharrt er auf gewissen Haltungen – um den Preis, länger in Haft bleiben zu müssen. So weigert er sich, bestimmte Formulierungen aufzuschreiben, die von ihm erwartet werden, etwa das pauschale Geständnis, er sei »vom Westen infiziert«, oder Parolen wie »Lang lebe Partei und Staat. Folgt dem glorreichen Beispiel Ho Chi Minhs. Lasst uns eine wunderbare, perfekte Gesellschaft bauen!« Derlei »Klischees« zu Papier zu bringen erachtet er als ein »ebenso großes Verbrechen wie einen Menschen zu töten«. Zu gestehen, dass er einen Doppelmord begangen hat, bereitet ihm dagegen keine Sorgen, denn die Opfer waren Klassenfeinde. In Einzelhaft und unter Folter bedrängt, endlich ein richtiges (antirevolutionäres) Verbrechen zu gestehen, insistiert er darauf, »nichts« getan zu haben. Damit verdrängt er aber seine Mitverantwortung an einer brutalen Gewaltorgie.
Dieses Ereignis bildet eine der markanten Schlüsselszenen für die Intention des Autors. Hehre Ideale wie Unabhängigkeit und Freiheit werden von allen Parteien der politischen Auseinandersetzung für eigene Vorteile missbraucht. In Vietnam galt das für »Imperialisten« und »Revolutionäre«: Kaum hatten sie das Land eingenommen, setzten sie ein diktatorisches Regime ein, das den propagierten Idealen Hohn sprach. Millionen Menschen starben seit jeher in sinnlosen Kriegen für »Dinge [, die] weniger als nichts wert sind«, und nichts spricht dafür, dass das vergebliche Sterben ein Ende fände.
Wer und wie dieser doppelgesichtige Protagonist in seinem innersten Kern ist, ist nicht fassbar. Schon von seiner Geburt her empfindet sich der Sohn eines französischen Priesters und einer vietnamesischen Mutter als »Bastard«, in dessen Brust zwei Herzen schlagen, der zeit seines Lebens kulturell zwischen Ost und West hin und her gerissen bleibt. Der Hölle Saigons entkommen, findet er sich in Kalifornien, wo die vietnamesischen Flüchtlinge wenig willkommen sind. Allzu unübersehbar erinnern sie an die »schmerzhafte Niederlage« der Nation. So fristen die Exilanten ein ärmliches Dasein. Erniedrigt und desillusioniert träumen nicht wenige davon, in ihr Heimatland zurückzukehren und die alten Verhältnisse wiederherzustellen. Dass mitten in seiner Gruppe ein Spion agiert, ahnt ein General, ohne zu wissen, dass es sich dabei um seinen innigsten Vertrauten handelt. Aus dessen doppelter Verpflichtung – für die neuen kommunistischen Machthaber in Vietnam und gleichzeitig für ihre Feinde im Exil – entwickelt sich die knisternd spannende, wendungsreiche Handlung des Romans.
Der Agent selbst scheint unfähig zu wahrer Solidarität oder auch nur persönlichen Grundsatzentscheidungen. Der freie amerikanische Lebensstil sagt ihm ebenso zu, wie ihn dessen Unverbindlichkeit abschreckt. Er verrät die Hoffnungen seiner exilierten Landsleute an die Kommunisten und im selben Atemzug seine eigenen kommunistischen Ideale zugunsten der westlichen Konsumgesellschaft. Er foltert und tötet, wie man es von ihm verlangt, und wird in Gefangenschaft selbst gefoltert, bis er gebrochen ist.
Anders als manche Vietnam-Filme setzt Viet Thanh Nguyen nicht auf die Horrorwirkung asiatischer Brutalität. Drastische Gewaltbeschreibungen sind selten und im Ton kühl distanziert. Mit süffisantem Unterton seziert er dagegen den American Way of Life. Manche Passagen – etwa zur »Disney-Ideologie« – kommen wie eine zynische Politsatire daher. Dem Hollywood-Geschäft gilt ein ganzer Handlungsstrang. Ein bekannter Filmregisseur (man denkt unweigerlich an Francis Ford Coppola und Oliver Stone) plant den ultimativen Vietnam-Film »Das Dorf«, ein monströses Epos über weiße Helden, »die gute gelbe Menschen vor schlechten gelben Menschen retteten«. Da er selbst Kriegsgeschehen nur aus den Filmen seiner Kindheit kennt, engagiert er als »technischen Berater für Authentizität« ausgerechnet unseren »Maulwurf«. Bei den Dreharbeiten auf einer philippinischen Insel ist Authentizität dann aber nur so weit erwünscht, dass »der Durchschnittsamerikaner sich seines eigenen Glücks bewusst wurde«. Die vom Berater bereitgestellten Komparsen (eine Hundertschaft armseliger boat people aus einem Flüchtlingslager) brauchen nur die »Rolle der Unglücklichen« zu spielen. Das wahre Kriegsgrauen der Abschlachtungen, die schmerzerfüllten Schreie der Zivilisten in Todesangst wolle, so der Regisseur, niemand hören. »Das geht den Leuten am Arsch vorbei.« Der »Technische Berater« knickt ein und leistet mit der Beschränkung auf Äußerlichkeiten seinen Beitrag zur Propaganda: »Schaut her, wir haben auch ein paar Gelbe mitmachen lassen. Wir hassen sie nicht. Wir lieben sie.« Statt eines echten Antikriegsfilms ist dieses Spektakel »nur ein Sequel zu unserem und das Prequel zum nächsten Krieg, zu dem Amerika berufen war«.
Und in der Tat haben ja Filme wie Apocalypse Now und Die durch die Hölle gehen nichts an Amerikas Militärpolitik zu ändern vermocht. Trotz des verlorenen, inzwischen als »Abnutzungskrieg« statt als »Vernichtungskrieg« beschönigten Desasters sind die USA seither in zahlreiche Krisenregionen einmarschiert, immer unter der Doktrin, den Ländern die Freiheit zu bringen.
Auch Viet Thanh Nguyens anregender Roman wird daran wenig ändern.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Herbst 2017 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: