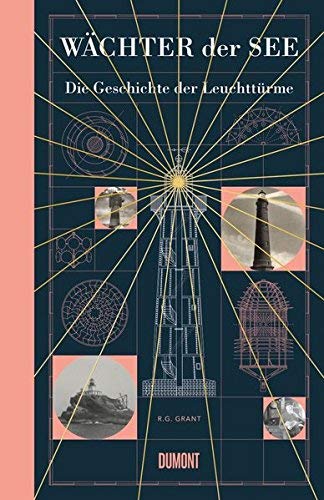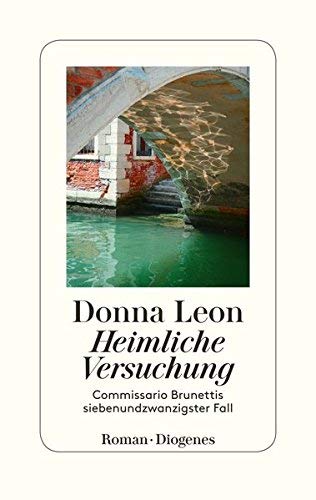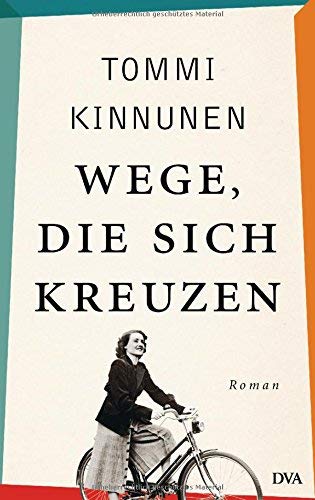
Wege, die sich kreuzen
von Tommi Kinnunen
Der Autor erzählt ein Jahrhundert im hohen Norden. Drei starke Frauen suchen ihren Weg. Nicht nur die Konventionen der Gemeinschaft und herkömmliche Geschlechterrollen belasten sie, sondern auch ein düsteres Geschehen in der Vergangenheit.
Ort ohne Lächeln
Irgendwie ist sie besonders, die skandinavische Literatur. Weltweites Interesse lösten die Krimis von Adler-Olsen, Mankell, Nesbø, Nesser aus, die, oft in landschaftlicher Kargheit und Einsamkeit, ungekannte menschliche Abgründe zelebrierten. Weniger durchschlagend erfolgreich, aber literarisch nicht minder überzeugend sind die Erzählungen von bemerkenswerten Menschen, die sich in den dunklen, lebensfeindlichen Gegenden des Nordens bewähren (oder nicht), wo Tragödien antiker Wucht ihren unaufhaltsamen Lauf nehmen (Kettu, Lundberg, Mytting, Rinnekangas, Steinsdottir). Andere Autoren wiederum halten mit einem sprühend skurrilen Humor dagegen (Jonasson, Tuomainen).
Nun ist 2014 ein neuer Stern am nördlichen Schriftstellerfirmament erschienen. Tommi Kinnunen (1973 in Finnland geboren und im Hauptberuf Lehrer) hat gleich mit seinem Debüt »Neljäntienristeys« Leser und Kritiker beeindruckt. Der Roman wurde unter anderem für den renommierten Finlandia-Preis und den Europäischen Literaturpreis nominiert, führte wochenlang die Bestsellerlisten an und wurde in viele Sprachen übersetzt.
Kinnunen stammt aus einer Familie von Fotografen. Bilder aus deren Vergangenheit inspirierten ihn zu der erschütternden, fesselnden Familiensaga, die ein Jahrhundert und drei Generationen umspannt. Im Mittelpunkt stehen drei starke, unterschiedliche Frauen. Alle »Wege, die sich kreuzen«, treffen räumlich an einem Punkt zusammen, in einem Dorf, das dem Heimatort des Autors nachempfunden ist und wo ein Haus die Veränderungen über die Jahrzehnte versinnbildlicht. Maria Tuomela, die erste und kraftvollste der drei Protagonistinnen, ließ die kleine Kate 1925 am Nordrand des Dorfes errichten, als eine Art Symbol für ihren hart erkämpften neuen Status. Danach erweiterte sie das Haus regelmäßig um neue Kammern und Zimmer. Noch vierzig Jahre nach ihrem Tod ist es das größte und ansehnlichste des Dorfes.
Aber 1996, am Ende des Romans, sind die meisten Räume überflüssig geworden. Seit ein paar Jahren wohnen nur noch drei Personen im Haus: Marias Tochter Lahja, deren Sohn Johannes und seine Frau Kaarina. Früher gab es noch Lahjas Ehemann Onni, beider blinde Tochter Helena und Lahjas uneheliche Tochter Anna. Als Lahja jetzt stirbt, bedeutet das für Kaarina eine Befreiung. Sie räumt den Dachboden auf – und entdeckt dabei einen Jahrzehnte alten Brief der Schwiegermutter, der eine schreckliche Tragödie in der Vergangenheit enthüllt und auch sie selbst betrifft. Damit nimmt die Romanhandlung ihren Lauf, und an diesem Punkt endet sie auch, nachdem ein allwissender Erzähler die Erlebnisse der vier Protagonisten – Maria, Lahja, Kaarina, Onni – jeweils aus deren Perspektive geschildert hat. Aber damit wird die Familiengeschichte weder chronologisch serviert noch lückenlos erfasst – es bleiben weiße Flecken.
Maria hatte gerade die Prüfung der Hebammenschule in Helsinki bestanden, als sie 1895 in das Dorf ihrer Bestimmung kam, um die Aufgaben der Gemeindehebamme zu übernehmen. Ihre Vorgängerin, alt und dem Alkohol verfallen, vernachlässigte ihre Pflichten. Ohnehin ließ man seine Leibesfrucht lieber von vertrauten »Wehmüttern« ans Licht der Welt ziehen, so lange alles einigermaßen gut ging. Nur im äußersten Notfall rief man die Hebamme. Der jungen, unerfahrenen Neuen aber trauten die einfachen Leute schon gleich nicht, zumal sie mit einem Kind, doch ohne Mann anrückte.
Maria nimmt die Herausforderung an. Selbstlos setzt sie sich ein, reist mit Rentiergespann oder auf Skiern über viele Kilometer an, kann die Sterblichkeit der Wöchnerinnen und Kinder senken und gewinnt so das Zutrauen der Frauen. Sie nutzt es, um die Lage der alljährlich erneut geschwängerten, blutarmen Mütter drastisch zu kommentieren. Zu viele Wöchnerinnen hat sie unter erbärmlichen Umständen sterben sehen. Während Trauerweiber die ausgelaugte Verstorbene waschen, nicken sie dem »hereinstiefelnden Hausherren« Zuversicht zu, dass ja bald eine neue Frau für ihn da sei, die sich um ihn, den Haushalt und die Kinder kümmern werde. Maria missbilligt das »Tun und Treiben der Männer«, dem die Kirche ihren Segen erteilt, indem sie auf Erden untertänigen Frauen »himmlische Wonnen« im Jenseits in Aussicht stellt, und sie billigt jeder Frau zu, sich dem Mann zu verweigern. Dass der Herr Pfarrer sie mehrfach einbestellt, um sie »wegen ihres ungehörigen Verhaltens« zu tadeln, kann sie nicht einschüchtern.
Binnen eines Jahrzehnts ist Marias respektabler Ruf gefestigt. Die resolute Frau erregt Staunen und Bewunderung, als sie sich ein Fahrrad kauft, selber erlernt, es zu fahren, und damit schnell vor Ort ist, wann immer sie gerufen wird. Sie ist stolz und glücklich, sich nie an einen Mann gebunden zu haben. Niemand kommandiert sie herum, und die Vorstellung, »irgendein Dickwanst würde sie besteigen, wann immer es ihm beliebte«, lässt sie schaudern.
Ganz anders denkt darüber ihre Tochter Lahja, inzwischen selbst Mutter einer unehelichen Tochter, Anna. Lahja sehnt sich nach der Verbindung mit einem fürsorglichen, leidenschaftlichen Partner und heiratet Onni Löytövaara. Der ist fleißig, kümmert sich um seine Frau, um Anna und seine beiden leiblichen Nachkommen, entdeckt dann aber mit Entsetzen seine Andersartigkeit – eine Art »Krankheit«, »Anfechtung«, etwas Verbotenes. So sehr ihn dies aufwühlt, offen sprechen kann er darüber nicht einmal mit seiner Frau. Die Konsequenzen sind entsetzlich.
Im Krieg ist Maria durch ihre Fahrten und Kontakte stets auf dem Laufenden über dessen Verlauf, aber ihr Haus wird zerstört, und den friedfertigen Onni verändern sechs Jahre an der Front. Als Held kehrt er zurück, um als Zimmermann beim Wiederaufbau des Dorfes zu helfen. Aber mit sich selbst kommt er nicht ins Reine. Er hat große Schuld auf sich geladen, die er bald nicht mehr ertragen kann.
Während anderswo die Umwälzungen der Sechzigerjahre der Freiheit den Weg bahnen, trifft die restriktive, voreingenommene Kritik der strenggläubigen Dorfgemeinschaft Marias selbstbewusste Tochter Lahja, die unter Schwierigkeiten ihren eigenen Weg finden muss. Als Fotografin erringt sie wie ihre Mutter ein Stück Selbstständigkeit, findet aber weder als Frau bei Onni noch bei ihren Kindern als Mutter Erfüllung. Sie verbittert mehr und mehr, wird auch für ihre sorgende Schwiegertochter Kaarina unerreichbar und versteinert förmlich, innerlich wie äußerlich.
Später kommt es zu einer ausführlichen Szene der Versöhnung, die Kinnunens schriftstellerisches Talent und Angela Plögers Übersetzung überzeugend gestalten, ohne an den Klippen von Kitsch und Sentimentalität zu scheitern. Kaarina, als Schwiegertochter nie für gut genug befunden, wäscht mit einem Waschlappen die vor ihr kauernde Schwiegermutter. Lahja, einst eine dominante Gestalt, die die Jüngere vier Jahrzehnte lang drangsaliert hat, ist nur noch ein geschlechtsloser, vertrockneter »Knochenhaufen«. Wie sie gekrümmt auf ihrem »Schemel hockt wie ein nasses Eichhörnchen« und weinend um Verzeihung bittet, während Kaarina sie mit liebevollen Gesten beruhigt und ihr ihre ganze Zuwendung schenkt, ist ein zutiefst anrührendes Bild.
»Wege, die sich kreuzen« ist trotz des wunderbar klaren Erzählstils keine ganz reibungslose Lektüre. Jede einzelne Perspektive stellt detailreich das Alltagsleben einer anderen Phase des Jahrhunderts dar und kann insoweit zügig und interessiert gelesen werden. Andererseits nimmt jede Partien des zuvor Geschehenen wieder auf. Und trotzdem stellt sich das Gefühl ein, es fehle etwas in der Handlungsfolge, man habe etwas verpasst. Wer sich hinsichtlich des Unausgesprochenen nicht mit eigenen Spekulationen zufrieden geben will, sollte sich die lohnende Mühe machen und ab und zu zurückblättern oder am Ende noch einmal die fünf Anfangsseiten lesen. Der Effekt kann wuchtig sein. Die Lücken haben jedoch auch damit zu tun, dass sowohl Maria als auch ihre Nachfahren Schweigen für die beste Strategie halten, wenn sie in Unannehmlichkeiten geraten sind. Vielleicht haben sich Schweigsamkeit und Verschwiegenheit als zweckmäßige, Ressourcen sparende Eigenschaften unter den harten Umständen des einsamen hohen Nordens bewährt.
 · Herkunft:
· Herkunft: