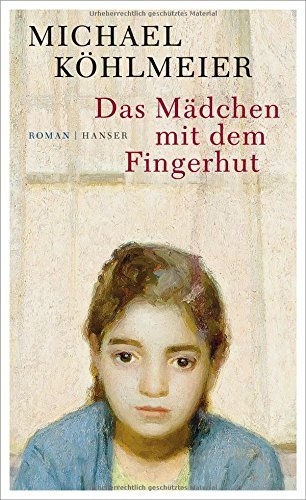Jeder schlägt sich selber durch
Über zehn Jahre ist es her, dass Katrina, einer der verheerendsten Hurrikane seit Menschengedenken, über den Südosten der USA tobte und alles verwüstete, was aufrecht stand. Etwa 1.800 Menschen riss er in den Tod. Viele von ihnen starben in den tosenden Wasserfluten, nachdem um New Orleans die Dämme brachen. Als wäre dies noch nicht genug an Inferno gewesen, explodierte 2010 vor der Küste des Golfs von Mexiko Deepwater Horizon, eine Ölplattform des BP-Konzerns. Das ungebremst hervorquellende Rohöl vergiftete die Fischgründe, verklebte das Gefieder der Wasservögel und verdreckte die Strände.
Bis heute leiden Mensch und Natur unter den ungeheuren Folgen. Bei Hunderttausenden hat sich seit den Apokalypsen jener beiden Jahre nur das verbessert, was sie mit ihren eigenen Händen und den geringen eigenen finanziellen Mitteln bewältigen konnten. Die meisten leben noch immer in den Ruinen ihres eigenen Lebens, und das war schon vor den Katastrophen nur selten eine erstrebenswerte Existenz. In diesem düsteren Szenario spielt Tom Coopers fesselnder Abenteuerroman »The Marauders«  , den Peter Torberg in gewohnt souveräner Weise übersetzt hat.
, den Peter Torberg in gewohnt souveräner Weise übersetzt hat.
Der Schauplatz ist ein Kaff bei New Orleans namens Jeannette: ein paar Supermärkte, Restaurants und Bars, ein Tanzschuppen, eine Strafanstalt, eine Kirche und viele notdürftig zusammengeflickte Schindelhäuser. Wer hier haust, hat fast alles verloren – eine intakte Bleibe, Möbel, Boote, hinreichende Verdienstmöglichkeiten, Angehörige. Doch aufzugeben ist bisher kaum jemandem in den Sinn gekommen. Irgendwie hat man sich arrangiert und mit dem wenigen, was verblieben ist, einen Neustart versucht, so wenig aussichtsreich er Außenstehenden erscheinen mag – »sie pressten nur Blut aus den Steinen«.
Während manche mit einfachen Mitteln ein paar Dollar verdienen können – Kreolen, Cajuns und Islenos bieten auf Klapptischen am Straßenrand Satsumas, Fische und geschmorte Eintöpfe aus Langusten feil –, sind andere den Folgen der Ölpest auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, denn die Lebensgrundlage der Gegend, die einst tierreiche Barataria Bay, ist größtenteils verseucht. Immer noch fahren Männer täglich durch das brackige Wasser der Mangrovensümpfe hinaus aufs offene Meer, um bei den Inseln Shrimps zu angeln. Doch selbst dort sind die Bestände dezimiert, viele Lebewesen verkrüppelt, und außerdem versorgen sich die früheren Abnehmer, die Restaurants, inzwischen lieber mit billigen asiatischen Tiefkühlprodukten. Den Fischern aus der Nachbarschaft reichen die mickrigen Erträge kaum noch zum Überleben.
Sieben Protagonisten stehen beispielhaft für all die frustrierten Lebenskünstler, schrägen Gestalten, Chaoten, Underdogs und Gesetzlosen dieser geplagten Region. In alternierenden Kapiteln erzählt jeder sein eigenes Schicksal und das seiner Familie oder Freunde. Die polyperspektivischen Stimmen und Eindrücke ergeben am Ende ein vielfältiges Bild dessen, was Natur und Mensch erschaffen haben, was Natur und Mensch zerstört haben und welchen Preis Natur und Mensch jetzt tragen müssen.
Der siebzehnjährige Wes Trench hält bis heute Distanz zu seinem Vater Bob. Hätte der vor dem Sturm nicht starrköpfig darauf bestanden, im Haus zu verharren, anstatt den vorbeugenden Empfehlungen der Medien zu folgen und mit seiner Familie vor der drohenden Gefahr zu fliehen, wäre Wes' Mutter sicherlich nicht in den Fluten ertrunken.
Eine Zeitlang fuhren die beiden täglich auf Bobs Kutter hinaus zum Shrimpsfang. Ärger war unausweichlich. Als der Streit eskalierte, heuerte Wes bei dem irrwitzigen einarmigen Fischer Gus Lindquist an. Auch der hat sein Päckchen zu tragen. Seine Frau und seine Tochter haben ihn verlassen. Er dröhnt sich mit Alkohol und Schmerztabletten zu, die er sich aus einem PEZ-Spender mit Donald-Duck-Kopf einwirft. Außerdem treibt ihn die Vision, er werde eines Tages den Schatz des legendären Freibeuters Jean Lafitte finden. Dazu durchkämmt er in jeder freien Minute mit einem Metalldetektor den Schlamm nach spanischen Dublonen. Was er findet, hat jedoch meist nur geringen Wert: Es sind Schmuckstücke, die er umgehend beim Pfandleiher für kleines Geld verhökert. Die traurige Kehrseite der Medaille ist ihm bewusst: Was ihm ein paar Cent einbringt, gehörte einmal jemandem, dem die Katastrophe sein ganzes Hab und Gut, wenn nicht das Leben geraubt hat.
Mit seinen abenteuerlichen Aktivitäten ist Lindquist einem arglistigen Zwillingspaar, den Toup-Brüdern, gefährlich nahe gekommen. Die unheimlichen »Bluthunde« bauen auf einer der vielen abgelegenen Inseln im Bayou heimlich Marihuana an. Als Warnung haben sie Lindquist seine dreißigtausend Dollar teure elektrische Armprothese geklaut, und eins ist klar: Sie schrecken auch vor Mord nicht zurück. Seine Diebstahlsanzeige stößt freilich bei der Polizei auf geringes Interesse. Sheriff Villanova rührt keinen Finger. Doch einen wie Lindquist wirft das nicht um. Mangels Geld – da geht es allen gleich mies – muss er jetzt seiner Arbeit zu Wasser und zu Lande halt mit einem simplen Haken aus dem Supermarkt nachgehen, so mühselig das auch ist.
Der sagenhaften, geheimnisumwobenen Shit-Plantage sind noch andere auf der Spur. Eine unfreiwillig abgeleistete Sozialarbeit hat in New Orleans die zwei findigen Kleinganoven Cosgrove und Hanson zusammengeführt, ein Kleindealer berichtet ihnen von der unauffindbaren Insel, wo irgendwelche verrückten Typen traumhaften Shit anbauen und dir die Arme abschneiden, wenn du ihnen zu nah auf den Pelz rückst, und so etwas spornt die beiden an. Doch sie unterschätzen das psychopathische Potenzial der Toup-Zwillinge gewaltig ...
In der allseitigen Not ist mancher versucht, jeden Strohhalm zu ergreifen, wenn es denn ein paar Dollar einbringt. Darauf baut der Schadenverursacher, der BP-Konzern, den nur ein Interesse treibt: Schadenersatzforderungen zu minimieren. Mit der dreckigen Arbeit vor Ort ist Bady Grimes beauftragt. Er sucht die verzweifelten, Leid geprüften Katastrophenopfer auf, heuchelt Anteilnahme, geriert sich als Retter in der Not und lügt das Blaue vom Himmel herunter, was für einen fetten Scheck sie einstecken können, wenn sie nur ihren Namen auf ein Blatt Papier setzen. Mit jeder Unterschrift, die ein unschuldiges Opfer mit einem Almosen statt einer reellen Abfindung abspeist, wächst das Quantum Whiskey, mit dem sich Grimes am Abend zuschüttet.
Was dem verschlagenen Miesling seine perfide Arbeit erleichtert, ist die Tatsache, dass er selbst aus dieser Gegend stammt. Obwohl er schon frühzeitig aus dem Sumpf abgehauen ist, genießt er, zurück unter seinesgleichen, einen Vertrauensvorschuss, wenn er daherkommt wie eine »Sumpfratte« anstatt als »Yankee« aus dem Norden.
Tom Coopers Debütroman »Das zerstörte Leben des Wes Trench« ist ein spannender Abenteuerroman mit einer Prise Krimi in bester amerikanischer Erzähltradition und tief verwurzelt in seiner Region. Der Staat Louisiana ist gebeutelt von Korruption, Armut, Intoleranz, Umweltzerstörung und der alljährlichen Hurrikansaison. Die leicht überzeichneten Figuren kämpfen hartnäckig gegen alle Widrigkeiten an und repräsentieren ein Spektrum möglicher Verhaltensweisen. Die einen schnappen gierig wie die Alligatoren in den Sümpfen nach jeder Gelegenheit in Reichweite, andere ackern sich in ihrem verwüsteten Umland schier zu Tode, wieder andere verlieren sich auf der Suche nach einem Eldorado im Wahn.
Auch Wes lässt sich seine »Heimat« nicht durch üble Fakten mies machen. Hier gehört er hin, hier wird er bleiben, und Tom Coopers Schilderungen lassen uns nachvollziehen, warum: »Die Barataria war der torfige Geruch von Louisianamoos im ersten Frühlingsregen ... Termitenschwärme im Mai ... Lärm der Sumpffrösche im Sommer ... Karneval des Mardi Gras ... das grüne Leuchten der Zypressen in der Abenddämmerung ... die Cajun-Stimmen, salzig und rau ... die alten Gesichter, so fremdartig wie Daumenabdrücke«. Trotz der »verfluchten Ölgesellschaften« spürt Wes den »Sog der Zukunft«.
Bei aller Tragikomik und bitterem Sarkasmus setzt sich am Ende ein positiver Ausblick nach amerikanischem Credo durch: Wes, das starke, ambitionierte Individuum, lässt sich nicht unterkriegen, wird als Hoffnungsträger gefeiert. Keine Rede davon, dass ja auch mal die Solidargemeinschaft, der Staat wenigstens den Schwächsten ein wenig unter die Arme greifen könnte. Dazu passt es, dass die Bundeshauptstadt Washington und der amtierende Präsident George W. Bush, der wegen Katrina kein Aufhebens machte (»Katrinagate«), im ganzen Buch keine Erwähnung finden. Was ein richtiger Amerikaner ist, der schlägt sich eben mit eigener Kraft durchs Leben und jammert nicht nach staatlicher Hilfe.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2016 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: