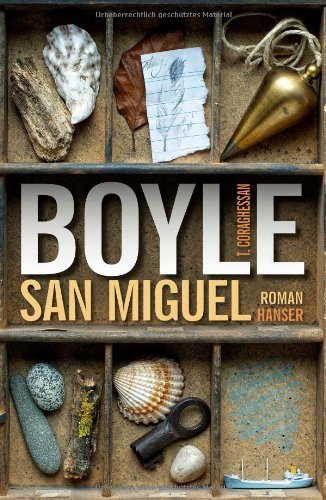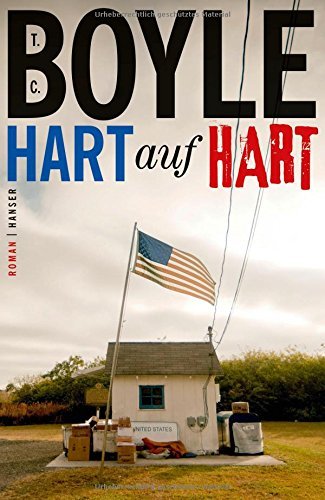
Freie Wut- und Wahnbürger
Jeder Mensch, so steht es seit 1776 in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, hat das unveräußerliche Recht, seinen eigenen Weg zum Glück zu verfolgen. Nichts und niemand kann also einen souveränen Bürger des Land of the Free davon abhalten, seinen Individualismus auszuleben, schon gleich nicht eine Obrigkeit. Was für Blüten dieses Credo treiben kann, führt T.C. Boyles neuer Roman in gewohnt bissiger Zuspitzung vor Augen. (Die US-Realität kann freilich locker mithalten, wie wir immer wieder staunend aus den Medien erfahren.)
Drei Exemplare abgründiger Besessenheit von einem verabsolutierten Freiheitsideal entwickelt der Autor in dreizehn brillant erzählten Kapiteln, großes Lesekino immer ganz nah dran am dramatischen Geschehen. Drei einsame Figuren – Vater, Sohn und dessen Freundin – verrennen sich ungebremst in ihre egozentrisch-individualistische Weltanschauung, bis alle Sicherungen durchbrennen und sie zu Gewalt greifen, um sich gegen die (vermeintlichen oder echten) Feinde ihrer Selbstbestimmung zur Wehr zu setzen. Dass sie dabei aberwitzigen Verschwörungstheorien aufsitzen und Manien ausleben (Xenophobie, Waffenfanatismus), ahnen sie natürlich nicht einmal, zumal Alkohol und andere Drogen ihr Bewusstsein vernebeln.
Sten Stensen, pensionierter Direktor der Fort Bragg Highschool, lebt komfortabel, angesehen und einflussreich im kalifornischen Mendocino. Seine Stunde schlägt während einer Kreuzfahrt mit Gattin Carolee. Ein spontan gebuchter Ausflug von Puerto Limón in Costa Ricas Urwald verläuft von Anfang an ganz anders als versprochen. Ein »missmutiger Finsterling« von Fahrer steuert seinen klapprigen Ex-Schulbus in atemberaubendem Tempo über unpassierbare Straßen voller schlammiger Schlaglöcher, ohne sich um die Bedürfnisse seiner ältlichen Gäste zu scheren. Durchgeschüttelt, halb verdurstet und total verschwitzt erreicht man endlich das zivilisationsferne Ziel, wo freie Affen, Agutis, Faultiere, womöglich Jaguar und Ozelot darauf warten, fotografiert und gefilmt zu werden.
Das echte »Abenteuer«, der »Ausbruch aus der Routine« stellt sich noch am Parkplatz ein. Drei junge Männer, »Ticos mit kahlgeschorenen Schädeln«, entsteigen einem verbeulten gelben Chevy und fordern, mit Pistole und Messer fuchtelnd, ganz einfach »Todo!« von den Gästen. Das abgekartete Spiel zwischen Busfahrer und den Urwaldbewohnern lässt den Senioren keine andere Wahl, als alle Besitztümer abzuliefern. Auch Sten hat wohl keine Wahl, wenn er jetzt ausrastet: Im Inneren des hochdekorierten Vietnam-Veterans zündet ein Automatismus (»Einmal Marine, immer Marine.«), er nimmt den Jungen mit der Pistole in den Würgegriff und drückt »jenseits jeder Vernunft« zu, bis das Zappeln für immer aufhört.
Was blüht Sten jetzt? Inhaftierung, Mordanklage, Prozess, mildernde Umstände wegen Notwehr? Nichts davon. Die Polizisten verhören ihn, bitten ihn, mutmaßliche Mittäter zu identifizieren, lassen Bemerkungen fallen wie »ein Krimineller ... kein großer Verlust für die Welt ... einen Gefallen getan« und entlassen Sten auf das Schiff. Zu Hause in den Staaten wird er in allen Medien als Held bewundert und gefeiert, während sein Tun ihm selbst immer befremdlicher erscheint, je mehr Abstand er dazu gewinnt. Bei der Gegenüberstellung war er sich sicher gewesen, den Jugendlichen »noch nie zuvor gesehen« zu haben, und hatte doch »Ja, das ist er« gesagt, »ausschließlich aus Wut«.
Dieses Eingangskapitel setzt den Grundton des Romans; die nachfolgenden setzen noch ein paar wesentlich kräftigere Akkorde drauf.
Die Protagonistenrolle übernimmt jetzt Sara Hovarty Jennings, 40, geschieden, früher Aushilfslehrerin an Stens Schule, jetzt Hufschmiedin. Sie ist verbohrt in ihre Unabhängigkeit und verbittert gegen alles, was sie einschränken könnte, wie etwa die Gesetze der »Illegitimen Regierung des Amerikas der Konzerne«. Anschnallpflicht, Nummernschilder, Steuern – alles reine »Schikane«, der sie sich niemals ergeben wird. Nach vermeintlich gut amerikanischen Prinzipien und Traditionen biegt sie sich stur ihre Lebensweise zurecht, auch wenn sie sich dadurch ständig Ärger einheimst.
Jetzt fährt sie mit Hund Kutya auf der Rücksitzbank zu einem Tierschutzreservat, um dort afrikanische Huftiere zu pediküren. Ein freier Bürger in seinem »Privateigentum« unterwegs auf »öffentlichen Straßen« – warum und wohin, das war »ihre Sache und ging niemanden etwas an«. Schon gleich nicht die cops, die ihr heimtückisch am Straßenrand auflauern und Papiere sehen wollen. Sie denkt nicht daran, den Bullen in »Halloweenverkleidung« zu Diensten zu sein (»Ich habe keinen Vertrag mit Ihnen.«). Der Konflikt zwischen »Unterdrücker« und »Unterdrückter« eskaliert, Kutya beißt zu, Sara endet im Gefängnis, der Hund im Tierheim. Gegen Kaution kommt Sara frei. Auch ihr Auto kann sie bei einem »Handlanger und Lakai des Konzernstaates« in der Zulassungsstelle auslösen. Kutya aber soll wegen seiner Beißwut und fehlendem Tollwutimpfnachweis dreißig Tage in Quarantäne bleiben. Das wird Sara niemals hinnehmen ...
Auf der Rückfahrt im befreiten Privateigentum, nicht angeschnallt, aber getröstet von guter alter country music, hält sie an, um einen jungen Tramper aufzunehmen. Der Typ mit kahlgeschorenem Schädel, »Kampf- oder Tarnanzug« und Rucksack scheint bekifft. Stocksteif schweigt er mit stierem Blick neben ihr, bis ihn ein entgegenkommender »Bullenwagen« aus der Lethargie reißt. »Wichser!«, schreit er und wirft sich mit seinem Oberkörper über Sara zum geöffneten Fahrerfenster hin, um den cops beide Stinkefinger entgegenzurecken. Sara kennt ihn: »Der Sohn von Sten Stensen, stimmt's? ... Adam.« Aber mehr als »Ich heiße Colter« sagt er nicht.
Sara liebt Adam auf den ersten Blick, ungeachtet der fünfzehn Jahre Altersunterschied. (Er wird ihren weichen Körper, ihre Kochkünste und ihr kuscheliges Heim zu schätzen lernen.) Noch ist es zu früh, mit ihm den schrecklichen Zustand der Gesellschaft zu erörtern, aber bei einer Befreiungsaktion (Free Kutya!) könnte er sich nützlich machen.
Lebt Sara schon in einer Parallelwelt, so hat sich Adam auf einen anderen Stern katapultiert. Das spätgeborene Wunschkind der Stensens fällt schon früh auf, wird therapiert und muss Medikamente nehmen. Als er in der Highschool einen Jungen zusammenschlägt, weil der »ein Alien« sei, gibt Sten ihn innerlich auf. Um sich endgültig von seinen Eltern und deren Erziehungsversuchen zu befreien, zieht Adam zur Großmutter in den Wald. Sie fragt nicht viel, nimmt ihn, wie er ist, umsorgt ihn liebevoll. Der abgelegene Forst am Noyo River, wo ihr Haus steht, erlaubt es ihm, seinem Vorbild nachzueifern, der Trapperlegende John Colter, über dessen abenteuerliches Frontier-Leben er mit Begeisterung ganze Bücher gelesen hatte. Je weniger Adam mit seinem realen Hier und Jetzt klar kommt und glaubt, dass »alles in seinem Leben Scheiße und nichts als Scheiße war«, desto weiter zieht er sich als »moderner Waldläufer« in seine eigene Welt zurück, wo er sich frei und ungestört allen überlegen wähnen kann.
Den Faible für die mythisch verklärte Wildnis des Westens teilt auch Sten. Er engagiert sich in Mendocino bei der Bürgerinitiative »Unser Wald gehört uns«. Das ist »keine Bürgerwehr«, und Sten ist »kein Rassist«. Aber gegen die »Hispanos«, die als Wanderarbeiter das Land überschwemmen, Wald und Flüsse verseuchen, gefolgt von Drogenkartellen, die auf harmlose Angler, Jäger und Touristen schießen, gegen die muss man sich wehren. Grausame Ironie: Eines Tages wird Sten den Wald vor seinem Amok laufenden Sohn schützen müssen ...
Nach dem Tod der Großmutter hat Adam freie Hand in ihrem Haus. Getrieben von Wahnvorstellungen durchstreift er den Wald, pflanzt Mohn an, baut einen Bunker und eine zweieinhalb Meter hohe, türlose Ringmauer ums Haus. Denn er muss vorbereitet sein, wenn »die Feinde« kommen – der Vater, »die Bullen« und andere Handlanger des Staates, »die Chinesen«, die Aliens. Als Sten ein Loch in die Steinwand bricht (das Haus soll verkauft werden, Adam wieder zu den Eltern ziehen), klinkt Adam aus. Er wird zu einem waidwunden, unberechenbaren Tier, zu einer mörderischen Zeitbombe. Die Jagd auf ihn ist eröffnet.
Sprachlich und strukturell perfekt gestaltet, intensiv und bildstark erzählt, ist »The Harder They Come«  (übersetzt von Dirk van Gunsteren) ein absolut lesenswertes Psychogramm dreier Außenseiterfiguren. Was der Roman wider Erwarten nicht ist: eine Gesellschaftskritik. Zwar lassen die Protagonisten ihrer Wut auf Staatsorgane, wirtschaftshörige Regierung und allmächtige Konzerne freien Lauf, aber ihr Furor ist nicht politisch, sondern privat motiviert. Sie sind keine Analysten und Aktivisten, sondern staatsverdrossene Spinner und Phrasendrescher voller schwammig-pauschaler Vorurteile – und obendrein inkonsequente Opportunisten. Sara zum Beispiel hegt einerseits ein gewisses Verständnis für den Bombenattentäter Timothy McVeigh und den Mordschützen Jerry Kane und verweigert dem System ihre Steuergroschen, geht aber andererseits arbeiten, konsumiert brav und nutzt selbstverständlich die kommode staatliche Infrastruktur. Sten ist ein angesehener, wohlhabender Bürger seiner Stadt, aber durch seine Kriegserfahrungen verformt. Und sein Sohn Adam ist dank der verkorksten Sozialisation und des Drogenkonsums derart durchgeknallt, dass er wohl mit keinem System in Einklang leben könnte.
(übersetzt von Dirk van Gunsteren) ein absolut lesenswertes Psychogramm dreier Außenseiterfiguren. Was der Roman wider Erwarten nicht ist: eine Gesellschaftskritik. Zwar lassen die Protagonisten ihrer Wut auf Staatsorgane, wirtschaftshörige Regierung und allmächtige Konzerne freien Lauf, aber ihr Furor ist nicht politisch, sondern privat motiviert. Sie sind keine Analysten und Aktivisten, sondern staatsverdrossene Spinner und Phrasendrescher voller schwammig-pauschaler Vorurteile – und obendrein inkonsequente Opportunisten. Sara zum Beispiel hegt einerseits ein gewisses Verständnis für den Bombenattentäter Timothy McVeigh und den Mordschützen Jerry Kane und verweigert dem System ihre Steuergroschen, geht aber andererseits arbeiten, konsumiert brav und nutzt selbstverständlich die kommode staatliche Infrastruktur. Sten ist ein angesehener, wohlhabender Bürger seiner Stadt, aber durch seine Kriegserfahrungen verformt. Und sein Sohn Adam ist dank der verkorksten Sozialisation und des Drogenkonsums derart durchgeknallt, dass er wohl mit keinem System in Einklang leben könnte.
Als Beitrag zum uramerikanischen Konflikt des Individuums um die Grenzen seines Freiheitsanspruchs bleibt »Hart auf hart« also unscharf – ausgezeichnete Unterhaltung ist auch T.C. Boyles neuester Roman aber in jedem Fall.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2015 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: