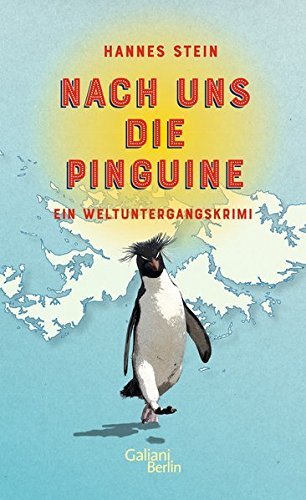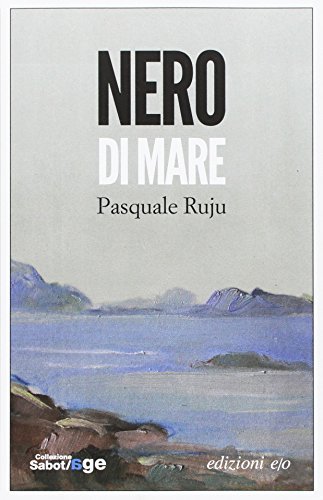Harley verleihen kann Leben retten
Ganz unauffällig firmiert dieser Roman als Thriller und hat doch viel mehr zu bieten als hartgesottene Verbrechensszenarien. Stephen Dobyns, 1941 geboren, als wort- und bildstarker Schriftsteller amüsanter Unterhalter und begnadeter Zyniker, variiert das Genre, indem er seinen Beitrag als abstruse, schwarzhumorige Lachnummer daherkommen lässt.
Bis es zum ersten Mal kracht, macht uns der souveräne Erzähler fünf Seiten lang mit den Reizen, Besonderheiten und Bewohnern des Küstenstädtchens New London, Connecticut, vertraut. Gewiss könnte er ganze Bücher darüber füllen, denn er beschränkt sich offensichtlich nur deswegen auf das Relevanteste, »damit es weitergeht«. Das Wichtigste in Kürze. Es ist ein lauer Frühlingsmorgen im Spätwinter. Tirilierende Rotkehlchen und dumpf grollende Harleys sind die ersten vernehmbaren Boten des nahenden Frühlings. Mensch und Tier zieht es ins Freie, und schon laden die ersten vorwitzigen Tisch-und-Stuhl-Arrangements zum Snack im Freien.
»Es wäre falsch, zu sagen, es sei ein guter Tag zum Sterben, aber gewiss kann man sich schlechtere vorstellen«, stimmt uns der Erzähler auf das ein, was unvermeidlich kommen muss, aber ihn keineswegs nötigt, eine tristere Tonart anzuschlagen. So fährt er mit unveränderter Lust an Farben und Formen, makabren Details und vorgeblich knochentrockenem Fabulieren fort, uns die wenigen Sekunden eines entsetzlichen Unfalls und seiner gruseligen Folgen auszumalen.
Ein Lastwagen setzt aus einer Ausfahrt zurück, crasht in die Ladenfront auf der anderen Straßenseite, so dass ein heranbrausender Harley-Fahrer an Bremsen nicht einmal mehr denken kann. Fatalerweise flutscht die untere Hälfte des Kraftrads und seines Fahrers unter dem LKW-Chassis hindurch, während der Kipperaufbau beider höhergelegene Teile abrupt zum Stillstand bringt, soweit sie sich nicht auf der Fahrbahn und weit darüber hinaus verstreuen oder verschmieren. Augenzeugen sind zunächst einmal darauf konzentriert, ihres Brechreizes Herr zu werden und Blutspritzer von ihrer Kleidung zu tupfen.
Einer von ihnen ist Connor Raposo, 25. Trotz der chaotischen Umstände erspäht er am Randstein eine nunmehr herrenlose Harley-Kappe, mit rotem Satin gefüttert und mit dem handschriftlichen Namenszug »Marco Santuzza« gekennzeichnet. Aus welchen Gründen auch immer nimmt Connor das gute Stück, das der Polizei die Identifizierung des Bikers vereinfacht hätte, an sich.
Ein weiterer Zeuge ist der im Viertel prominente Obdachlose Fidget, von klapperdürrer Gestalt, mit meist getrübten Sinnen und wechselnden fantasiereichen Körperwahrnehmungen. Aktuell plagt ihn ein lästig hinter ihm baumelnder, anderthalb Meter langer Schwanz, als sei er eine Ratte. Ansonsten ist Fidget umtriebig wie eh und je, um nichts zu übersehen, das er zu Geld machen könnte. Am blutigen Unfallort ist sein Stöbern allerdings unwillkommen. »Verpiss dich hier, du Sackgesicht«, pfeift ihn einer der drei Polizisten an, die sich mühen, die Stätte des Schreckens zu sichern und den Hergang der Katastrophe zu erforschen.
Detective Benny Vikström hört von dem übergewichtigen LKW-Fahrer Leon Pappalardo, er sei mit seinen monstergroßen Füßen vom Bremspedal abgerutscht. Kollege Manny Streeter erfährt von einem der Gaffer, die aus allen Löchern herbeigeeilt sind, dass ein Typ mit Elvis-Locke dem Trucker zugewunken habe. So eine Geste – wenn sie denn tatsächlich ausgeführt wurde – ließe Raum für Interpretation. Ist hier womöglich ein hinterhältig und kaltblütig geplanter Mord geschehen?
So verkorkst wie der Un- (oder Mord-?) -fall ist auch das Gespann Streeter/Vikström, das nun ermitteln muss. Die beiden fechten einen erbitterten Psychokrieg aus und treiben einander unterschwellig zur Weißglut. Auslöser war, dass Ehrgeizling Manny der Begeisterung für sein Karaokehobby freien Lauf ließ, von Benny, dem Bauchgefühlermittler, bei einer musischen Abendeinladung jedoch nur ungebändigtes Gelächter erntete.
Derlei schräge und zumeist üble Typen bevölkern den Thriller mit Unterhaltungswert in großer Zahl. Dem einen oder anderen unter ihnen ist es nicht vergönnt, den Plot zu überleben, und irgendwie hängen die Todesfälle miteinander zusammen. Um das genauer zu durchschauen, geben sich die beiden Ermittler redlich Mühe. Sie schauen sich tapfer die grauenhaftesten Tatorte an und vernehmen Zeugen, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen (nicht einmal mit ihren wechselnden Namen), dreist lügen oder schlicht nichts wissen.
Während die Detectives die »Kausalitätsketten auf- und abwärts« knüpfen, ohne einen Schritt voranzukommen, gewährt der Autor dem Leser einen Erkenntnisvorsprung. Immer mal wieder meldet sich der Erzähler als Person zu Wort, um den Fortgang der Handlung zu kommentieren. Ist es nicht zutiefst beeindruckend, wenn der – nach eigenem Bekunden – beste unter vielen Schreiberlingen Handlung und Figuren für uns mit der »apophatischen Theologie« verquickt, die ja darauf hinausläuft, »dass wir nichts über Gott wissen«? Am liebsten kokettiert dieser allwissende Erzähler als großer Relativierer oder gleich als Garnichtswisser. Das pingelig sezierte Äußere eines Menschen, seine Gesten oder seine Mimik als eindeutigen Ausdruck seiner Seelenverfassung oder seines Charakters zu deuten, das ist ihm unmöglich. Wir »könnten« doch nachhaken, aber »wichtig ist es nicht«; dann weckt ein skeptisches »so einfach ist das« unsere Zweifel, ein schlichtes »vielleicht ...« oder ein resignierendes »wir wissen es nicht«.
So belässt er viele Charaktere bis zum Schluss schwer durchschaubar wie das Leben. Beispielsweise Connor: einerseits aufrecht, von Schuldgefühlen geplagt, andererseits ein gut organisierter, kreativ abzockender Charity-Betrüger.
Oder »Fat Bob«, dessen Spitznamen sein Harley-Modell bezeichnet und den Buchtitel ziert: Eigentlich wäre er von Leons Laster halbiert worden, hätte er seine Maschine nicht an einen Kumpel verliehen. Die Titelfrage – »Is Fat Bob Dead Yet?«  (wie das ganze Buch von Rainer Schmidt übersetzt) – bleibt offen bis zum letzten Atemzug – will heißen: bis zur letzten Seite.
(wie das ganze Buch von Rainer Schmidt übersetzt) – bleibt offen bis zum letzten Atemzug – will heißen: bis zur letzten Seite.
 · Herkunft:
· Herkunft: