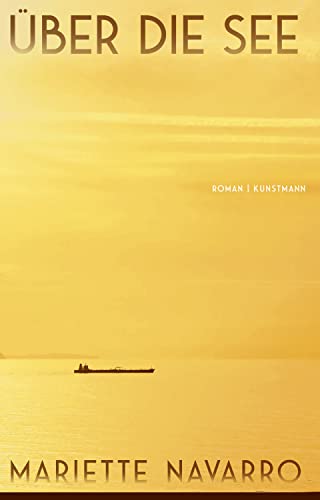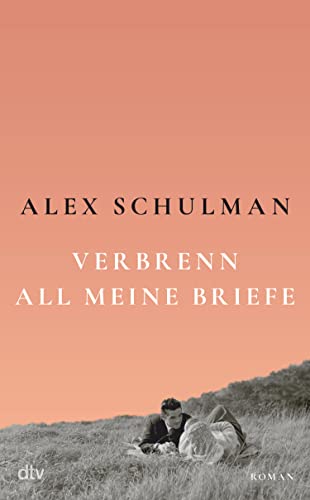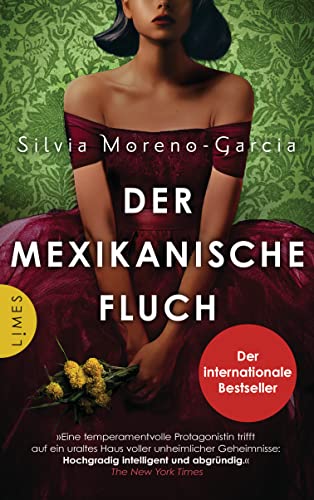
Der mexikanische Fluch
von Silvia Moreno-Garcia
Noemí folgt dem Hilferuf ihrer Cousine, um sie aus den Klauen der Familie ihres Ehemannes zu retten, die sie in deren vergammeltem Herrenhaus gefangen hält. Die Geschehnisse werden von Tag zu Tag unglaublicher und blutrünstiger, die Erklärungen immer abstruser. Bei Fans findet das weltweit Anklang, bei mir nur die mexikanische Einfärbung dieser Gothic-Variante.
Mahlzeit, ihr Götter!
Es geht zurück in die Fünfzigerjahre und in die (für uns) exotische Weltgegend des mexikanischen Hochlandes. Zunächst aber lernen wir Noemí Taboada, 22, kennen, die in der quirligen Metropole Mexico City ein sorgloses Studentenleben führt. Als Tochter aus vermögender Familie mangelt es ihr an nichts, sie kann ihre Freiheit in vollen Zügen genießen. Man sieht die selbstsichere, unternehmungslustige Frau auf Festen umschwärmt von Verehrern, aber mit festen Bindungen hat sie noch nichts am Hut. Ihre Ambitionen sind hoch, erst will sie einen Studienabschluss.
Ein Brief wird ihr Leben verändern. Geschrieben hat ihn ihre Cousine Catalina. Die ist fünf Jahre älter und hat vor Kurzem Virgil Doyle geheiratet, den man für eine gute Partie halten durfte. Jetzt wohnt sie mit ihm und seiner Familie in einem Herrenhaus englischen Stils in der Bergbaustadt El Triunfo im Hochland. Doch was sie in ihrem Brief mitteilt, klingt zusammen mit einem ungewohnt nervösen, leicht hysterischen Tonfall beängstigend. Da ist die Rede von »vergiften«, von »Angst vor diesen ruhelosen Toten«, von Stimmen und Visionen. Noemí soll sie aufsuchen und macht sich auf den Weg.
Am einsamen Bahnhof von El Triunfo erwartet sie ein blutleerer junger Mann namens Francis, um sie in einem museumsreifen Straßenkreuzer abzuholen, aber Florence, seine Mutter, die sie an dem baufällig wirkenden Herrenhaus empfängt, entpuppt sich schnell als wahrer Hausdrachen. Sie wird den Gast streng überwachen und jeden faut pas wie Sprechen bei Tisch oder Rauchen sofort rügen, denn die pingelige Einhaltung von Tischsitten und Hausordnung gehört zur vornehmen Lebensart. Eigenartig andererseits, dass niemand die Besucherin herzlich willkommen heißt, obwohl sie doch von Virgil eingeladen wurde.
Die Liste der Bewohner des Anwesens ist übersichtlich, und alle heißen mit Familiennamen Doyle. An der Spitze steht Howard Doyle, der aristokratische Patriarch, ein von Schmerzen geplagter, vor sich hin siechender Alter. In der Hierarchie folgt ihm sein Sohn und zukünftiger Erbe Virgil, Catalinas Ehemann. Hausdame Florence ist Howards Nichte, ihr Sohn Francis sein Großneffe.
Nur Catalina, das eigentliche Ziel von Noemís Reise, bleibt im Hintergrund – sie brauche Ruhe. Erst als es Zeit wird für ihre Medizin, darf Noemí endlich ihr Zimmer betreten. Von Krankheit gezeichnet wirkt die Cousine allerdings nicht. Sie sitzt unbeweglich in einem Sessel, den Blick nach draußen gerichtet, als fühle sie sich in Gefangenschaft. Erklärungen lassen auf sich warten.
Das Abendessen wird im düsteren Speisesaal von einem grauhaarigen Dienstmädchen aufgetragen. Sie stellt eine wässrige Suppe auf die Damasttischdecke unter dem Kandelaber. Nur Florence und Francis leisten Noemí Gesellschaft. Catalina schläft, Virgil und Howard könnten sich, wie es heißt, zu vorgerückter Stunde noch einfinden.
Die Begegnung mit Howard verläuft unerfreulich. Dem alten Rassisten sticht sofort die dunkle Hautfarbe des Gastes ins Auge, und er beredet ihre Abstammung. Doch die furchtlose, belesene Noemí kann ihn mit ihren anthropologischen Kenntnissen beeindrucken, und auch seine eindeutigen sexistischen Anwandlungen weiß sie abzuwehren, bis sie sich endlich in ihr Gästezimmer zurückziehen kann. Dort muss sie mit Kerzen, Öllampen und den lauen Temperaturen des antiken Warmwasserboilers zurechtkommen.
Einst hatte eine Gold- und Silbermine den Kolonialherren großen Wohlstand gebracht, und Howard war der letzte Profiteur. Nach einem furchtbaren Unglück mit Dutzenden von Todesopfern wurde der Betrieb geschlossen, die Mine mit Wasser geflutet, und die meisten Menschen verließen den Ort. Nur die Doyles blieben. Heute ist von ihrem einstigen Reichtum nicht mehr viel zu merken, das Herrenhaus ist zu einem muffigen, antiquierten Anwesen verfallen.
Längst sind die Weichen gestellt für eine unheimliche, spannende Geschichte in einem attraktiven Setting. El Triunfo bietet das Potenzial einer bewegten Historie seit der Kolonialzeit. Die Blüte des Bergbaus machte die Grubenbesitzer reich, die Arbeiter zahlten die Zeche mit ihrer Gesundheit, bis sie gegen ihre Arbeitsbedingungen streikten. Es kam zu einer Revolution und zum Niedergang. So viel Interessantes dies alles versprechen mag: Die Autorin hat anderes im Sinn. Denn sie ist dem Genre des »Mystery Gothic« verpflichtet.
So ist die Erzählung mit dem Ortswechsel aufs Land mit Schauer-Elementen angereichert, wozu das seltsame Gebahren der kauzigen Hausbewohner und das unheimliche Ambiente des verlotterten Gebäudes gehören (ständig knarzende Holzbauteile, zugige Flure, flackernde Kerzen, wispernde Wände, rätselhafte Symbole überall und eine neblige Großwetterlage), serviert mit einer sexuell aufgeladenen Atmosphäre – man kennt die Klischees aus einschlägigen Romanen, Filmen und Persiflagen. Je weiter die Handlung fortschreitet, desto gruseliger geraten die Zutaten, und mit jeder Steigerung werden sie unglaubwürdiger. Wer hätte sich träumen lassen, wozu harmlose Schimmelflecken hier mutieren können?
Neben Stimmen im Allgemeinen und Geistern im Besonderen, die sich an Catalina wenden (Letztere aus den Wänden), sucht eine Heilerin auch Noemí auf und steckt ihr grausame Geheimnisse aus der Vergangenheit. Doch mit ihrem Mumpitz kann sie nur eingefleischte Fans des Horror-Genres beeindrucken. Weniger versierte Leser mögen wenigstens das Treiben des schrulligen Personals samt der kuriosen Geistwesen in einem hübsch und stimmig aufbereiteten Setting sowie die hürdenfrei eingängige Sprache goutieren (Übersetzung von Frauke Meier). Die mexikanisch-kanadische Schriftstellerin Silvia Moreno-Garcia, 1981 geboren, wurde immerhin schon mit etlichen Preisen ihres Metiers ausgezeichnet.
Bis an einem gewissen Punkt das Maß voll ist. Unerträglich kann irgendwann werden, dass die fiktionalen Sachverhalte jeden Bezug zur realen Welt verlieren, dass die Suche nach halbwegs rationalen Erklärungen hoffnungslos und aus Grusel blanker Ekel wird (da hat der alte Howard Unsägliches zu bieten).
 · Herkunft:
· Herkunft: