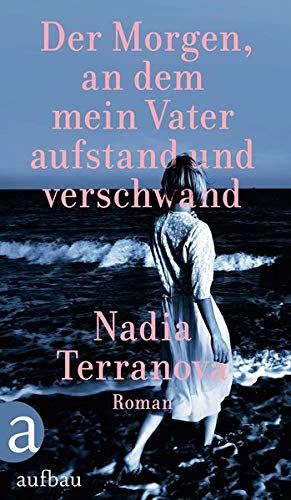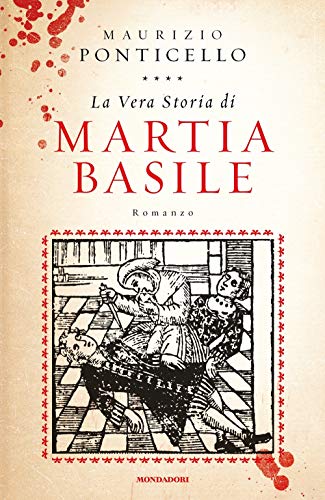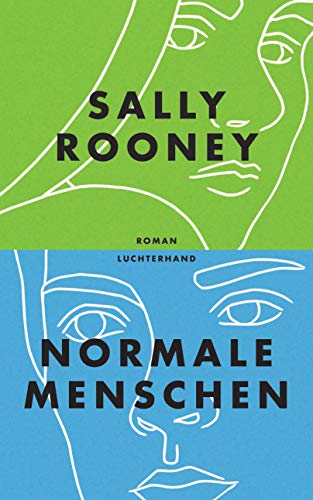
Normale Menschen
von Sally Rooney
Marianne und Connell, alles andere als normale junge Leute, durchleben und durchleiden eine komplizierte Beziehung.
Eine verkrampfte Geschichte
Ob die Autorin den Titel ihres Romans (es ist ihr zweiter) wohl ironisch gemeint hat? Marianne und Connell, die Protagonisten, kommen aus der Ober- bzw. der Unterschicht einer westirischen Kleinstadt. Trotz aller sozialen Unterschiede werden die beiden von Anfang an heftig zueinander hingezogen und genauso schnell wieder voneinander abgestoßen wie die Pole eines Magneten. Über vier Jahre – 2011 bis 2015 – durchleiden wir eine komplizierte On-Off-Liebesbeziehung, die die Frage aufwirft, was an diesen Figuren und ihrer Beziehung »normal«, was literarisch reizvoll sei. Ich empfand die Geschichte, die kein Klischee und kein Extrem auslässt und mit der »Normalität« nicht viele Berührungspunkte aufweist, jedenfalls als gähnend langweilig.
Doch schauen wir genauer hin. Connell Waldron kommt aus den ärmlichen Verhältnissen einer »schlechten Familie«. Der eine oder andere Verwandte war zeitweise im Gefängnis. Connell aber, eine gut aussehende, durchtrainierte Sportskanone, Klassenbester in Englisch und bei allen Mädchen beliebt, scheint nichts »von einem Waldron« zu haben. Seine Mutter war bereits mit siebzehn schwanger und zog den Jungen alleine groß. Sie arbeitet als Putzfrau im Haushalt der reichen Sheridans, was Connell äußerst peinlich ist, könnte die Tatsache doch seinem Ansehen abträglich sein. Deswegen soll möglichst niemand von diesem Arbeitsverhältnis erfahren – und schon gleich nicht von der Liebelei, die sich zwischen ihm und der Sheridan-Tochter anbahnt.
Die Sheridans sind eine der »guten Familien«. Beide Eltern sind Anwälte und wenig zu Hause. So weiß wie die Villa, so unterkühlt ist die Atmosphäre darin. Die beiden Kinder sind auf sich gestellt. Alan, der Erstgeborene und ein Widerling, glaubt, dass ihm die Aufsicht über Marianne obliege, und er schreckt nicht davor zurück, sein Vorrecht mit Gewalt durchzusetzen. Kein Wunder, hat doch auch der Vater Gefallen daran, Ehefrau und Tochter gelegentlich zu prügeln. So tröstet sich das Mädchen mit Marcel Proust, rümpft die Nase über schnöde Äußerlichkeiten wie Klamotten oder Kosmetik und nistet sich fest ein in ihrer Nische als komplexbeladenes Mauerblümchen, dem jedoch niemand das intellektuelle Wasser reichen könne.
Um Mariannes Selbstfindungsschwierigkeiten in der Beziehung mit Sunnyboy Connell zu beschreiben, muss die Autorin intellektuell adäquat dick auftragen: »Wenn sie bei Connell anders war, fand dieses Anderssein nicht in ihr, in ihrem Personsein statt, sondern in der Dynamik zwischen ihnen.« Die geheime Romanze ist ungetrübt, bis Connell als Partnerin zum Abschlussball ein anderes Mädchen wählt. Gut nachvollziehbar, dass die zutiefst enttäuschte Marianne sich gedemütigt fühlt, in ihr Schneckenhaus zurückzieht, nicht mehr zur Schule geht, für Connell nicht mehr zu sprechen ist.
Auf dem altehrwürdigen, elitären Trinity-College in Dublin verkehren sich die Positionen ins Gegenteil. Dank eines Stipendiums für literarisches Schreiben bekommt Connell die Chance, dort zu studieren. Aber beeindrucken kann er hier niemanden mehr. Die anderen Studenten, meist Absolventen vornehmer Privatschulen, ignorieren oder verachten den armen Kommilitonen, der sich ein Zubrot an der Tankstelle verdienen muss. Für Marianne ist der Weg ins Elite-Institut dagegen voll normal, und es dauert nicht lange, bis sie sich unter den wohlhabenden Snobs aus der Upperclass einlebt, aufblüht und sich auch äußerlich anpasst: Sie stylt sich modisch (»ich kam ans College und wurde hübsch«) und amüsiert sich auf Partys mit reichlich Alkohol und Drogen. Connell wird kaum noch wahrgenommen (schließlich trägt er die falschen Klamotten) und fühlt sich nur als störender Fremdkörper, als »Volltrottel«. So begegnen sich die beiden wieder, jetzt aber in gewisser Weise mit vertauschten Rollen. Marianne ist mit einem dieser »extrovertierten … Campus-Promis« zusammen, und als Connell die Miete für sein Zimmer nicht mehr bezahlen kann, verlässt er den Campus und kehrt frustriert in sein Provinzkaff zurück. Mit der Liebe ist es aus.
All das ergäbe vielleicht einen ganz netten, unterhaltsamen Plot für eine Campus-Romanze. Aber die gefeierte Autorin profiliert ihre Helden noch etwas krasser. Marianne hegt ein sexuelles Bedürfnis nach Unterwerfung und Missbrauch (»ficken«, »würgen«, »mit einem Gürtel schlagen«), an dem nicht nur Connell verzweifelt, sondern auch Ihre Rezensentin, die derlei Masochismus eher als Abartigkeit denn als Normalität empfindet und auch nicht als ein Kriterium anspruchsvoller oder ansprechender Literatur werten mag. Auch Mariannes Mutter fehlt das Verständnis dafür, dass ihre Tochter Leute, die sie hassen, um Liebe anbettelt. Sie hält sie für eine unsympathische, frigide Persönlichkeit, der es an »Wärme« fehlt. Wir Leser werden in pathologisch-psychologische Abgründe geführt, die ziemlich platt aus dem familiären Hintergrund von Lieblosigkeit, Hass und Gewalt hergeleitet werden.
Wie viele Schriftsteller haben über die Jahrhunderte literarisch beeindruckende Werke über die Problematik einer Beziehung über die Kluft zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen hinweg verfasst und dabei ergreifende Entwicklungsverläufe von größter Dramatik und Tragik gestaltet! Wie Sally Rooney den reizvollen Topos in unser Millennium transponiert hat, enttäuscht allerdings zutiefst und macht sogar wütend – beispielsweise, wenn sie Studentinnen als Dummchen zeigt, die das College nur als Kontaktbörse interessiert: Sie suchen reiche ältere Männer, die »für Investmentbanken oder Wirtschaftsprüfungsagenturen arbeiten«, oder gleich einen »russischen Oligarchen« zwecks Heirat. Ist denn der Wunsch nach Emanzipation, auf eigenen Füßen zu stehen, nicht mehr aktuell? Oder habe ich Ironie und Kritik übersehen?
Obwohl immerhin Connell seinen Weg geht (er belegt einen Kurs für kreatives Schreiben und zieht nach New York), vermisse ich eine innere Entwicklung der jungen Leute. Statt zu vernünftigen Einsichten, zu einem kritischen, verantwortungsvollen Selbst- und Gesellschaftsbild zu reifen, bleibt ihr Dasein simplen Äußerlichkeiten verhaftet. Sally Rooney mag das in ihrer Heimat als »normale Menschen« erleben, aber ich kann mit ihrem Eindruck wenig anfangen.
Die Irin Sally Rooney (Jahrgang 1991) wird seit ihrem Debütroman »Conversations with Friends« (2017, in deutscher Übersetzung von Zoë Beck 2019 unter dem Titel »Gespräche mit Freunden« bei Luchterhand herausgegeben) als literarische Entdeckung gefeiert. Der Erstling stand auf der Longlist des Man Booker Prize und auf der Shortlist des International Dublin Literary Award und wurde in mehr als zehn Sprachen übersetzt. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an den Folgeroman »Normal People«, der 2018 erschien, Preise wie den Costa Book Award erhielt und zum Book of the Year gewählt wurde. Ich kann die Begeisterung leider nicht teilen, und nicht einmal die sprachliche Qualität des Romans kann mich überzeugen. Die Dialoge zwischen Marianne und Connell sollen verständnisvoll und innig zugewandt rüberkommen, doch sie wirken oft nur gestelzt und (ausgerechnet …) unnatürlich: »Okay, sagt sie, wir sind beide in Sachen ideologischer Reinheit gescheitert«.
 · Herkunft:
· Herkunft: