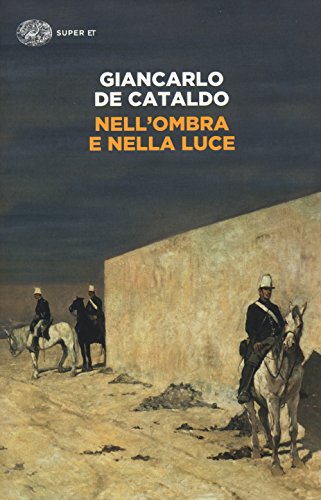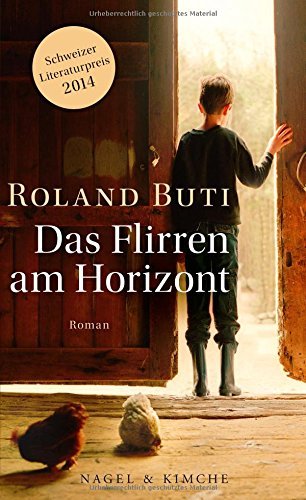
Der Niedergang der Almwirtschaft
Irgendwo in den Schweizer Bergen liegt der Bauernhof der Familie Sutter, den im Jahre 1976 ein herbes Schicksal ereilte. Er war nicht der einzige, denn in jenem Sommer lastete eine derart verheerende Hitze auf dem ganzen Land, dass offiziell der Notstand ausgerufen wurde.
Von einer familiären Katastrophe handelt Roland Butis Roman. Er stellt das absehbare und folgenreiche Verhängnis der Familie in den größeren Zusammenhang des wirtschaftlichen und kulturellen Niedergangs der Bergbauern nach dem Krieg und erzählt all das in einer unaufgeregten, ansprechenden Weise: amüsant, geistreich, pointiert. Dafür wurde »Le Milieu de l'horizon«  mit dem Schweizer Literaturpreis 2014 ausgezeichnet, und Marlies Ruß hat eine schöne Übersetzung ins Deutsche vorgelegt.
mit dem Schweizer Literaturpreis 2014 ausgezeichnet, und Marlies Ruß hat eine schöne Übersetzung ins Deutsche vorgelegt.
Großvater Annibal Sutter betrieb den Hof in der ›guten alten Zeit‹ – ›alt‹ ganz sicher, ›gut‹ nur in mancher Hinsicht. Großvater würde das niemals einschränken. Störrisch verteidigt er das Althergebrachte. Symbol für seinen eisernen Beharrungswillen ist seine einst bärenstarke Stute »Bagatelle«, die viele Jahre harter Arbeit auf den Berghängen mit ihm geteilt hat und jetzt stoisch ihren Tod zu erwarten scheint.
Irgendwann hat Großvater den Hof seinem Sohn Jean überlassen. Der gründet eine Familie mit Frau (die namenlos bleibt) und zwei Kindern, Léa und Auguste (»Gus«). Unter dem sanften Druck der sich wandelnden Zeiten ahnt er die merkantilen Notwendigkeiten, öffnet sich nach und nach ein wenig, soweit er muss, ist sogar stolz auf seine vermeintliche Modernität. Er investiert in eine teure Hühnermastanlage, einen fensterlosen Brutkasten mit automatischen Belüftungs- und Fütterungssystemen. Im Grunde hasst er »diese elenden Vögel«, sie sind nicht »seine Verbündeten, wie es seit je die Kühe auf der Weide oder im warmen, regelmäßig gesäuberten Stall waren, wie es unsere gepflegten und in Schuss gehaltenen Wiesen waren, wie es unsere ordentlichen Gersten- oder Maisfelder waren«. Die ungeliebte Hühnerzucht reicht nicht einmal, um den Hof langfristig am Leben zu halten.
Denn dann bricht der Sommer 1976 herein, in dem sich alles bündelt, »unser Leben entglitt und die Welt meiner Kindheit zu Ende ging«. Gus, der Ich-Erzähler, ist dreizehn Jahre alt. Stundenlang versinkt er in seinen Comic-Heften, deren Helden-Welten nie stillstehen und doch im entscheidenden Moment immer wieder einfrieren, bis in der Woche darauf die Fortsetzung erscheint. Ebenso gern verharrt er in der Beobachtung der Natur, die »immer dieselbe Landschaft blieb«; er hält sie in Zeichnungen fest.
Drum herum verändert sich die Welt indes unaufhaltsam. Die Autobahn und eine neue Kantonsstraße haben die Wege verkürzt und neue Arbeitsplätze gebracht, der Strukturwandel kündigt sich an. Am Dorfrand entsteht ein Villenviertel. »Ein Netz wob sich um unsere dörfliche Abgeschiedenheit, [aber Papa] wollte nicht, dass wir uns davon einwickeln ließen.«
Wie ein Katalysator fällt eines Tages Cécile, Mutters neue Freundin aus der Stadt, in dieses bedächtig fortschreitende Leben ein. Bunt wallende, fußlange Gewänder und betörende blumige Düfte erfüllen bald das ganze Haus und erwecken wie Céciles Entschiedenheit im Gespräch die verstörte Aufmerksamkeit aller. Nur Mama, zierlich und seit je von starken Allergien gegen Heu und Hühnerkot gequält, kann auf einmal frei atmen. Ihrem Sohn gesteht sie: »Cécile tut mir gut«; er werde ja jetzt »manche Dinge verstehen«. Aber Gus würde viel lieber noch ein kleiner Junge bleiben, als Erwachsenenprobleme zu begreifen. Dennoch zerbröckelt sein Lebensgefüge, denn »ich war Teil dieses zerbrechlichen Hauses«.
Papa kann schon »die positiven Schwingungen« kaum ertragen, doch zum Eklat kommt es, als Mama mit Céciles Rückendeckung ankündigt, eine Arbeit in der Stadt annehmen zu wollen. Am nächsten Abend sind beide Frauen für immer weg.
Noch fataler wirken sich Hitze und Dürre aus. Mensch, Tier und Pflanzen leiden. Wenn nicht bald die rettenden Militärlastwagen mit Wasser das abgeschiedene Dorf erreichen, ist der ganze Hof in Gefahr, der immer schon knappe Ernteertrag vernichtet, die Existenz der Familie ruiniert.
In ihrer glühenden Baracke eng zusammengepfercht, hocken die zehntausend Tiere förmlich aufeinander. Sie picken nicht, legen nicht zu, werden niemals die Mindestrendite bringen. Der Vater, Gus und Knecht Rudy tun ihr Möglichstes, den Hühnern Linderung zu verschaffen. Nur durch eine Desinfektionsschleuse und in Schutzkleidung darf man den »geheimnisvollen Planeten weit weg von unserem Sonnensystem« betreten, um aus dem Gewusel die verendeten Exemplare zu fischen, die von ihren Artgenossen in »kannibalischem Wahn« erledigt wurden. Als ein Ventilator ausfällt, die Hitze ins Unerträgliche steigt und die Vögel zu Dutzenden tot umfallen, reißt Papa die Wellblechplatten vom Dach.
Eine naheliegende Idee, aber ein dramatischer Fehler. Denn als der sehnsüchtig erwartete Regen endlich kommt – doppelte Ironie des Schicksals: kurz nach dem Eintreffen der Wassertankwagen und im Übermaß einer Sintflut –, findet er freien Zugang in die Hühnerhalle und bringt nicht nur dem verbliebenen Federvieh den Tod.
Roland Butis Roman überzeugt in vielerlei Hinsicht. Der sensible Erzähler Gus vermag die Wandlungen jenes Sommer – seine eigenen ebenso wie die seiner Familie und seiner Heimat – präzise zu fassen; gesellschaftliche und wirtschaftliche Theorien bleiben unaufdringlich im Hintergrund; leiser Humor schafft Distanz zum traurigen Geschehen; die sorgfältig gesetzte, alle Sinne adressierende Sprache ist ein Genuss; die Symbolik schöpft ihre Bilder aus unmittelbarer Nähe zum Gegenstand (eine flugunfähige Taube, die Gus in Pflege nimmt; die alte Stute, die »weder die Augen schließen noch sich zum Schlafen hinlegen [konnte], weil sie nicht mehr hochgekommen wäre«).
Viele Jahre nach dem Jahrhundertsommer kehren Léa und Gus zurück auf den Hof. Léa, vom Vater nie recht verstanden, obwohl sie doch schon als jugendliche Geigenvirtuosin für Aufsehen gesorgt hatte, ist ein Erfolgsmodell: Sie hat BWL studiert, geheiratet und zwei Kinder bekommen. Gus ist dagegen noch immer ihr kleiner »farbloser Bruder«, ein Junggeselle ohne Ambitionen. Dem Hof ist der Segen weiterhin versagt geblieben. Vater, der jetzt allein in einer kleinen Kammer lebt, wollte nach dem Hühnerdesaster nicht wahrhaben, dass traditionelle Landwirte wie er mit ein paar hundert Quadratmetern Ackerland keine Zukunft haben. Die Kosten sind höher, als der Verkauf von ein paar Litern Milch und ein paar Eiern einbringt. So steht das Anwesen jetzt zur Versteigerung. Der Vollstreckungsbeamte und Kaufinteressenten von nah und fern sind angereist und beäugen versteckt interessiert das museale Inventar. Papa, verbittert und nur noch ein Schatten seiner selbst, sitzt auf der Wiese unter einem schicksalsträchtigen Baum und schweigt, als werde er eins »mit den Überresten all der Männer und Frauen …, die von diesen ehemals fruchtbaren Böden genährt wurden«.
Ein ungewöhnliches Sujet, eine anrührende Geschichte, eine feine Sprache. Und doch bleibt eine Unschärfe: Was will uns der Autor denn sagen? Klar ist, dass Vaters Massentierhaltung das »jahrtausendealte Bündnis« von Respekt zwischen Mensch und Tier aufkündigt; die »rachitischen Körper« seiner Hennen sehen nicht einmal mehr aus, »als seien sie Teil der Natur«. Aber das »jahrtausendealte Bündnis« wieder herbeizuwünschen, wie das Abschlussbild evoziert, kann keine Alternative mehr sein. Im Übrigen ist der Hühnerfarm-Geschäftsplan wirtschaftlich vielleicht ganz richtig. Laut Butis Plot scheitert Vater Sutter nicht am Konzept, sondern er hat schlicht Pech, dass ihm die Hitzewelle das Fundament wegspült (ebenso wie Almbauern alten Stils); ohne sie hätte sein Unternehmen Erfolg haben können. Ist das Ganze also bloß ein Exempel für Gus’ fatalistische Erkenntnis, »dass der Platz, der uns zum Leben auf diesem Planeten zugewiesen war, das Ergebnis einer großen Lotterie sein musste, organisiert von einem Witzbold von Schöpfer«?
 · Herkunft:
· Herkunft: