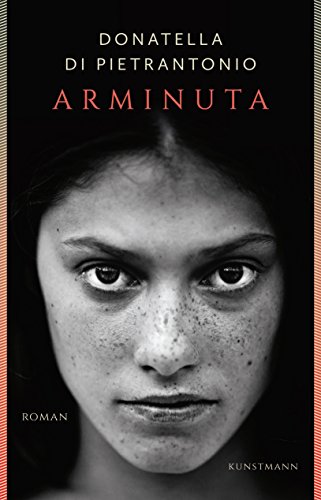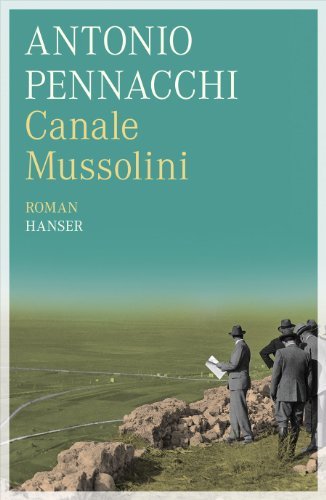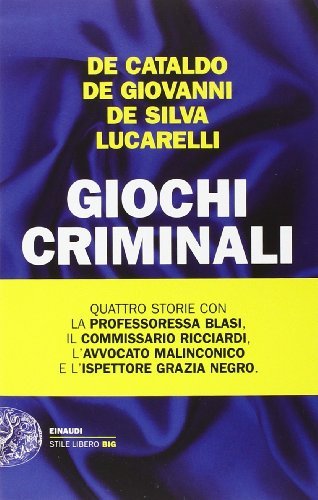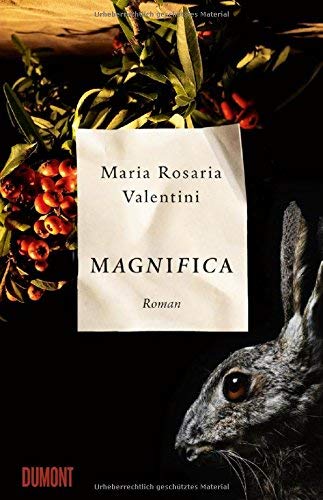Den Armen der Krake entkommen
Im Morast eines verdreckten Käfigs vegetiert eine junge Frau in Lumpen, um sie herum Hühner, Gänse, Kaninchen. Seit drei Jahren wird Flori schon festgehalten an diesem unwürdigen, tristen Ort fern der Zivilisation. Gigino und seine Frau, die beiden mitleidlosen Alten im Haus, müssten verhungern, bekämen sie nicht eine monatliche Zuwendung dafür, dass sie die Ukrainerin verwahren. Aber mehr als das Lebensnotwendige wollen sie ihr nicht lassen.
Mit einer grausamen List gelingt es Flori, aus ihrem Loch auszubrechen. Aber sie kommt nicht weit, da setzen die Wehen ein. Sie gebärt ein totes Kind.
Immerhin hat sie es geschafft, sich zum benachbarten Bauernhof durchzuschlagen. Das Gehöft, nicht minder armselig, gehört Agapito, den man »il sacerdote« nennt. Seit Langem versucht er, dem kargen Boden etwas Gemüse, Obst und Tabak abzuringen, aber seine Erde führt ihn an der Nase herum, macht ihm immer wieder Versprechungen und gibt ihm dann doch nichts ab als schmutzige, verdorrte, verfaulte Frucht. Sinnbild seiner verlorenen Hoffnungen ist der dürre Orangenbaum, »un albero maledetto«, unter dem Flori in der Nacht ihren toten Säugling verscharrt hat.
Unvermittelt finden wir uns auf dem Stuttgarter Bahnhofsgelände in den Sechziger Jahren. In der Ödnis rostiger Gleise und verlassener Güterwagen treffen sich nach der Arbeit in den Fabriken die Gastarbeiter aus dem Süden Italiens. Agapito ist einer von ihnen, und er kam voller guten Willens, um den Männern in seiner Freizeit geistlichen Beistand zu leisten. Er kennt seine Bibel einigermaßen, weiß in beeindruckenden Parabeln zu predigen und mit viel Verständnis die Beichte abzunehmen. Messgewand, Wein und geweihte Obclaten kann er nicht bieten; wenn er in seinem Hinterzimmer im Hemd die Kommunion erteilt, gibt es Wasser und vertrocknete Brotkrümel. Aber nicht nur seine Gastarbeiter-Freunde kommen gern und vertrauensvoll zu ihm, sondern auch Christina, eine Deutsche, die den armen Italienern Sympathien und abgelegte Kleidung bringt.
Ein richtiger Priester ist Agapito nicht, und er ist nicht einmal ein besonders guter Mensch. Den brutalen Taten seiner Kumpane Mariano und Vito sieht er mit Besorgnis zu, mahnt sie zu Zurückhaltung, aber er kann weder sie noch die verrohte Welt verbessern, in der Gewalt und Verbrechen Gedanken und Tun der einfachen Männer bestimmen, so dass sogar Christina zum Opfer wird und »il sacerdote« selbst Schuld auf sich lädt, an der er sein Leben lang tragen wird.
Alle drei Männer – Mariano, Vito und Agapito – stammen aus Monteroduni, einem abgelegenen Bergdorf in der Molise an der Grenze der Provinzen Isernia und Caserta (der Heimat des Autors). In jener bitterarmen, verlassenen Gegend am Oberlauf des Volturno ist das Überleben Glückssache. »Quello che non c'hai, prenditelo dagli altri«, lautet die rabiate Devise. Jede und jeder hier hat ein Kreuz zu tragen, aber Barmherzigkeit kann sich niemand leisten. Was also mag Agapito bewogen haben, nach seiner Rückkehr aus Deutschland Amalia zu heiraten, obwohl sie ihm schon vor seiner Abreise gestanden hatte, dass sie keine Kinder bekommen könne?
Das Schicksal spielt oft geradezu zynisch mit den Menschen. Amalia etwa schaut dem Tod ins Auge, denn trotz reinster Bergluft hat ein Tumor ihre Lungen zerstört. Und Maurizio, Marianos zurückgebliebener Sohn, schleppt tagaus, tagein ein Kreuz bis zum Ortsschild und zurück, eine selbst auferlegte ewige Sühneverpflichtung zwischen Realität und Wahn.
In diese bedrückenden Szenerien, die mehr als tausend Kilometer und ein halbes Jahrhundert auseinander liegen, drängt Paolo Piccirillo den Leser quasi simultan hinein. Sein Roman beginnt nämlich mit einer rasant-verwirrenden Abfolge kurzer Szenen: der Stall, eine Beichte, ein Raub, die Flucht, eine Vergewaltigung, die Geburt auf offenem Feld, blutige ländliche Gepflogenheiten (man tötet Tiere mit bloßen Händen), immer wieder die feindliche Urnatur, Düsternis, Kälte, Moder, Sumpf ... ein Retro-Fantasy-Thriller? Als dann der Landmann sein iPhone zückt, ändert sich die Lesererwartung: vielleicht eine postzivilisatorische Dystopie? Aber nein: Der Autor verquirlt nur effektvoll die Ebenen von Realität, Traum, Erinnerung, Vergangenheit und Gegenwart; am Ende steht die pure, harte Realität, in der sich all die unterschiedlichen Handlungslinien ineinander verstricken.
Aus Stuttgart nach Monteroduni zurückgekehrt, bearbeitet Agapito ernüchtert, verhärtet und unnachgiebig sein Landstück, das ihm niemals sicher zuzugehören scheint. Ständig muss er es gegen Hitze und Kälte, Trockenheit und Regenstürze, gierige Tiere und Menschen verteidigen. Vor allem aber wird er über Flori eingesogen in die Machenschaften einer anonymen, übermächtigen Krake, die sich von Menschenhandel und Versklavung der übelsten Sorte nährt. Hat ihr Kopf, der feiste und humpelnde alte Graziano, erst einmal seinen Fuß auf das Land gesetzt, scheint jeder Widerstand zwecklos. Ein paar Worte oder Gesten genügen, um vernichtende Konsequenzen anzudeuten, und bald tummeln sich auf dem Gelände wortkarge rumänische und italienische Aufpasser, damit das Geschäft mit den Frauen reibungslos läuft.
Die Zeche bezahlen nicht nur die Schwächsten (wie Flori und ihre wehrlosen Leidensgenossinnen oder Nachbar Gigino, dessen bloße Existenz von Grazianos Anweisungen abhängt), sondern auch Grazianos Verwandter und rechte Hand Armando – der einzige, der das Zeug zu einer positiven Gegenfigur mitbringt. Der studierte Jurist ist gebildet und denkt unabhängig, er hat Überblick und Pläne, würde lieber heute als morgen sein Glück als ehrenwerter Anwalt in Milano suchen, als seinem plumpen Onkel juristische Finessen zu erläutern. Nicht einmal er schafft es, sich aus dem Sumpf zu befreien. Zwar wandelt sich »la terra del sacerdote« unter Agapitos unermüdlicher Fürsorge, und auch er selbst beschreitet unerwartete Wege, doch der letzte Satz des Romans lautet »Il mondo è rimasto uguale« ...
Ganz im Einklang mit der entrückt erscheinenden Atmosphäre seiner Szenen fernab unserer vertrauten Zivilisation kultiviert der newcomer Paolo Piccirillo (*1987) in seinem zweiten Roman (nach »Zoo col semaforo«, 2010) neben am Film orientierten Schnitttechniken eine Tendenz zu leicht archaisierendem, sentenzenhaftem Stil (»Il sorriso di Agapito è quello sereno che hanno le persone quando prendono per mano il prossimo. E il prossimo neanche se ne accorge.«). Die dichte Bildlichkeit aus dem Bereich der Pflanzen (l'albero maledetto, i radici), der Erde (in allen Bedeutungen der Vokabel terra) und der Religion (il sacerdote, confessarsi, portare la croce) erzeugt einen nachhaltigen Eindruck. Manche Symbolik kommt freilich recht handfest daher (il deserto del fiume scomparso, ein Fluss des Todes), und bisweilen trägt der Autor schlicht zu dick auf (etwa in der Episode, die Marianos soprannome »Baffi di Cane« erklärt). Am Ende dürfen grandi emozioni nicht fehlen: Es fließen lacrime ...
Nicht verheimlicht werden soll, dass ganze Dialoge im Dialekt der Molise erklingen. Der ist zugegebenermaßen schwer zu entziffern (siehe annotierte Kostprobe weiter unten), wenn man das denn wollte oder müsste. Stattdessen sollten wir zügig drüber hinweghören, denn man ahnt schon, was gemeint ist, und Piccirillos Landsleuten bleibt auch nichts anderes übrig, als Mut zur Lücke aufzubringen. Zum Trost gibt es im Gegenzug Dialoge komplett in Deutsch, mit denen der italienische Leser ebenfalls übersetzungslos fertigwerden muss.
Fazit: Dieser packende Roman um Schuld und Sühne, zwischen Thriller und Real-Dystopie, bringt eine faszinierende, ungewöhnliche und vielschichtige Leseerfahrung, die von diesem jungen Autor noch mehr Großes erhoffen lässt. Im komplizierten Auswahlverfahren zum Premio Strega 2014 hat »La terra del sacerdote« es völlig zurecht schon bis unter die letzten zwölf Kandidaten geschafft. (Der Sieger wird am 3. Juli bekanntgegeben.) (Übrigens: Ein weiterer hoffnungsvoller junger Autor aus Süditalien, ebenfalls bei Neri Pozza verlegt, ist Francesco Formaggi, 1980 in der Provinz Frosinone geboren. Lesen Sie hier meine Rezension zu seinem Debütroman »Il casale«.)
Zum Abschluss ein Tipp: Lesen Sie am Ende noch einmal die ersten zehn, zwanzig Seiten – im Rückblick erkennen wir umso klarer, wie geschickt der Autor uns geführt hat. Details erscheinen nun in klarerem Licht als beim ersten Durchgang – und wir haben Molisisch zu verstehen gelernt:
»›Gigi', sbegliat'. Gigi', oh, sbegliat'.‹
Gigino con gli occhi pieni di sonno vede la moglie già vestita, che si massaggia il braccio sinistro.
›Se ne è andata, eh?‹
La moglie sgrana gli occhi: ›E come lo sai?‹
›M' l' so' sunnat', porco Iddio.‹«
 · Herkunft:
· Herkunft: