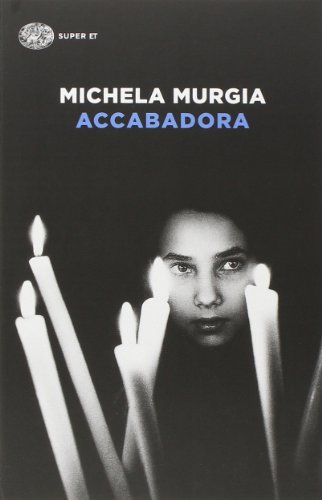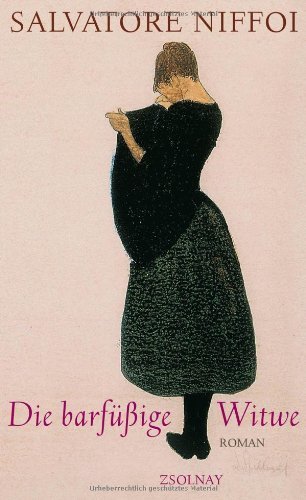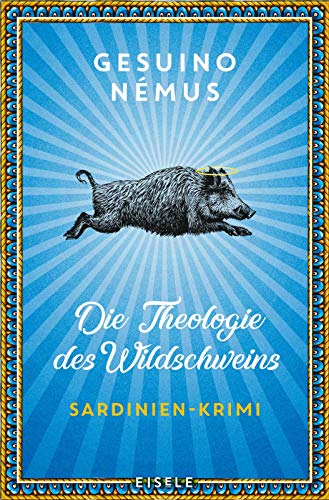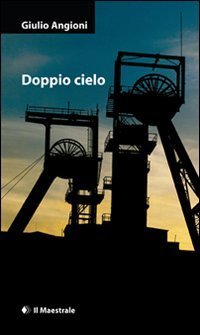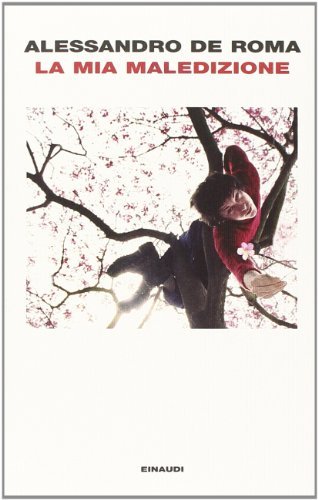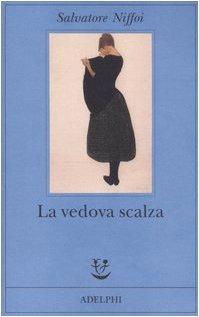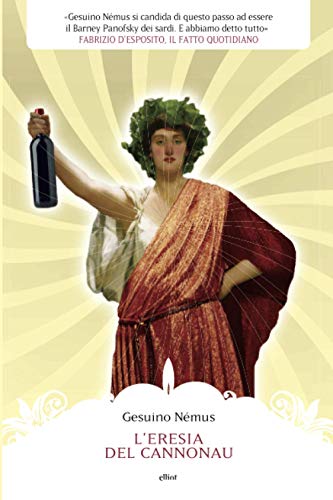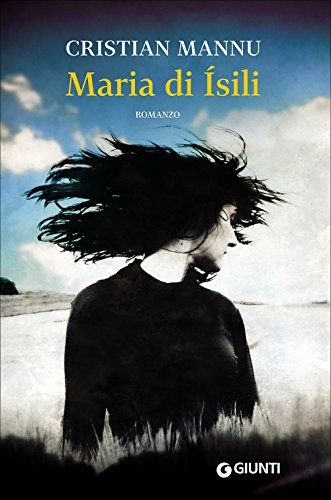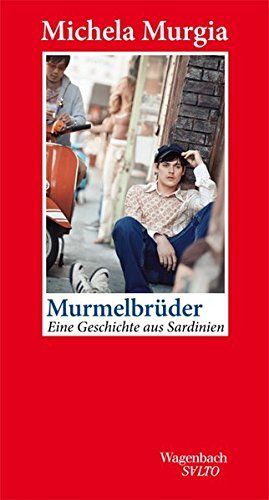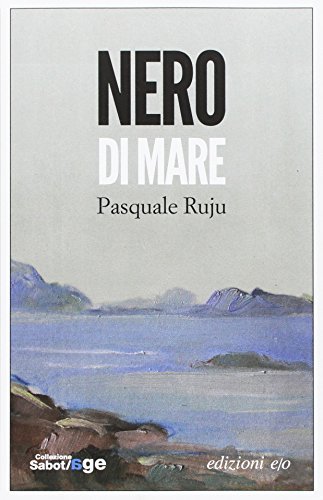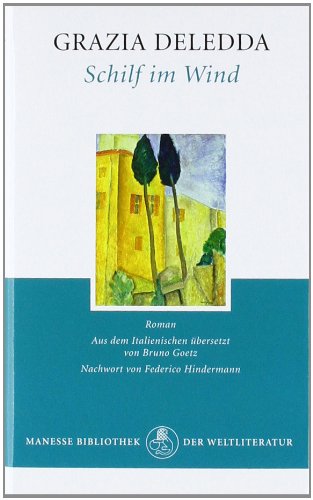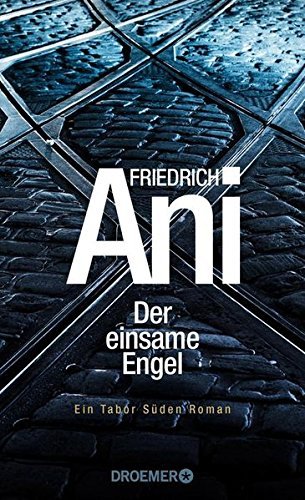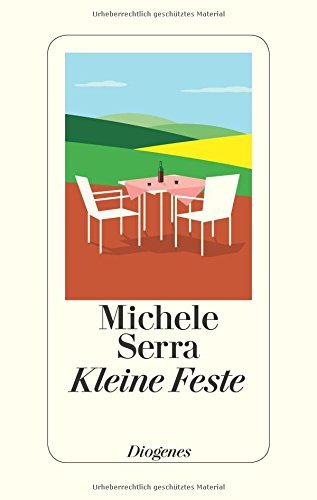Die Moderne vor den Toren
Im Januar 1793 nähert sich eine Flotte französischer Kriegsschiffe der sardischen Hauptstadt Cagliari und geht außerhalb des Hafens abwartend vor Anker. Was den Cagliaresi jetzt droht, ist allen klar: Belagerung, Beschuss (bombardamento), Eroberung, eine neue Herrschaft.
So ein Ereignis war für die Sarden nichts Neues. Seit vielen Jahrhunderten kamen Schiffe aus allen Himmelsrichtungen übers Meer. Etwas Gutes brachten sie den Einwohnern nie, sondern nur eine Fortsetzung des Bestehenden: Verdruss, Leid und Unterjochung. An dem Wenigen, das auf der Insel zu holen war (Salz, Mineralien, Metalle, Kohle), bedienten sich die Eroberer gern, aber ihr Interesse trug nicht so weit, dass sie sich um die Verbesserung der uralten strukturellen und kulturellen Gegebenheiten bemüht hätten.
Nach Jahrhunderten unter spanischer Herrschaft wurde die Insel Anfang des achtzehnten Jahrhunderts zum Tauschobjekt. 1714 trat Spanien sie an die Österreicher ab, die reichten sie 1720 an den Herzog von Savoyen weiter und erhielten dafür Sizilien. Interessant an diesem Geschäft war für die Savoyer einzig und allein, dass es sie zu Königen eines unabhängigen Königreiches beförderte. Deshalb benannten sie ihr Reich nun zwar um in »Königreich Sardinien« (oder auch »Königreich Sardinien-Piemont«), residierten aber weiterhin in ihrer Hauptstadt Turin und kümmerten sich in erster Linie um ihre Stammlande auf dem Festland. (Ein Jahrhundert später würden sie eine entscheidende Rolle im italienischen Einigungsprozess übernehmen, 1861 die alten italienischen Staaten in das »Königreich Sardinien« eingliedern und das neue Gebilde »Königreich Italien« taufen.)
Keiner der sardischen Könige ließ sich auf der Insel nieder. Man installierte lediglich einen Vizekönig – zur Zeit der französischen Belagerung der einäugige Viceré Balbiano – mit ein paar einheimischen Verwaltungsbeamten und einer kleinen Dragonertruppe.
Was tun angesichts der neuen Bedrohung draußen vor den Hafenmolen? Aus Jahrhunderten schlechter Erfahrungen haben die Sarden Unterschiedliches gelernt. Seit Urzeiten bestand für die Bevölkerung eine grundsätzliche Lehre darin, sich in die unwegsamen Bergregionen zurückzuziehen, wohin vorzudringen die Feinde keine Lust verspürten. Angesichts einer konkreten Gefahr wie der französischen Flotte setzen die einen auf entschlossenen Widerstand mit den bescheidenen Mitteln einheimischer Milizionäre, die rasch aus der Umgebung zusammengerufen werden können. Die anderen halten es für klüger, sich einer Übermacht einfach zu ergeben und sich in die neuen Herrschaftsverhältnisse zu fügen, wo diese ja doch nur nominelle Veränderungen zu zeitigen pflegten. Diese Taktik hat schon ein paar Mal größeres Leid erspart (»Un po' di cannonate, un po' di scoppi e alla porta del molo avevano sventolato un grande telo bianco ...Poi, dieci anni dopo, ... il governatore inglese era scappato protetto da una bandiera bianca. L'unica bandiera della città ...«).
In Toddes literarischer Darstellung jener Belagerung werden die Details der gut belegten politisch-historischen Ereignisse nicht ausgeführt. Er beschreibt vielmehr aus mehreren Perspektiven, wie maßgebliche Einzelpersonen auf die Ankömmlinge und ihre noch nicht ganz klaren Absichten reagieren. Dabei ist Modernität der Leitbegriff, unter dem die Auseinandersetzungen betrachtet werden. Drei Jahre zuvor hatte die französische Revolution europaweit eine neue Zeit eingeläutet, und überall hatten die alten Adelsgeschlechter berechtigte Angst, dass ihre Herrschaft bald vorüber sein und es leicht auch ihnen persönlich an den Kragen gehen könnte. Die Schiffe der revolutionären Flotte signalisierten Cagliari, dass »il mondo è arrivato anche qua«, und so lautet die abstraktere Frage, ob man sich davor verschließt und weiterhin seine Rückständigkeit verteidigt (»Proteggervi dal mondo ...«) oder sich ihr öffnet.
Sind die Franzosen überhaupt Feinde? Der Vizekönig Balbiano weiß natürlich um »la rivoluzione, la ghigliottina e le teste che rotolano nel cestino«, aber er spielt die Gefahr herunter. Waren Franzosen und Savoyer nicht bis vor kurzem befreundet? Wird nicht im ganzen Königreich Sardinien französisch konversiert, gelesen, geschneidert, kuriert, gekocht und Landwirtschaft betrieben? In seinen Augen sind die Sarden selbst ihre (und seine) größten Feinde: »Unirsi, coalizzarsi, confederarsi? Mai! L'inimicizia è la loro natura, gli dà l'energia e perfino il pane. Si innamorano per inimicizia. Mettono su famiglia e lavorano sostenuti dall'inimicizia.«
Für viele patriotische Sarden wie den gefürchteten und einflussreichen Anwalt cavalier Girolamo Pitzolo ist Balbiano nichts als ein Verräter (»Una maledizione per il Viceré Balbiano!«). Er propagiert eine wehrhafte Verteidigung: »Solo i nostri miliziani abbiamo, solo di loro ci possiamo fidare.« Um die Stimmung im Volk zu manipulieren, fädelt er indes noch ganz andere Maßnahmen ein.
Dem geschickten Diplomaten Valsecchi, Segretario di Stato, obliegt es, zwischen dem Viceré und seinen Untertanen zu vermitteln. Er trägt ihm zu, was gli Stamenti, das uralte Parlament, das erstmals seit einhundert Jahren wieder einberufen wurde, erörtert haben. Vertreten durch den Arzt Jorge Rajon finden dort selbst die armen Bewohner der bassi Gehör.
Protasio Calebaza, conte di Fraus, hat in erster Linie das Wohl seiner vier ältlichen Schwestern im Auge und will sie auf den Landgütern der Familie in Sicherheit bringen. Dafne, Clio, Ifigenia und Penelope, unverheiratet geblieben, aber mitnichten ohne Kenntnis der Leidenschaft, denken jedoch nicht daran, die Annehmlichkeiten der Hauptstadt für »pane con lardo« aufzugeben. Lieber wollen sie den Gefahren ins Auge sehen.
Die interessanteste Figur ist giudice Giovanni Angioy, ein aufgeklärter, aufgeschlossener, vorurteilsloser Rationalist, dessen notorische skeptische Widerspenstigkeit ihm den Beinamen »l'uomo dei no, no, no« eingebracht hat. Seine Weitsicht dokumentiert sich nicht zuletzt in seinen wirtschaftlichen Aktivitäten: Seine Familie handelt erfolgreich mit Baumwolle und Indigo. Was die Franzosen betrifft, stellt er der allgemein vorherrschenden konservativen Auffassung, sie seien primitive, derbe Umstürzler (»Rivoltosi, ribelli sono!«), entgegen, dass sie »rivoluzionari« seien, Boten einer neuen Zeit, Bringer der Moderne. Angioy wählt für sich einen unkonventionellen, durchaus nicht unumstrittenen Weg. Was objektiv Verrat ist, ist in seinen Augen ein Akt der Befreiung, der Öffnung seines verkrusteten, abgelegenen Inselreichs, um dessen Wohlergehen sich nicht einmal seine eigene Herrschaft kümmert.
Auf der anderen Seite des Wassers späht Admiral Laurent Truguet durch sein Fernrohr auf die Bastionen der Stadt, die er beschießen und einnehmen soll. Im Herbst haben die Gebrüder Joseph und Claude Niépce bei ihm angeheuert. Die beiden jungen Zeichner und Maler aus dem Norden Frankreichs haben ihre geruhsame ländliche Heimat verlassen, um der Sache der »flotta rivoluzionaria« als Berichterstatter zu dienen. Joseph Niépce (eine reale historische Persönlichkeit wie mehrere andere der Romanfiguren) ist ein weiterer Symbolträger der Moderne, denn er experimentiert mit allerlei Chemikalien, um flüchtige optische Eindrücke zu verewigen. Wenn er fünf Jahre nach seiner militärischen Mission als Privatmann nach Cagliari zurückkehrt, wird er große Fortschritte in der jungen Kunst der Fotografie gemacht haben.
Die Abstraktion, unter der Todde die Ereignisse von 1793 betrachtet, als ›das Neue‹ und sehr alte Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen in exemplarischer Weise aufeinandertreffen, wird durch eine Reihe von Nebenhandlungen erweitert und ergänzt, in denen auch Frauen eine Rolle spielen, wie Galatea Ruju, Geliebte von Girolamo Pitzolo und – für eine einzige Nacht – von Joseph Niépce, oder die sechzehnjährige Dienstmagd Bonacatta Murellu, die als Sündenbock zum bedauernswerten Opfer einer üblen Intrige wird. In den zwischenmenschlichen Beziehungen findet der Roman seine Erdung, sie verleihen ihm Farbe und Herz – aber nur in bescheidenem Maße Wärme.
Toddes Darstellungsweise ist eigenwillig und reizvoll. Selbst die militärischen Strategien und kriegerischen Auseinandersetzungen werden nicht einfach dialogisch entwickelt, sachlich referiert oder spannungsgeladen erzählt, sondern vielfach poetisch verkleidet.
Giorgio Todde – im Brotberuf Augenarzt – ist kein Fabulierer der konventionellen unterhaltsamen Art. Sein Stil ist knapp, auf den Punkt formuliert. Oft genügen ihm Andeutungen. In diesem trocken anmutenden Rahmen aber gelingen ihm poetische Glanzstücke der Bildlichkeit. Das Gesamtkonzept aus Symbolismen (Leben und Tod, Modernität und Rückständigkeit) und Poetik ist konsequent durchkonstruiert. Ein schönes Beispiel ist der parabolische Flug einer schweren Geschosskugel, deren vorausberechnete Bahn bis in die höchsten Spitzen der steil aufragenden Stadt Cagliari reicht und dort entscheidende Schäden verursacht.
 · Herkunft:
· Herkunft: