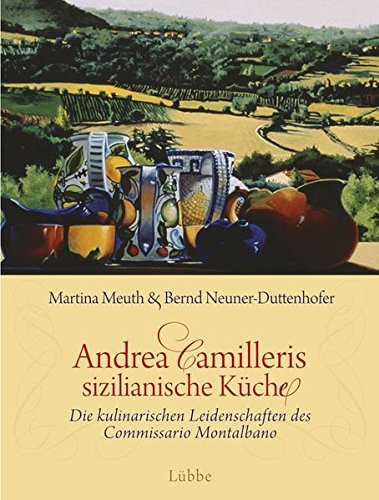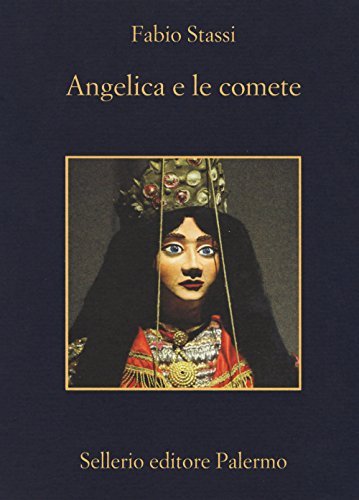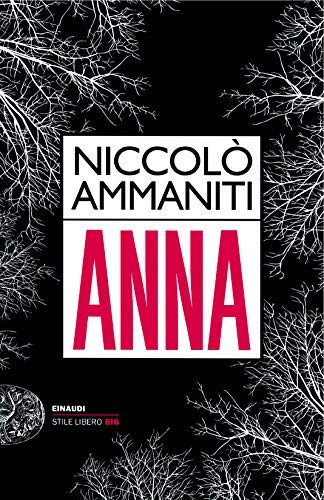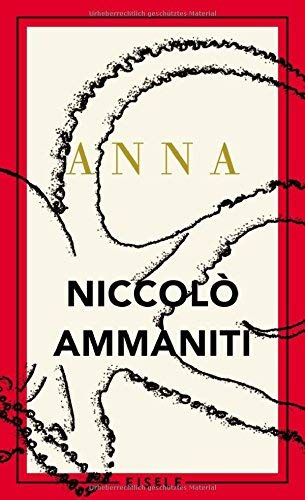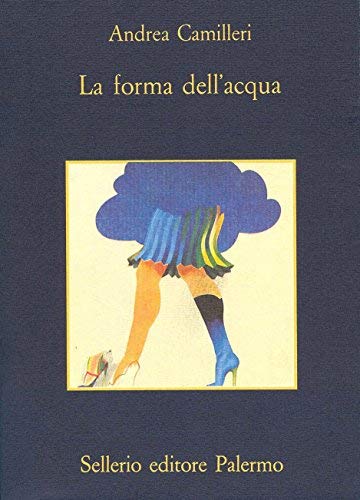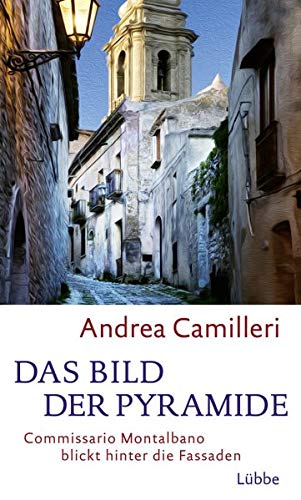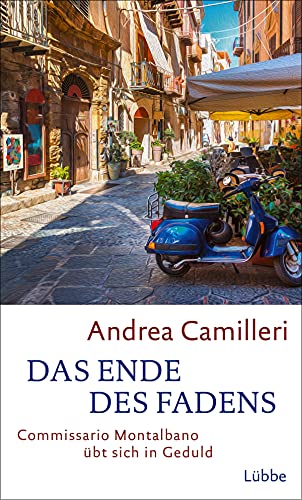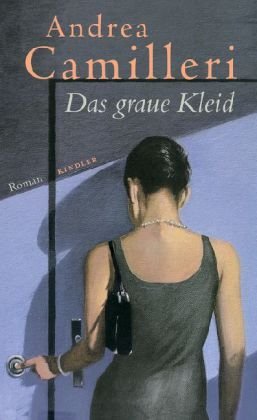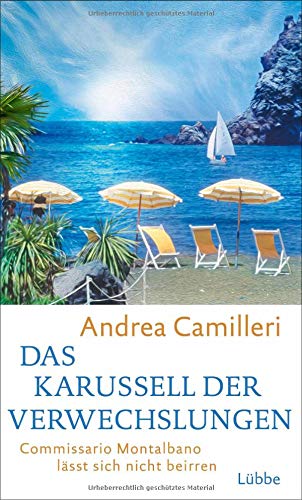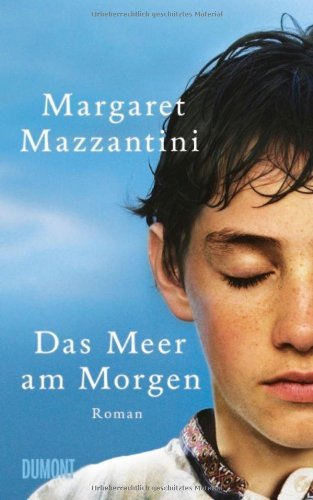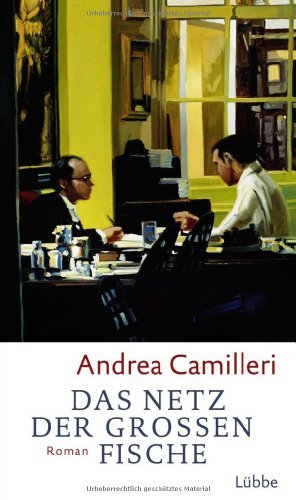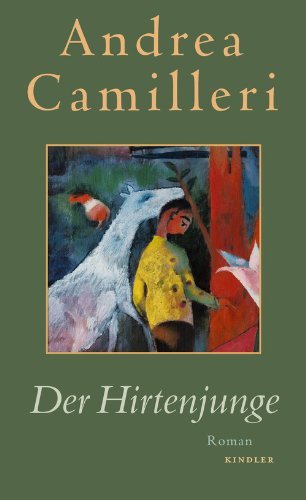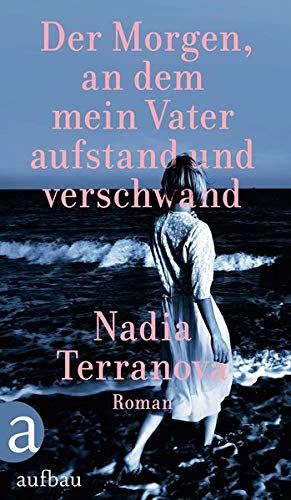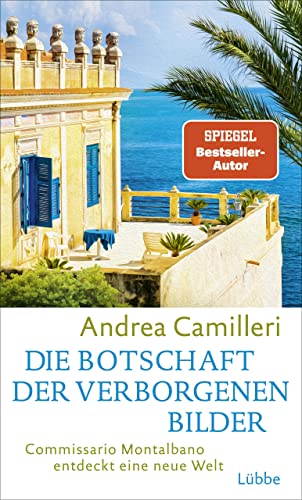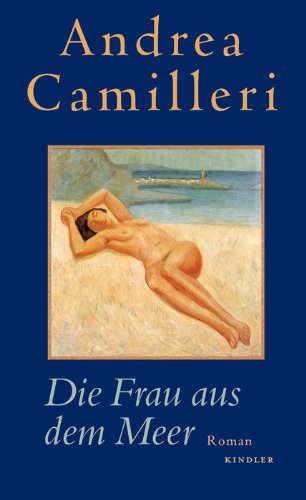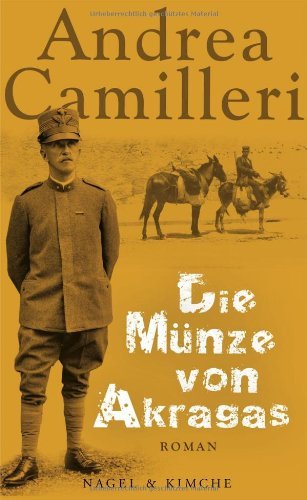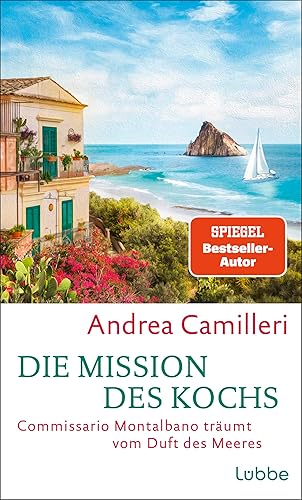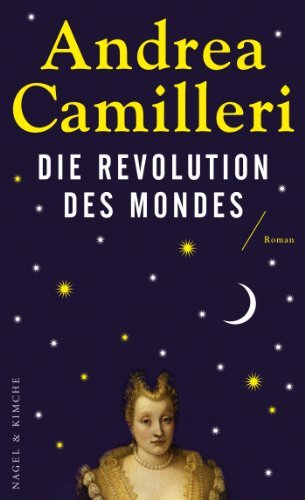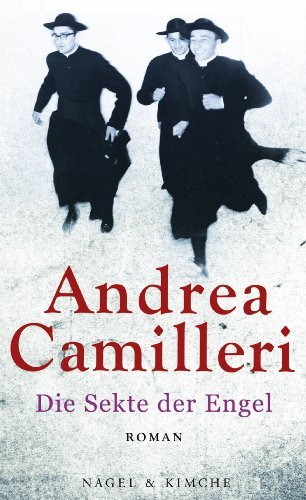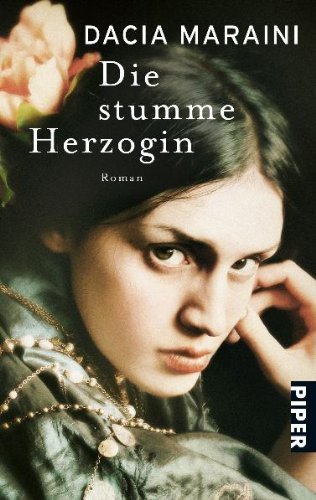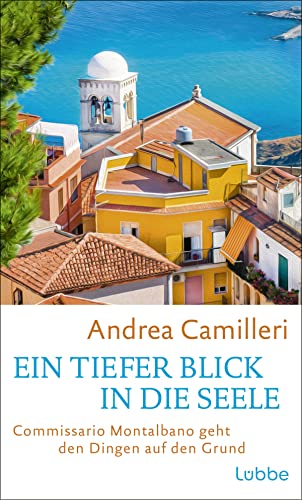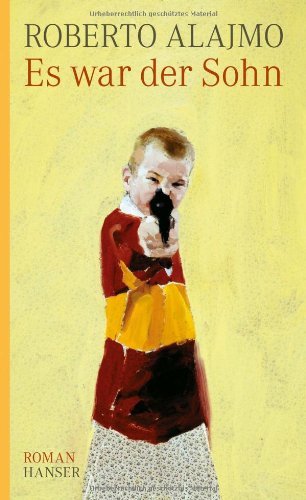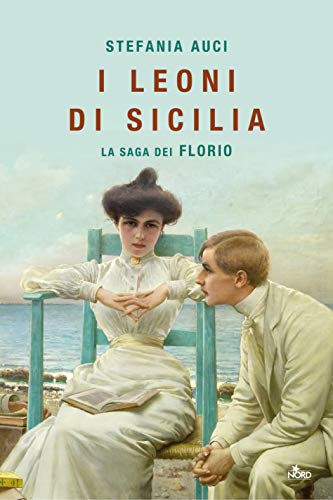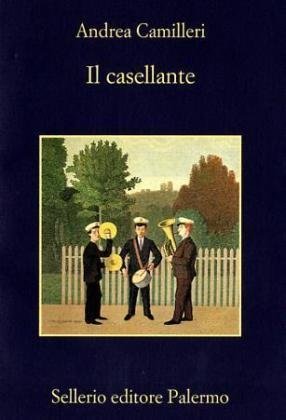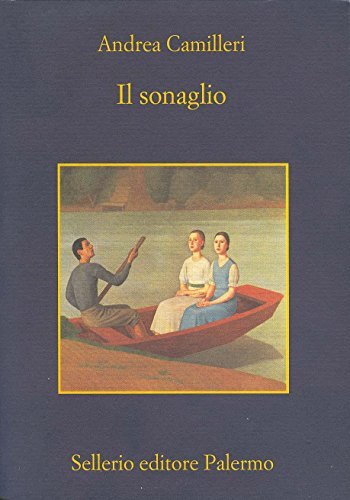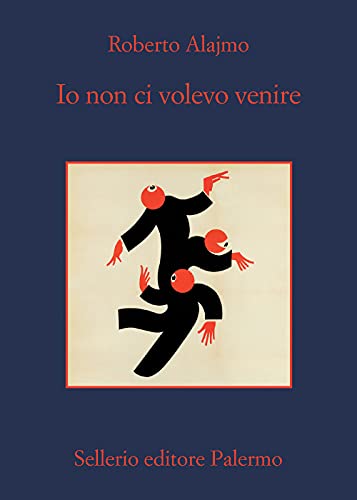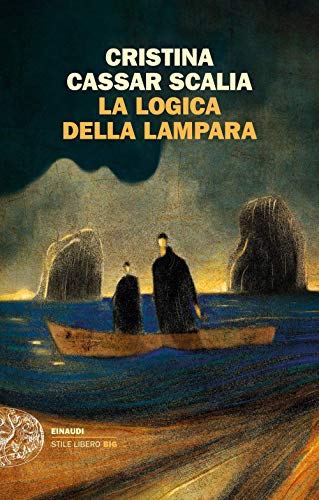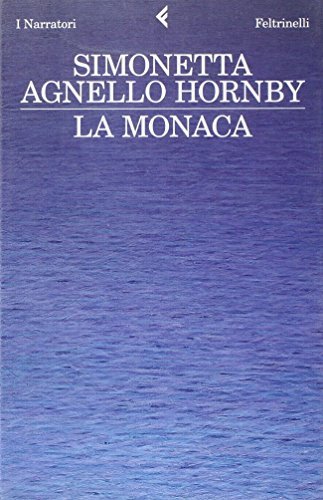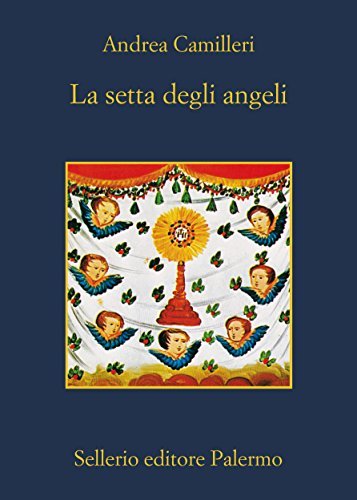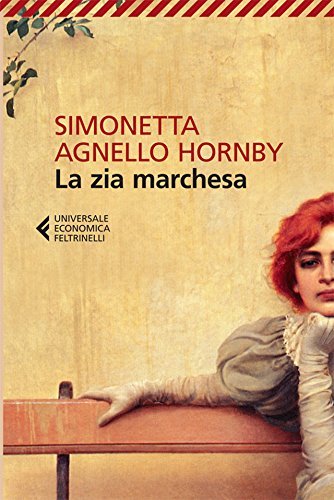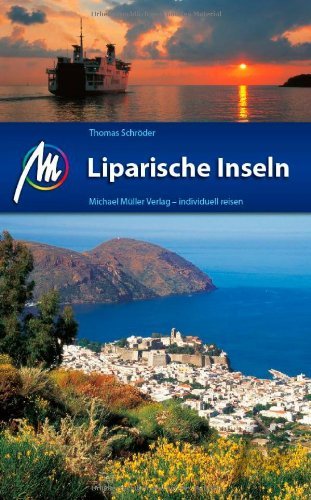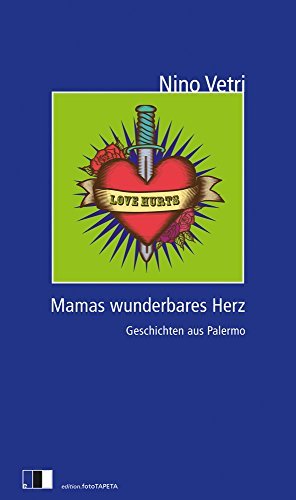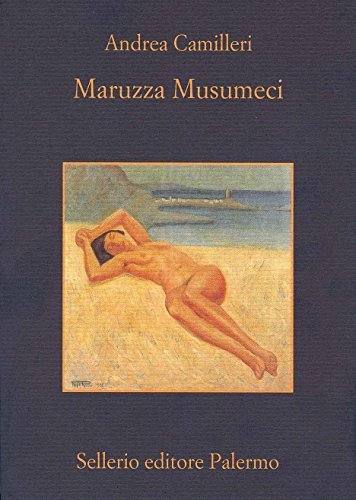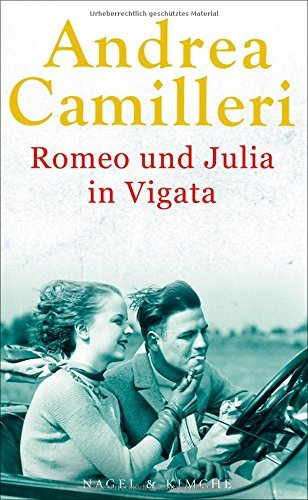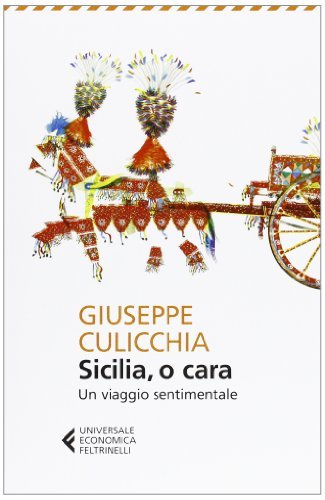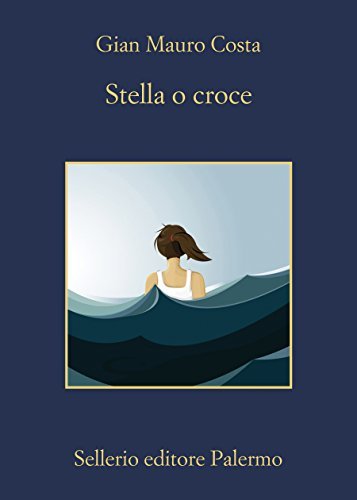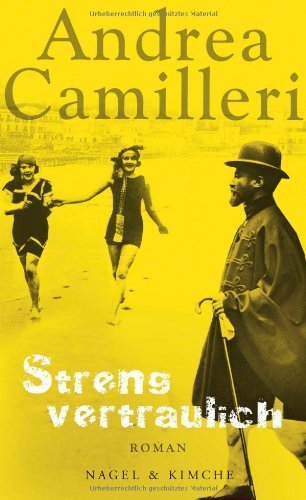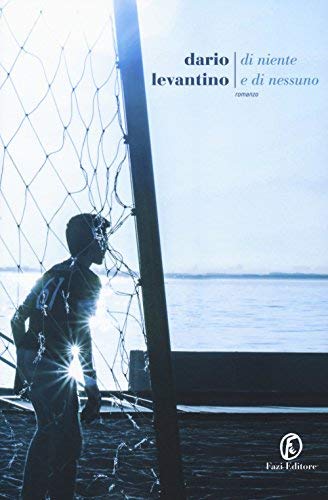
Di niente e di nessuno
von Dario Levantino
Ein Fünfzehnjähriger aus einem verwahrlosten Stadtteil von Palermo schlägt sich durch die widrigen Umstände seiner Herkunft. Weder die Furchtlosigkeit antiker Helden (seiner Vorbilder) noch der Beistand des vorzeitig verstorbenen Großvaters noch sein Torwart-Talent noch die erste Liebe können ihm schmerzliche Erfahrungen ersparen.
Falsch geboren
Rosario Altieri ist ein Rohprodukt seiner Herkunft und Umgebung. Mehrere Seelen schlagen in der Brust des fünfzehnjährigen Ich-Erzählers und liegen teilweise im Streit miteinander. Er wächst in Brancaccio auf, einem trostlosen Vorort im Südosten von Palermo, wo Armut, Verrohung und Gewalt herrschen. Auf Wunsch seines Vaters besucht er aber ein gutes Gymnasium im feinen Zentrum. Freunde hat er weder hier noch da. Bei den einen hat ein Dialektsprecher aus einem berüchtigten Viertel einfach keine Chance, als könne die Verwahrlosung seines Herkunftsortes sie anstecken. Bei den anderen kann er nicht heimisch werden, weil er deren Gehabe und Interessen nicht teilt und nicht für voll genommen wird.
Dabei ist Rosario alles andere als ein Duckmäuser. Seine Vorbilder sind die Helden antiker Sagen, die sich vor nichts und niemandem fürchteten (daher der Titel des Romans: »Iu un mi scantu di nenti e di nuddu.«). Unter diesem Motto scheut er keine Auseinandersetzung, provoziert tollkühn, steckt, ohne mit der Wimper zu zucken, entsetzliche Erlebnisse weg und heftige Prügel ein und beklagt sich niemals. Die frühreife Mannhaftigkeit befähigt ihn, in seiner Umgebung als Einzelgänger zu bestehen, sich den Brüchen seiner Existenz und den schwelenden Problemen seiner Familie zu stellen.
Rosarios engste Bezugsperson ist seine Mutter Maria, eine stille, zurückhaltende Frau, die ganz für ihren kleinen Haushalt und ihre Familie lebt. Insbesondere hegt sie das Andenken an ihren Vater, der drei Monate nach ihrer Geburt beim Erdbeben von Belice (1968) verschüttet wurde. Da hatte er gerade bei einem Provinzturnier als Torhütertalent Aufsehen erregt und einen Pokal erhalten. Den betrachtet und poliert Maria, als wäre er ein Sinnbild entgangenen Glücks. Als sie selbst einen Jungen gebar, bestand sie darauf, dass das Kind den Namen des Großvaters trage, so wie es in Palermo Sitte ist.
Rosarios Vater Roberto dagegen wollte einen eleganteren Namen, der besser mit dem Wohlklang seines Familiennamens zusammengeht: Jonathan Altieri – so einen souveränen, weltläufigen Sohn hätte er sich gewünscht, nicht einen altmodischen Rosario, den alle »Rosà« oder »Saruzzu« rufen. Das Gefühl, ein Sohn zweiter Klasse zu sein, bedrückt den Jungen, und seine Einstellung zum Vater schwankt zwischen Verachtung und vorsichtiger Neugier.
Denn Roberto ist eine undurchsichtige Figur, einer, der keine Nähe aufkommen lässt, sein eigenes Spiel spielt. Er betreibt in der Altstadt einen gut gehenden Laden für Sportler-Zusatznahrung, und dank seiner Vernetzung in entsprechenden Kreisen und der lokalen Politik brummt auch das Hinterzimmer-Geschäft mit illegalen Substanzen. Für die Familie bleibt weder Zeit noch Interesse. Nur einmal schenkt er seinem Sohn halb jovial, halb prahlerisch ein wenig Einblick in seine Aktivitäten (»Questa cosa la sappiamo soltanto tu e io.«) und seine schlichte Weltsicht (»Non ci sono regole nella vita … se tu vuoi riuscire, devi pensare solo a te.«). Seine Frau ignoriert oder tyrannisiert er. Als der einzige Traum, der ihr selbst insgeheim am Herzen liegt, greifbar wird, wischt er ihn brüsk vom Tisch.
Die kontroversen Eckpfeiler seines Lebens kann der Junge nicht überbrücken. Er liest viel (Heldensagen, Dickens, Pirandello), identifiziert sich mit starken Beschützerfiguren, schreibt Gedichte, nimmt stundenlanges Busfahren auf sich, um sein liceo scientifico zu besuchen. Sprache und Bildung geben ihm einen Boden unter den Füßen, aber keine konkrete Hilfe, wo niemand sie mit ihm teilt. Nicht nur aus Trotz hält er am Dialekt fest: Die Helden, so sagt er, müssen Palermitanisch gesprochen haben, und nur in dieser Sprache kann er von ihnen erzählen.
Sein Gefühlsleben ist zersplittert und aufgewühlt. Zum Hass gegen den Vater (dessen schmutzigen Geheimnissen er nach und nach auf die Spur kommt) und zur unverbrüchlichen Fürsorge für die Mutter (die immer schwächer wird) treten zarte Liebesgefühle für Anna (eine ebenso unangepasste Gleichaltrige) und eine zwischen Verachtung, Mitleid, Hass, Wertschätzung und Solidarität oszillierende Partnerschaft mit einem Straßenköter.
Einen entscheidenden Schritt tut Rosario, als er in der lokalen Fußballmannschaft (»Virtus Brancaccio«) als Torwart einspringt. Beflügelt von den Einflüsterungen des glorifizierten Opas entdeckt er ein geradezu magisches Talent, das auch Trainer und Rivalen auffällt. Sein Leben kompliziert sich dadurch erheblich. Er wird Erster Torwart der Mannschaft und findet neue Anerkennung, andererseits machen ihm Platzhirsche und Team-Bullies daraufhin das Leben zur Hölle, schlagen ihn kurz und klein und erpressen ihn brutal. Doch immer wieder ermutigt ihn die Stimme des Großvaters und er sich selbst: Un ti scantari di nenti e di nuddu.. Am Ende geht er gestärkt aus diversen Fegefeuern hervor und kann sich den existentiellen Problemen stellen, die die ganze Familie seit jeher bedrohen.
Beeindruckt haben mich an Dario Levantinos Debütroman nicht nur seine frische, unprätentiöse Sprache und die überzeugende Gestaltung markanter Charaktere, sondern insbesondere auch des Schauplatzes. Der Autor (von Beruf Gymnasiallehrer) wurde 1986 selbst in Palermo geboren und hat dort Literaturwissenschaft und Philosophie studiert. Er beschreibt seine Stadt als Ansammlung unterschiedlichster rioni (»Viertel«), die das Wesen ihrer Bewohner prägen bis zu ihrem Äußeren: »Non era solo una questione di benessere, di abito, di accento fine: era qualcosa di percepibile dagli occhi. In quello di una donna del centro si leggeva l’affrancamento, in quello di una donna di periferia, invece, si scorgeva una paura antica, un giogo esistenziale.« Brancaccio muss eine besonders berüchtigte Gegend sein, »un aborto urbano, un non luogo«. Rosario streunt dort ›der Nase nach‹ herum: »C’è puzza di grasso e polvere e soffritto di cipolla. C’è un odore saggio, che corrode, che mi conosce, quello del mare. Il Tirreno dista pochi metri da casa mia, quando indosso i vestiti che mia mamma stende fuori, profumano di smog e mareggiate.« Schrott, Müll und die verwesenden Überreste zerfetzter und erschlagener Kampfhunde liegen auf den löchrigen Straßen entlang der Wohnblocks, Sinnbilder der Verrohung zwischen den Menschen, die jeden Andersartigen, Aus- und Aufstiegswilligen gnadenlos zur Anpassung prügeln.
Wie seinem unerschrockenen Protagonisten lässt Levantino auch seinem Stil keine Zügel anlegen, nicht einmal, um Härten der Realität oder Grausamkeit abzufedern. Er schreibt ungeschönten Klartext. Wenn er jedoch Rosario von seinen Erlebnissen mit Anna erzählen lässt, gelingen ihm Passagen voll zarter Poesie, leicht und fernab von jedem Kitsch. (Selbst die Beschreibungen der Tristesse und des Elends von Brancaccio entbehren nicht lyrischer Bildlichkeit.) Immer wieder spielt der Erzähler mit der Syntax, mit Ketten variierter Vergleiche, mit Aufzählungen (»Di gente ce n’è di ogni tipo: …«), was das Lesen zum faszinierenden Erlebnis macht. Die (gar nicht so vielen) Dialektpassagen behindern den Genuss nicht, da fast alle paraphrasiert werden. Schließlich steht der Durchschnittsitaliener ebenso ratlos wie wir Nordlichter vor einem Satz wie diesem: »Quando Achille raggiunge Ettore, gli fa: ›Uora ti fiddulìu tuttu‹, che fidduliare, per chi non conosce il palermitano, vuol dire ›tagliare la pelle della faccia con un coltello‹.«
Leider mischt sich der Autor manchmal allzu auffällig in Rosarios Erzählfluss, um intellektuelle Höhenflüge loszuwerden. Der Niveaubruch katapultiert den Leser dann umgehend aus seiner Identifikation mit dem Protagonisten: »Anna è una disadattata, ma in un mondo in cui l’etica è invertita la sua emarginazione è il marchio più sicuro della sua autenticità.« – »Il mare che si distendeva sterminato pareva il velo dell’Annunciata di Antonello da Messina, prestato all’umanità per proteggersi dalla mostruosità del cemento.«
Kurz vor dem Ende zwingt Rosario die Wahrheit herbei und enthüllt sie in drei Zeilen. Niemand hätte sie vorausahnen können, aber sie liefert im Rückblick eine stimmige psychologische Erklärung für die eigenartige Zerrissenheit, die Paradoxe dieser Familie. Mit den Konsequenzen, die Rosario aus seinen Erkenntnissen zieht, erweist er sich der mythischen Helden, die er so verehrt, würdig.
 · Herkunft:
· Herkunft: