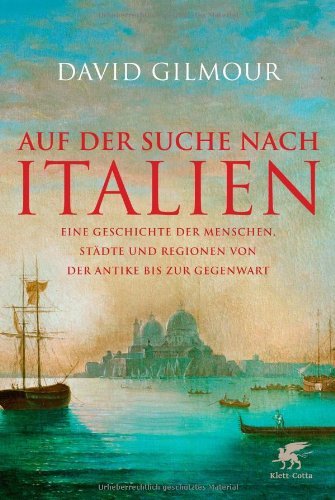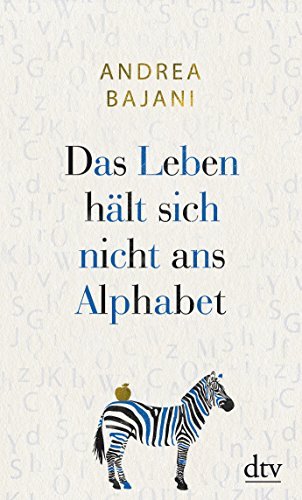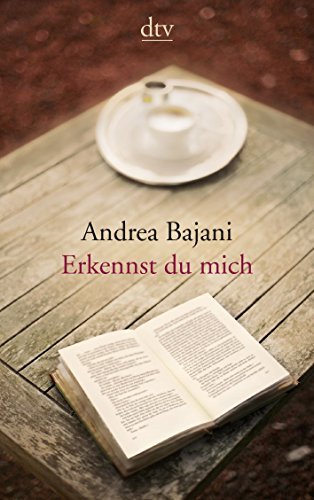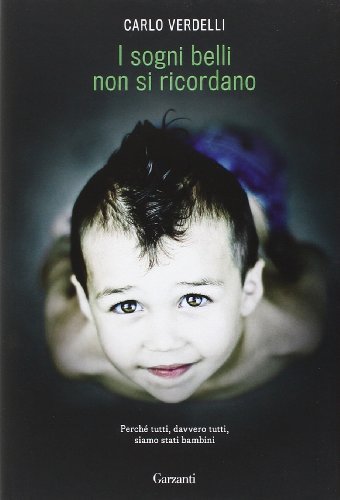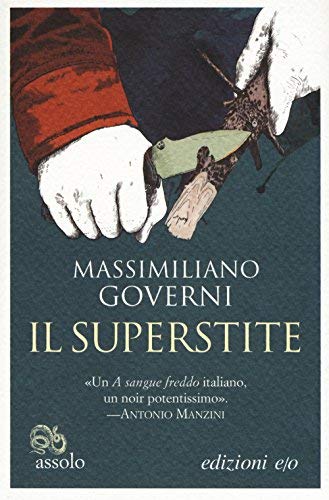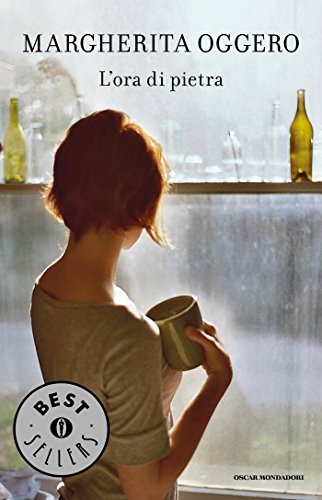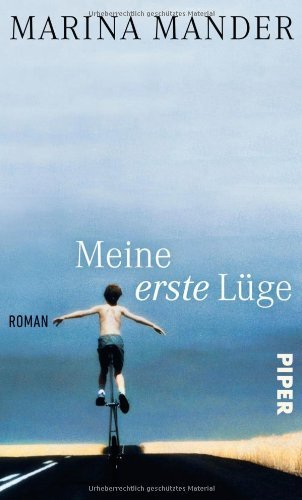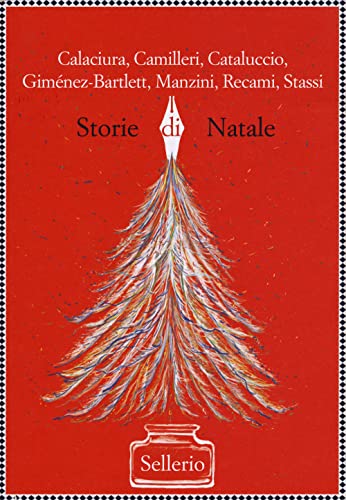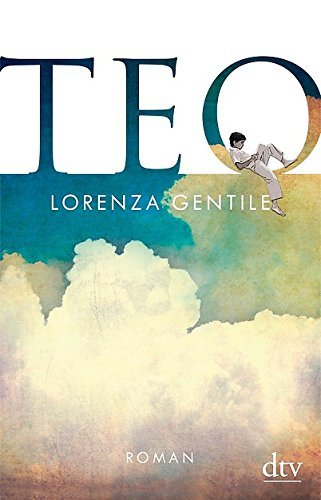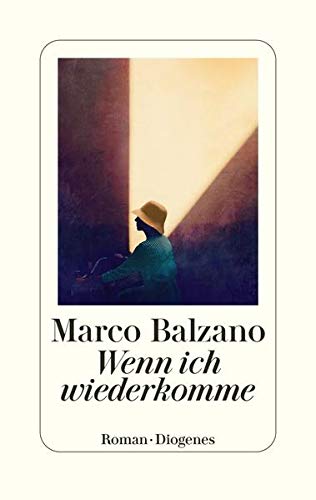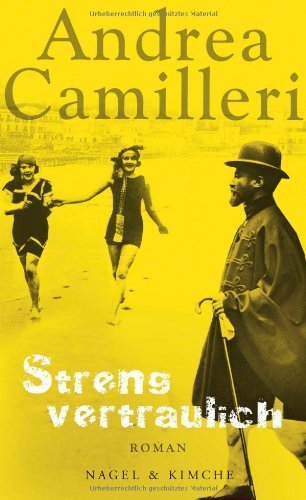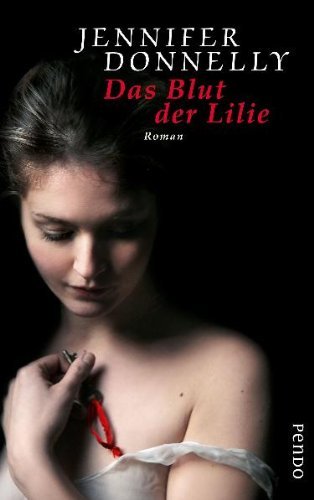Exotik, Begierde, Staub, Schweiß und Blut in der italienischen Kolonie Eritrea
Carlo Lucarellis Roman »L’ottava vibrazione« schildert das Leben in Italiens afrikanischer Kolonie Eritrea im Frühjahr 1896. Der (hochproduktive) Autor entwickelt ein breites Figurenpanorama, das Kolonialbeamte, sämtliche Ränge in den Militäreinheiten, etliche Einheimische (Bedienstete, Mädchen und junge Frauen, Kämpfer) und etliche italienische Ehefrauen umspannt. Für fast alle der porträtierten Italiener erweist sich die Handlung als ihr Weg in die Katastrophe, denn das Buch schließt mit der berüchtigten Schlacht von Adua, in der der europäische Kolonialismus seine schrecklichste Niederlage erlitt.
Dass es jemals soweit kommen könnte, ist keinem bewusst. Man treibt Handel, entwickelt die Landwirtschaft, bereitet den Boden für die Tausende von italienischen Habenichtsen, denen man hier blühenden neuen Lebensraum versprochen hat (das ist die politische Legitimation des Kolonialismus), man bedient sich auch der Mädchen, lässt sich Luft zufächeln, besorgt sich chat – in jedem Fall aber fühlt man sich sicher. Denn noch niemals, so hämmert es sich der brave maggiore Montesanto noch im Angesicht der gewaltig heranbrausenden Armee des äthiopischen Kaisers Menelik II. ein, konnten es die Eingeborenen mit europäischer Kriegeskunst aufnehmen ("Nessun esercito indigeno è mai riuscito a battere un esercito europeo ben quadrato." S. 425).
Dies ist die eine Seite der Romanhandlung. Eine zweite ist die Innenansicht des Lebens in der colonia. Während man in Offizierskreisen Zigarren rauchend politische und strategische Diskurse pflegt, lavieren sich die Kolonialbeamten mit magia durch den Alltag: Keine der Nachschublieferungen aus dem Mutterland wird korrekt verbucht – mal fehlt ein Feldstecher, mal fällt eine Kiste beim Abladen ins Wasser -, immer ergeben sich erfreuliche Spielräume zum eigenen Vorteil. Das Leben der Fußtruppen dagegen ist unerquicklich bis unerträglich: Es wimmelt von sadistischen sergenti und caporali, die die teils einfältigen, teils idealistischen Soldaten maßregeln, demütigen und quälen.
Schließlich ziehen sich zwei kriminalistische Handlungsfäden durch das gesamte Buch, die die eigentlichen Protagonisten verbinden:
Brigadiere Antonio Maria Serra ist eigentlich carabiniere, also Polizist. In Norditalien untersuchte er die blutrünstigen Morde an etlichen Kleinkindern, und sein Verdacht fiel auf einen Offizier. Um diesen nicht aus den Augen zu verlieren, verdingte er sich als Soldat und recherchiert nun undercover in der Kolonie.
Weiterhin ist Cristina eingereist, die attraktive junge Ehefrau des leitenden Kolonialbeamten und enthusiastischen Agronomen Leopoldo Fumagalli. Getrieben von ihrer Familie, hält sie dessen spekulatives Engagement in der Kolonie für aussichtslos und sucht einen Weg, das Familienvermögen zu retten. Attraktiv, verwöhnt und verschlagen, zieht sie bald die Fäden, an denen auch einer der vielen jungen Männer zappelt, die permanent auf der Suche nach erotischen Abenteuern sind ...
Allerdings ist das Buch – ganz klar gesagt – kein Krimi; es enttäuscht den Leser in dieser Hinsicht sogar, finde ich.
Was die Lektüre zum faszinierenden Genuss macht, ist Lucarellis Kunst, atmosphärisch unglaublich dichte Szenen zu erschaffen – mörderische Märsche durch sengende Wüstenhitze, intime Begegnungen im schattig-schwülen Kolonialbüro, geheime Treffen in schwarzer, regloser Nacht, verborgene Blicke hinaus in die staubige Mittagsglut durch die Ritzen eines Fensterladens, eine idyllische Segelboot-Überfahrt über ruhige See zu einer Insel, wo eine bukolische Hütte lockt, die Auffindung einer entstellten Kinderleiche, das spitzzüngige Geplauder feiner Damen im Salon in Parma ... Brennende Hitze, Fliegen allüberall, exotische Gewänder, nackte Begierde, Staub, Schweiß und viel Blut sind die Kulisse für das subtil aufgefächerte Innenleben vieler Personen. Der Roman ist in über 70 solcher Szenen strukturiert – teils durchnummeriert, teils mit "La storia di ..." betitelt, teils einzelne Fotografien beschreibend (Lucarellis historisches Quellenmaterial).
Großes Vergnügen hat mir gemacht, wie präzise Lucarelli beobachtet und hinhört. Er seziert die Sprache seiner Figuren, lässt ihre dialektalen Eigenheiten (Faenza, Cagliari, Parma, Venezia, Umbria, Piemonte, Toscana ...) auf der Zunge zergehen ("Parla in fretta, attaccando le parole una all'altra e spingendole fuori dalla gola, dure, perché è umbro dei monti, di Stroncone, ma lui dice de Strongone, e parla in continuazione [...] gli inglesi sono forti, – so' tosti, con la s di tosti che diventa quasi una sh, toshti", S. 34 f.) , erörtert Aussprache- und Bedeutungsnuancen afrikanischer Wörter ("Massaua ha tre nomi ...", S. 91, "Has'mreth ... Asmaret ... As-marèt [...] Has'mreth, come un sussurro o un singhiozzo", S. 275 f.).
Ungewöhnlich: Selbst die Zeitformen der Verben nutzt der Autor innovativ: Er gleitet bisweilen mitten im Satz vom Präteritum ins Präsens und wieder zurück – keineswegs weil die Zeitebene wechselt, sondern um innezuhalten, Bewegung zu erzeugen, das Tempo zu verlangsamen oder zu beschleunigen, ein Detail heranzuzoomen.
Lucarelli erweist sich in "L'ottava vibrazione" als Meister der präzisen Sinneseindrücke, die intensiv erlebbare Atmosphäre schaffen.
 · Herkunft:
· Herkunft: