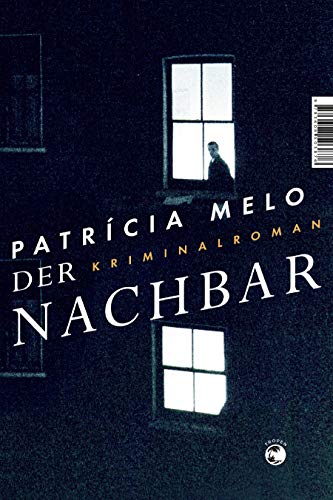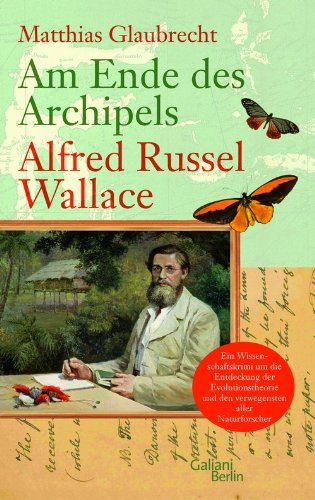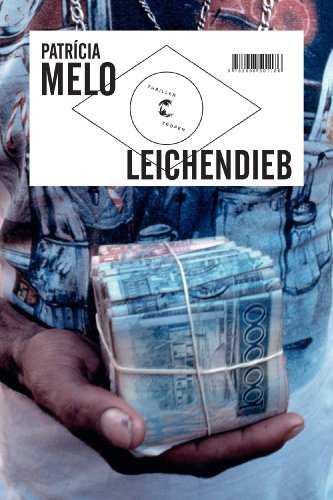
Greif zu! Lass es sein!
Hitze, nichts als Hitze hängt über Corumbá, der brasilianischen Großstadt im Grenzgebiet zu Bolivien und Paraguay. Hierher hat es den Ich-Erzähler, einen Mann ohne Namen, verschlagen. Auf den Straßen toben die Kinder. In den Nachbarwohnungen schreien Leute. Es ist Sonntag. Die Fahrradwerkstatt unten im Haus hat geschlossen. Und heute schläft Sulamita bei ihm. Sie ist Verwaltungsangestellte bei der Polizei. Aber wieso echauffiert sie sich nur immer so? »Diese Scheißindios.«
Ihm gefällt’s hier, und er lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Zwar knabbert er noch immer an seinem Rausschmiss als Geschäftsführer bei einem Marketing-Callcenter. Da war diese junge Frau, die sich partout nicht überzeugen lassen wollte, dass man am Telefon mit einem Zungenpiercing nicht sonderlich verständlich und verkaufsmaximierend rüberkommt, und da hat er ihr im Affekt eine geknallt … Knapp eine Woche später stürzte sie sich aus dem Fenster eines Hochhauses. Ein Jahr ist das jetzt her, und es geschah in São Paulo.
Jetzt macht er seinen heruntergekommenen roten Pick-up startklar. Es geht zum Angeln an den Río Paraguay. Aus dem Radio rieseln die Katastrophennachrichten aus aller Welt, Börsenkurse und traurige Inlandsstatistiken absehbarer Morde an jungen, schwarzen, armen Menschen. Aber das kratzt ihn alles nicht – er fällt aus dem Raster, denn er ist weder reich noch schwarz noch Moslem noch irgendwie problematisch.
Zehn Kilo Fisch, das lässt sich sehen. Im Januar, dem Laichmonat, haben die Fische zwar Schonzeit, aber was soll‹s. Er »hat den Ort ganz für sich allein.« Jetzt ein bisschen im Schatten dösen und abkühlen …
Motorkreischen reißt ihn aus seinen Träumen – eine Explosion, und vor seinen Augen rauscht ein einmotoriges Flugzeug ins Wasser, bleibt im Schlamm stecken. Ohne Zeit zu verlieren, stürzt unser Held zur Maschine, versucht den jungen Mann am Steuerknüppel zu retten, doch vergebens – der Pilot haucht wortlos seinen letzten Atemzug, die Maschine droht zu versinken.
Was nun? Die schwere Leiche bergen, die Polizei benachrichtigen? Im Abwägen nimmt der Mann hinten in der Kabine einen ledernen Rucksack wahr. Darin findet er, eingeschweißt in Plastikfolie, »eine kompakte weiße Masse«, unverkennbar Kokain. Die Versuchung ist zu groß (»Der Mensch ist nicht lange ehrlich, wenn er alleine ist.«), und wenn schon, denn schon – die nunmehr herrenlose Fliegeruhr wird gleich mit eingesteckt.
Wir ahnen, dass das Schicksal jetzt einen fatalen Lauf aufnehmen wird. Unser bescheidener, schlichter Ich-Erzähler will einfach nur eine »Weile nicht mehr arbeiten müssen«. Doch der Teufel steckt auch bei einfachen Plänen im Detail. Um die Drogen zu vertickern, braucht man Beziehungen, und solche hat Moacir, der schwarze Indio (voller Schmieröl noch schwärzer), der drunten in seiner Fahrradwerkstatt noch weniger als Kleingeld verdient. Moacir kennt einen Drogenboss drüben in Bolivien; lässt sich da nicht noch ein Zusatzgeschäft ankoppeln?
Der grenzüberschreitende Drogenhandel könnte wie am Schnürchen klappen, wäre Moacirs Ehefrau nicht so unersättlich. Erst verfällt sie angesichts der gedealten Einnahmen in einen wahren Kaufrausch, dann liefert sie Moacir nach einem Eifersuchtsstreit der Polizei aus. Die beschlagnahmt, was an Drogen verblieben ist, und jetzt hat der Ich-Erzähler erst so richtig Ärger an der Backe. Denn der Drogenboss dampft seinen Handlungsspielraum noch weiter ein: Kokain zurück oder Geld her, und das binnen 24 Tagen …
Patricia Melos »Ladrão de cadáveres« ist geradezu amüsant zu lesen. In saloppem, lakonischem Sprachstil verfasst, schreitet die Erzählung in kurzen Sätzen zügig voran. Dabei übersieht man fast die ernsten, teilweise düsteren Aspekte und Themen. In den Armutsvierteln von Corumbá haben die Menschen kaum bessere Chancen auf Lebensqualität als die herumstreunenden Tiere. Die Infrastruktur ist verfallen, die Gegend versifft, die Jugend alkoholisiert. Morde, Suizid und Gesetzlosigkeit sind an der Tagesordnung. In den Wohnungen machen Streit und häusliche Gewalt das Leben der ohnehin instabilen, prekären Familien zur Hölle auf Erden. Die Verantwortlichen, denen es eigentlich obliegt, für ein Minimum an Ordnung und Recht zu sorgen, beteiligen sich stattdessen an deren Unterminierung und profitieren noch davon. Da hat sich ein rechtsfreier Raum herausgebildet, in dem Moral und Werte keine Bedeutung haben.
So stabil die deprimierende Gesamtlage sein mag, so fragil ist der Zustand des Einzelnen. Im Nu kann man in einen anderen Aggregatszustand gleiten – sozial, juristisch, moralisch oder physisch. Der Protagonist zum Beispiel: Ist er nicht im Kern ein hinlänglich guter Mensch, der nur per Zufall (weil im falschen Moment am falschen Ort) zum Verbrecher wird? Oder trifft seine eigene, schonungslos bittere (Selbst-) Analyse zu, »dass Gutsein, genau wie Gott, eine Erfindung war, dass der Mensch schlecht geboren und im Laufe der Zeit noch schlechter wird«?
Wie auch immer: Jede Tat erfordert unweigerlich eine weitere, und so saugt es ihn immer tiefer in einen Strudel von Verbrechen. So schlimm sei er doch gar nicht, beruhigt er sich immer wieder (»Wir sind keine Mörder«), und doch findet er keinen Halt.
Beispielsweise ist er zeitweise geneigt, den erpresserischen Plan, gegen Geld die Leiche des Piloten an dessen Familie auszuliefern, fallenzulassen. Die Berabas sind reiche Viehzüchter, und da er inzwischen einen Job als Chauffeur bei ihnen hat, kann er das seelische Elend der trauernden Mutter, Dona Lu, aus nächster Nähe verfolgen: Sie möchte ihren Sohn, wenn schon nicht lebendig, so doch wenigstens als Leiche zurückhaben und begraben dürfen. Doch bei allem Mit-Leid kann er nicht mehr zurück, er muss ihnen weiterhin anonym die Leiche des Sohnes anbieten.
Verstärkend kommt hinzu, dass Freundin Sulamita ihm ihre verführerische Hilfe anbietet. Sie arbeitet jetzt im Leichenschauhaus; alle unklaren Todesfälle liegen da auf dem Seziertisch. Ganz schnell rutscht auch sie, eine rechtschaffene Frau, auf die andere Seite des Gesetzes. Ist es eine Rechtfertigung, dass ihre Kollegen auch nicht besser sind, jederzeit gern die Hand aufhalten? Kann die Verkettung dummer Umstände einen Freibrief für moralischen Verfall ausstellen?
Während die durchgängig spannende Handlung auf ihren Höhepunkt zuläuft und wir beim bevorstehenden Austausch Geld gegen Leiche ein blutiges Desaster befürchten müssen, weil unser Erpresser halt doch bloß ein Dilettant ist, hat die Autorin ganz anderes in petto, was wir in unseren kühnsten Träumen nicht hätten ausfantasieren können …
Die Brasilianerin Patrícia Melo wurde 1962 in São Paulo geboren. Sechs ihrer neun Bücher (seit 1994) liegen auf Deutsch vor – alle von Barbara Mesquita übersetzt. Ihren »Leichendieb« (2010 erstveröffentlicht) habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Sommer 2013 aufgenommen.
P.S.: Nicht wichtig, aber vielleicht fragwürdig: Hunderte Male findet man im Internet diese offenbar vom Klett-Cotta-Verlag verbreitete Angabe: »›Die Times‹ kürte Patrícia Melo zur ›führenden Schriftstellerin des Millenniums‹ in Lateinamerika.« Im englischen Pressetext kommt das inhaltlich anders, dafür als Zitat ausgewiesen: »The Times declared Melo to be one of the ›leading figures of Latin America for the new millennium.‹« Wann mag The Times das wohl erklärt haben? Egal, denn leider finde ich nicht einen einzigen Beleg für derartige Äußerungen der britischen Tageszeitung The Times – und das Zitat entdeckt Google im ganzen Internet nur ein Mal: im Klett-Cotta-Text zu Patrícia Melo. Wählen Sie Deutsch als Sprache jener Seite, steht da eine weitere Variante: »Die Times kürte Melo zu einer der ›Lateinamerikanischen Leitfiguren für das neue Millennium‹.«
Jetzt kommen wir der Wahrheit wohl näher: Denn es war das amerikanische Wochenmagazin TIME, das die Autorin in eine Liste von fünfzig »Latin American Leaders for the New Millenium« aufnahm – und das war im Mai 1999 (vermutlich in TIME Special Issue, May 24, vol. 153, No. 20; leider ist mir das TIME-Archiv aber nicht zugänglich).
Falls ich unzulänglich recherchiert habe, bitte ich um Vergebung.
Falls Klett-Cotta hier etwas großzügig (um nicht zu sagen: reißerisch oder nachlässig) formuliert haben sollte: Das hat Patrícia Melo weder nötig noch verdient.
 · Herkunft:
· Herkunft: