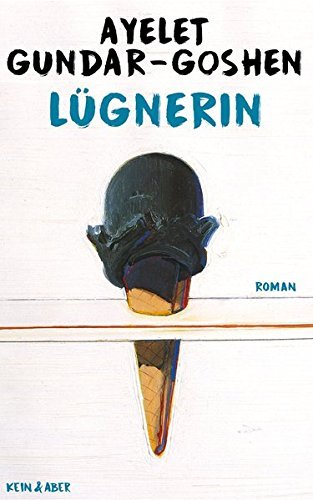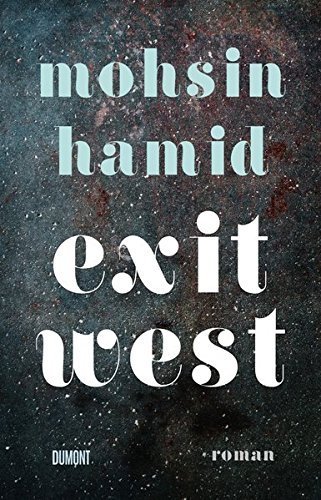
Exit West
von Mohsin Hamid
Zwei moderne junge Leute in einem der Krisengebiete dieser Welt verlieben sich ineinander. Als sich die Lage in ihrer Heimatstadt lebensbedrohlich zuspitzt, fliehen sie nach London, wo sie Frieden und Freiheit suchen. Doch dort begegnet den Geflohenen Feindseligkeit, die in einem Gewaltakt gipfelt. Die Liebe geht verloren, aber es bleibt Hoffnung auf ein besseres Leben.
Die Liebe auf der Flucht
Ihre Stadt bleibt namenlos. Es ist eine von vielen in den Krisenherden östlich und südlich Europas, wo militante Gruppen ihre Ideologie durchsetzen wollen, Gewalt und Zerstörung um sich greifen, Ressourcen verknappen. Und doch gehen die Menschen in solch einer »Stadt am Rand des Abgrunds« ihrem Alltag nicht anders nach als wir.
Die junge Nadia beispielsweise führt ein Leben, das nach unseren Maßstäben völlig ›normal‹ scheint. Sie wohnt allein, arbeitet bei einer Versicherungsgesellschaft, fährt Motorrad, hat einen gleichgesinnten Bekanntenkreis (»Freigeister«), den ihre Familie missbilligt. Um »heikle Situationen zu meiden«, macht sie nach außen hin gewisse Konzessionen, wie ein langes schwarzes Gewand zu tragen.
Bei einem Abendkurs über Corporate Identity lernt sie Saeed kennen. Der Mitarbeiter einer Werbeagentur lebt noch bei seinen Eltern, aufgeschlossene Leute, die die Gebote ihrer Religion respektieren wie ihr Sohn. Nadia und er treffen sich in Cafés, halten per Smartphone Kontakt, aber öffentlich dürfen sie ihre wachsende Liebe nicht zeigen. Außerdem will Saeed bis zur Eheschließung keusch bleiben.
Doch die Lage der Stadt verschlechtert sich. Extremisten unterjochen ganze Viertel, Willkür herrscht, Bomben explodieren, Menschen sterben zwischen den Fronten. Nadia nimmt Saeeds fürsorgliches Angebot an, ins Haus seiner Eltern einzuziehen, wo sie sicherer sei, und wird dort liebevoll als »Tochter« aufgenommen. Als die Stadt schließlich nahezu vollständig in die Hand radikaler Fundamentalisten übergeht, verlassen immer mehr Menschen ihre Heimat, darunter Saeed und Nadia. Sie bezahlen Vermittler, landen auf Mykonos, fliehen weiter nach London.
Im Hauptteil seines Romans »Exit West«  (den Monika Köpfer aus dem Englischen übersetzt hat) führt Mohsin Hamid eindringlich vor Augen, wie in der britischen Metropole zwei Welten aufeinander prallen. Die Flüchtlinge leben in Auffanglagern, Zeltstädten und Camps, manche besetzen leerstehende Häuser. Die Einheimischen betrachten diese Zugezogenen als Bedrohung ihrer Sicherheit und ihres Wohlstandes. Ängste und Wut wachsen, ein Mob formiert sich. Polizei und Armee können nicht verhindern, dass bei einem Massaker Hunderte Ausländer grausam getötet werden. Migranten aus allen möglichen Nationen und Kulturen werden schließlich am Rande der Stadt in bewachten Ghettos zusammengepfercht. Saeed und Nadia stellen fest, dass ihre Flucht – anders als erwartet – nichts an ihrer grundsätzlichen Lebenslage verbessert habe, verändert hätten sich »lediglich die Gesichter und Gebäude«.
(den Monika Köpfer aus dem Englischen übersetzt hat) führt Mohsin Hamid eindringlich vor Augen, wie in der britischen Metropole zwei Welten aufeinander prallen. Die Flüchtlinge leben in Auffanglagern, Zeltstädten und Camps, manche besetzen leerstehende Häuser. Die Einheimischen betrachten diese Zugezogenen als Bedrohung ihrer Sicherheit und ihres Wohlstandes. Ängste und Wut wachsen, ein Mob formiert sich. Polizei und Armee können nicht verhindern, dass bei einem Massaker Hunderte Ausländer grausam getötet werden. Migranten aus allen möglichen Nationen und Kulturen werden schließlich am Rande der Stadt in bewachten Ghettos zusammengepfercht. Saeed und Nadia stellen fest, dass ihre Flucht – anders als erwartet – nichts an ihrer grundsätzlichen Lebenslage verbessert habe, verändert hätten sich »lediglich die Gesichter und Gebäude«.
Diesen Werdegang erzählt Mohsin Hamid, in Lahore (Pakistan) geborener Autor, auf recht distanzierte Weise. Dennoch macht sein Roman betroffen. Er führt vor Augen, wie für viele Millionen Menschen in aller Welt nacktes Überleben, Flucht und Exil zum einzigen Lebensinhalt werden, wenn die Menschenrechte in ihrer Heimat mit Füßen getreten werden, die Menschen selber verrohen und jedes Aufbegehren, jede Vernunft niedergemetzelt wird.
Gleichzeitig stellt er am Beispiel der britischen Finanzmetropole die Problematik der europäischen Reaktion auf den Zustrom der Migranten dar. Sie reicht von der (anfänglich gehypten) ›Willkommenskultur‹ über Gleichgültigkeit und Skepsis bis zu blankem Hass auf alles Fremde, der nach Abgrenzung, Mauerbau, Abschiebung und Gewalt schreit.
Dass das Phänomen der Ressentiments gegen Fremde ein allgemein menschliches sei, deutet der Autor durch einige Miniatur-Alltagsszenen aus aller Welt an, die unvermittelt in den Handlungsfortgang eingeschoben sind. Ob in Sydney, Wien oder Tokio, überall lösen spontane Begegnungen mit Fremden erst einmal Argwohn, Angst oder auch unterdrückte Aggression aus.
In der letzten dieser Einblendungen sinniert eine alte Frau in Palo Alto über die Veränderungen in der Nachbarschaft ihres Elternhauses, in dem sie ihr Leben verbracht hat. Lange Zeit kannte sie alle Namen der Gegend, »alte kalifornische Familien«, doch seit ein paar Jahren werden die Häuser in immer rascherem Wechsel verkauft und gekauft, »so, wie sie Aktien kauften und verkauften«, und neuerdings ist sie »umgeben von allen möglichen merkwürdigen Menschen, Menschen, die hier mehr zu Hause schienen als sie selbst, sogar die obdachlosen, die kein Englisch konnten, wirkten heimischer als sie«, und sie kommt zu einer Erkenntnis, die die Kernbotschaft des Autors an uns Leser sein mag: »Wir sind alle Migranten in der Zeit.«
Was aber macht all das mit dem Innenleben derer, die in ihrer desolaten Heimat alle Zelte abgebrochen haben und nun vom Land ihrer Hoffnung so bitter enttäuscht werden? Saeed und Nadia, den Identifikationsfiguren, setzen nicht nur die Gewissensbisse zu, ihre Verwandten im Stich gelassen zu haben. Sie müssen sich auch neu orientieren in der freien Kultur des Westens. Beide folgen dem, was schon früher ihre Wesensart war. Nadia schließt sich einem Häuserrat an, um die unerträglichen Bedingungen im Camp zu verbessern. Saeed sucht Halt in der Religion, im Gebet, bei einem Prediger. Ihre Liebe finden sie nicht mehr. Was begann wie die einfühlsam erzählte Geschichte einer sanften Liebesbeziehung, hinterfragt und wohl gehütet, verläuft sich am Ende im Flüchtlingselend.
Der teils sperrige Sprachstil des Autors widersetzt sich jeder Emotionalisierung. Die Syntax spiegelt die vielfältigen Unsicherheiten von Saeeds und Nadias Existenz. Eindrücke und Überlegungen, deren Alternativen, Zurückweisung und Widerlegung fließen in einem einzigen widersprüchlichen Satzgebilde zusammen: »Er rollte furchterregend die Augen. Ja: furchterregend. Oder vielleicht auch nicht furchterregend. Vielleicht blickte er sich einfach nur um …« – »Er war bereit zu sterben, auch wenn er nicht vorhatte zu sterben, er hatte vor am Leben zu bleiben, und er hatte vor Großes zu tun, solange er lebte.« Vorausverweise auf eine unabwendbare Zukunft durchlöchern die Gegenwart: »Bald sollte der Krieg die Fassade ihres Gebäudes gänzlich zerstören, so als hätte er am Rad der Zeit gedreht; die Kampfhandlungen eines einzigen Tages würden mehr Tribut fordern als ein ganzes Jahrzehnt.«
Befremdlich auch die minimalisierte Gestaltung des Fluchtwegs – inhaltlich eine Leerstelle, denn wir lesen nichts von ausbeuterischen Schleppern, rostzerfressenen Seelenverkäufern, nächtlichen Märschen und was wir dergleichen aus den Medien kennen. Der Autor reduziert den »Exit«, sublimiert ihn zum Symbol von Türen: »In diesen Tagen hieß es, das Durchschreiten einer dieser Türen sei wie Sterben und Geborenwerden zugleich.« Konkret meint das das Passieren der Räume, wo die zur Flucht Entschlossenen versammelt, geprüft und weitergeleitet werden, doch beschrieben ist es als eine Art Beamen, die magische Überfahrt in eine andere Welt (»West«), zu Orten wie Mykonos oder London.
Damit gibt die Form dem Roman einen artifiziellen, abstrakten Charakter, der die erzählten Ereignisse und Schicksale intellektuell verarbeiten lässt, ohne dass sie unter die Haut gehen. So ist wohl auch der Optimismus zu verstehen, den Mohsin Hamid im letzten Drittel aufkeimen lässt. Couragierte Menschen sehen keinen Sinn mehr im Kampf gegen die andere Seite, und man findet einen gemeinsamen Weg der Koexistenz. Vernunft und Menschlichkeit gewinnen wieder die Oberhand – in London. Der Rest ist Hoffnung.
 · Herkunft:
· Herkunft: