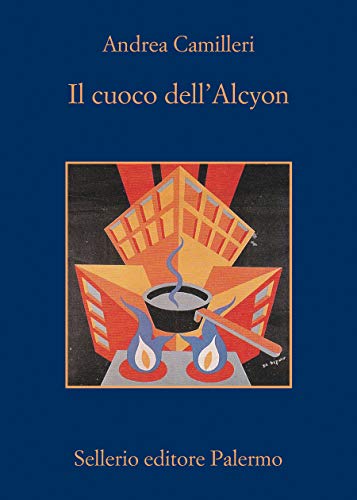Der Honigbus
von Meredith May
Die Autorin wuchs unter schwierigen familiären Umständen an der kalifornischen West Coast auf. Ihr bodenständiger Stiefgroßvater, ein begeisterter Imker, brachte seiner Enkelin damals die faszinierende Welt der Bienen nahe und gab ihr damit Orientierung in einer Welt voller Verzweiflung und Schuldgefühlen.
Leben lernen von den Bienen
Die Journalistin Meredith May schreibt für den »San Francisco Chronicle«, und das in anerkannter Qualität (Preisträgerin des PEN USA Literary Award for Journalism, Nominierung für den Pulitzer-Preis). Nun hat sie ihre Erinnerungen an ihre schwierige Kindheit in einem autobiografischen Roman veröffentlicht, und auch dieses Buch ist ein Erfolg, erzählt es doch eine anrührende Geschichte in gut gelungener literarischer Form.
Was »The Honey Bus«  für ein besonders großes Publikum attraktiv macht, ist, dass darin Bienen eine zentrale Rolle spielen, die Insekten also, die sich derzeit ohnehin breitester Sympathie erfreuen. Das Manuskript ist wohl zu einem glücklichen Zeitpunkt fertig geworden, und Mays Verlag (Harper Collins) hat alle Marketing-Register gezogen, um den Bienen-Hype beim Schopf zu ergreifen. Das Buch wurde augenblicklich in einem Dutzend Sprachen publiziert. Die deutsche Übersetzung stammt von Anette Grube.
für ein besonders großes Publikum attraktiv macht, ist, dass darin Bienen eine zentrale Rolle spielen, die Insekten also, die sich derzeit ohnehin breitester Sympathie erfreuen. Das Manuskript ist wohl zu einem glücklichen Zeitpunkt fertig geworden, und Mays Verlag (Harper Collins) hat alle Marketing-Register gezogen, um den Bienen-Hype beim Schopf zu ergreifen. Das Buch wurde augenblicklich in einem Dutzend Sprachen publiziert. Die deutsche Übersetzung stammt von Anette Grube.
Merediths Eltern sind zwei konträre Charaktere. Sally ist spontan, kontaktfreudig und unternehmungslustig, während David zurückhaltend und bedacht agiert. Beide finden die Gegensätzlichkeit des anderen interessant. 1966 heiraten sie, 1970 wird Meredith, 1973 ihr Bruder Matthew geboren. Da haben die Kontraste längst tiefe Klüfte aufgerissen, die Eheprobleme überhand genommen. David hat nach seiner Marinezeit einen Ingenieursjob gefunden, aber der bietet weder Sicherheit noch Wohlstand. Noch unzufriedener als darüber ist Sally über ihre Rolle als Mutter und Hausfrau, an der alle Arbeit hängenbleibe. Dass ihren geduldigen Ehemann rein gar nichts aus der Ruhe bringt, treibt sie zu Wutausbrüchen und Aggressionen, die die Kinder in ständige Alarmbereitschaft versetzen.
Im Februar 1975 ist die Ehe endgültig zerrüttet. Sally fliegt mit den beiden Kindern nach Kalifornien zu ihrer Mutter Ruth und deren zweitem Ehemann Franklin. Auch die beiden sind ein ungleiches Paar. Granny ist Lehrerin, eine Zuchtmeisterin der Ordnung im Haus, ein »Ausrufezeichen perfekter Haltung«, die großen Wert auf äußeren Schein und noch größeren auf ihren Ruf legt. Dagegen findet Grandpa seine Erfüllung in der freien Natur, wo er in zerschlissener, fleckiger Kleidung werkelt und sich nicht an Schmutzrändern unter den Fingernägeln stört. Die beiden bewohnen ein rotes Häuschen auf einem großen Grundstück in Carmel Valley Village bei Monterey.
Für die fünfjährige Meredith ist die Trennung von ihrem geliebten, jetzt himmelweit entfernten Dad unerträglich schmerzhaft. Sie grübelt, was sie selbst falsch gemacht haben könnte, dass sie jetzt alle in so einem Schlamassel stecken, und bemüht sich, besonders brav zu sein, damit die Familie vielleicht wieder zusammenfindet. Aber davon ist sie selbst nicht ganz überzeugt, denn sie spürt, dass ihre Mom sich verändert hat. »Irgendwo zehntausend Meter über der Mitte Amerikas hatte sie es aufgegeben, eine Mutter zu sein.«
Das Leben im neuen Heim entwickelt sich schlimmer, als Meredith befürchten konnte. Zwar nimmt Granny die Kinder auf und versorgt sie, doch ihre wahre Aufmerksamkeit gilt ganz ihrer sensiblen, zutiefst verletzten Tochter. Sally sucht umgehend Zuflucht im Bett, zieht die Vorhänge zu und versinkt »eingerollt wie ein Fetus« in Dunkelheit – für Jahre. Nach dem Tod der Großeltern wird sie in sehr schlechtem gesundheitlichem Zustand in einem Pflegeheim aufgenommen. Mit 73 Jahren stirbt sie, nachdem sie sich mit ihren Kindern, für die sie nie eine Mutter sein konnte und sein wollte, ausgesöhnt hat.
Wie wirkt es auf eine Tochter, wenn sie über viele Jahre hin versucht, ein bisschen Liebe von ihrer Mutter zu erheischen, doch immer nur abgestoßen wird? Meredith muss sich anhören, dass ihre Mom ohne die Kinder eine ganz andere Zukunft gehabt hätte – »unsere Existenz gab ihr das Gefühl, auf unerklärliche Weise versagt zu haben«. Wissend, »dass ich sie nicht lieben musste, nur weil sie meine Mutter war«, gibt das Mädchen es auf, ihrer Mom nachzulaufen, geht auf Distanz, ist nicht mehr bereit, ihr unaufhörliches Gejammer ihre Aggressionen, ihre Egoismen zu ertragen, versteinert innerlich. Doch ihre Schuldgefühle sitzen tief. In der Überzeugung, für Sallys seelisches Leid mitverantwortlich zu sein, nimmt Meredith das Angebot ihres Dads, dass sie mit Matthew zu ihm in seine neue Familie ziehen könne, nicht an, so gern sie auch möchte. Dafür hegt sie die Hoffnung, ihre Mutter eines Tages als Reinkarnation einer früheren Mom wiederzutreffen.
Es ist Merediths Großvater, der seine Enkelin in all ihren Nöten einfühlsam auffängt. Wenn sie am ungewöhnlichen Verhalten der Mutter verzweifelt, in der Schule wegen ihrer ärmlichen Kleidung aus dem Secondhandladen links liegen gelassen wird, voller Angst in ihre eigene Zukunft schaut, gibt er ihr Zuneigung, Orientierung, Kraft und Frieden. Er hat ein wunderbares Talent, mit leichter Hand überzeugende Alternativen aufzuzeigen, die das bedrückte Mädchen auf erfreulichere Gedanken bringen, Auswege öffnen, Hoffnung machen. Das tut er bisweilen augenzwinkernd. Als die Väter in der Schule ihre Berufe vorstellen sollen, sticht er die anderen glatt aus, indem er von den Walfangabenteuern des Urgroßvaters erzählt und sich selbst zum »Superhelden« stilisiert, der an den Klippen baumelnd Leitungsrohre sicherte. Damit rückt er Meredith ganz nebenbei ins Zentrum der Klassengemeinschaft.
Seinen Trumpf aber zieht er aus seinem Hobby, der Bienenzucht. Er vermittelt seiner Enkelin das seit Generationen weitergegebene Wissen über die nützlichen, emsigen und sozial organisierten Insektenvölker – und Meredith May gibt in vielen unterhaltsamen Portiönchen an uns Leser weiter, was man über Arbeitsteilung, Hierarchie, Kommunikation und weiteres Interessantes im Bienenstock wissen sollte. Anders als viele Überempfindliche glauben, sind diese Tiere keineswegs bedrohlich oder gar bösartig. Vielmehr sind es die Menschen, die aus Eigennutz oder Gleichgültigkeit den Mitgeschöpfen gegenüber deren Lebensräume und -grundlagen zerstören. Dabei ist kaum eine Art so unersetzlich wie die Bienen: Ohne sie werden auch wir Menschen kaum überleben können.
Entspannt, freundlich und respektvoll geht Grandpa mit seinen Bienen um, die er in einem alten Bus im Garten einquartiert hat, und er lehrt seine Enkelin, es ihm gleichzutun. Als Nebeneffekt dieses ruhigen, besonnenen Umgangs mit der Natur erfährt Meredith, dass man auch allein mit sich selber glücklich sein kann – während andere Leute »die Hölle« sein können.
Bis 1987 lebte Meredith May bei ihren kalifornischen Großeltern, und ihr Buch beschreibt intensiv in vielen kleinen Episoden die Atmosphäre jener Jahre und jener legendären, idyllischen Gegend am Pazifik, wo nonkonformistische Hippies als Lehrer arbeiteten, Kriminalität unbekannt war, die einfachen Leute sparsam lebten. Mit den so gegensätzlichen Erinnerungen an ihre frühen Jahre dort, wo sie ihren eigenen Weg fand, konnte sich Meredith May den Ballast des vermeintlichen eigenen Versagens von der Seele schreiben. Heute hegt sie mit Hingabe die letzten Bienenstöcke ihres Großvaters.
 · Herkunft:
· Herkunft: