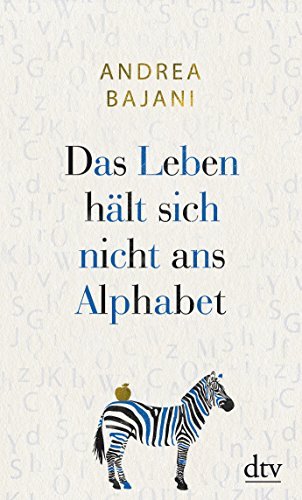Matthias – allein zu Haus
»Keiner da.« So ähnlich muss es der kleine Junge oft empfunden haben, selbst wenn das große weiße Haus nie menschenleer war. Kiefernweg 12 im Bonner Ortsteil Venusberg, das war die Dienstvilla des Bundeskanzlers. Sicherheitspersonal, Bedienstete, Sekretäre, Gäste werden es rund um die Uhr bevölkert haben. Quasi nebenan wohnt Bundespräsident Heinrich Lübke mit Frau Wilhelmine, mit denen das Kind nachmittags Kakao trinken darf. Doch das sind alles nicht die Leute, die ein Sieben- oder Zehnjähriger sucht.
Jeder Fernsehzuschauer wird den Mann kennen, der mit den beiden Wörtern sein literarisches Debüt beginnt. Matthias Brandt zählt zu den beliebtesten Schauspielern. Seine Markenzeichen sind eine minimalistische Mimik, ein leichtes Blitzen in den Augen, das verschmitzt oder auch heimtückisch aufleuchten kann, eine unaufgeregte Stimme, eine elegante, aufrechte Erscheinung. Er kann sich undurchschaubar und zynisch geben, aber selbst dann noch fragil wirken.
Wahrscheinlich ist auch keinem Zuschauer entgangen, dass der Mann ein Prominentenkind ist. Sein Vater Willy Brandt war Regierender Bürgermeister von Berlin (1957-1966), SPD-Parteivorsitzender (1964-1987), Bundesaußenminister (1966-1969) und Bundeskanzler (1969-1974) und zu seiner Zeit eher umstritten als gefeiert. Streitpunkte boten die offenere »Vergangenheitsbewältigung« (Kniefall-Geste von Warschau) und die neue Ostpolitik (für die er 1971 den Friedensnobelpreis erhielt). Daneben wurde er wegen seines Privatlebens diffamiert, sei es wegen seiner unehelichen Herkunft, seines Exils während des Krieges oder angeblicher persönlicher Schwächen. Willy Brandt – soviel ist bekannt – war nicht aus so hartem Holz geschnitzt, dass all dies einfach an ihm abgeprallt wäre. Wer weiß, wie sein tagtäglicher Kummer auch den kleinen Jungen belastete, seit er im Frühjahr 1967 mit seinen Eltern am Kiefernweg eingezogen war.
Wer glaubt, Matthias Brandt eröffne einen Schlüssellochblick auf bislang unveröffentlichte Intimitäten aus der Politprominenz der Sechzigerjahre, wird enttäuscht. Der Kanzler (»Vater«) tritt seltenst in Erscheinung, Mutter Rut etwas häufiger, die beiden größeren Brüder Peter und Lars gar nicht. »Keiner da« außer dem Jüngsten?
Augenscheinlich geht es dem Autor in seinem Erstling zunächst einmal darum, seiner eigenen Befindlichkeit in jener frühen Phase nachzuspüren. Insofern ist seine Perspektive sehr persönlich und einzigartig. Was sie für jeden Leser lesenswert macht, ist das Grundsätzliche darin: die Ahnung des Kindes von Einsamkeit, Verlassensein, der Notwendigkeit, selber einen Weg finden zu müssen. Das Leben im Rampenlicht, die Privilegien, die herausgehobene Position an der Spitze der Gesellschaft spielen nur Nebenrollen.
In vierzehn Geschichten erzählt Matthias Brandt (Jahrgang 1961) von seiner Zeit als etwa sieben- bis elfjähriger Junge. Noch ehe er anfängt, zündet er eine Nebelkerze: »Alles, was ich erzähle, ist erfunden. Einiges davon habe ich erlebt. Manches von dem, was ich erlebt habe, hat stattgefunden.« Viele Realia der späten Sechzigerjahre erden jedoch die nachfolgenden Texte – traditionsreiche Markennamen (Saba, Romika), längst entsorgte Kleidungsstücke (Nickipullover), Köstlichkeiten aus Kindertagen (Champignonstreichkäse, Tri-Top Mandarine). TV-Straßenfeger versammeln die Familien in den Wohnzimmern. »EWG – Einer wird gewinnen«, das Samstagabend-Quiz mit Hans-Joachim Kulenkampff, stimmt die Deutschen auf Europa ein, »Raumpatrouille«, die deutsche Science-Fiction-Serie, erschließt (nach der amerikanischen Mondlandung am 20. Juli 1969) auch ihnen Abenteuer im Weltraum.
Den kleinen Matthias beeindrucken die gleichen Dinge wie seine Altersgenossen. Ein Astronautenanzug (eine Art Pyjama, klebrig, luftdicht, schweißtreibend), eine Torwart-Ausrüstung genau wie die von Wolfgang Kleff, ein Zauberkasten muss her. Solche Attribute und lodernde Leidenschaft blasen das »spillerige« Kind nur für kurze Zeit zum Helden auf, ehe es die Realitäten akzeptieren muss. Dem Fußballer fehlt das Ballgefühl, die Zaubershow zum Geburtstag der Mutter geht noch im Experimentierstadium kläglich in Flammen auf. Aber das Bedürfnis, sich vollständig in andere Menschen zu verwandeln, sogar »mehr sie sein [zu wollen], als sie selbst es waren«, schlägt Wurzeln.
Zündeln, Tierexperimente, Halsschmerzen, Allmachtfantasien, Tobsuchtsanfälle – alle Jungs durchleben das so oder so. Alles normal, alles gut so. Aber bei Matthias hat die familiäre Sonderstellung der Normalität das Normale geraubt. Das möchte er bei Klassenkamerad Holger kennenlernen. Zum Fernsehabend auf der Couch gibt es einen großen Teller mit belegten Broten, Gläser auf Untersetzern, man trägt Cordschlappen und Trainingsanzug – ein »grandioser Abend«! So könnte sich auch Matthias seine Zukunft vorstellen, vielleicht als Briefträger wie Herr Spahrbier bei Wim Thoelke. Warum nur haben ihm seine Eltern und das Schicksal »alles, was das Leben lebenswert machte«, vorenthalten?
Zweifellos ist ein Kanzler-Kind zum Außenseiterdasein verurteilt. Die Zäune zwischen der Welt und dem Regierungsanwesen sind scharf bewacht, hinaus geht es nur nach Terminabsprache mit Chauffeur und Begleitung. Worin die »Bedrohung« in der Welt da draußen besteht, dass man sie Tag und Nacht mit Maschinenpistolen in Schach halten muss, kann der Junge nicht verstehen. Die Wächter sind seine Kumpel (andere gibt es im Innenbereich nicht) und spielen mit: »Ah, der Chef himself.« »Alles roger,« bestätigt Matthias. In ihrer Wachstube lassen sie ihn von ihrer Teewurststulle abbeißen. Wenn er aber mal ausbüchst und sich im Schrank versteckt, sind alle in Aufruhr, bis der Vermisste wiedergefunden ist.
Andererseits kann der jüngste Bewohner das riesige Areal ganz für sich vereinnahmen. Niemand kontrolliert oder dirigiert ihn. »Keiner da« – freie Bahn für das Ausleben aller Fantasien, wenn er auf dem Bonanzarad durchs Gelände kurvt. Einsam ist er da auch nicht ganz, denn er hat seinen Lieblingshund Gabor (dessen delikate Hundeplätzchen er heimlich knabbert), ein Meerschweinchen, eine Schildkröte, auch ein Au-pair-Mädchen, eine Haushälterin, einen Hausmeister.
Sein Anderssein bedrängt ihn vor allem draußen, in der Schule. Keine »Anverwandlung« und keine »Lebensveränderungskleidung« lässt ihn zu einem ganz normalen Holger werden, geschweige denn zu einem Anführer. Wenigstens ist er kein Ansgar. Der Sohn von »Vertriebenen« steht noch weiter abgeschlagen in der Hackordnung auf dem Schulhof. Diesen Weichling, der, obwohl älter und größer, jede Demütigung passiv über sich ergehen lässt, zu verprügeln und zu quälen, »war die einfachste Art, zu sein wie die anderen, und das war mein brennendster Wunsch«. Dass sich die beiden Outcasts am Nachmittag heimlich im Wald treffen, Zigaretten teilen und Ansgar seine dunkelsten Geheimnisse offenbart, verhindert nicht das Ritual des nächsten Tages: Matthias »hob langsam die Hand«, Ansgar beginnt zu winseln ...
Die Geschichte von Ansgar ist eine der berührendsten, macht der Erzähler doch kein Hehl aus seinem ziemlich erbärmlichen Mitmachertum. Überhaupt schont er sich nicht. Freimütig berichtet er von seinen Schwächen, Feigheiten, Ängsten, Schamgefühlen, Selbstzweifeln, seinem Versagen, jedoch ohne den Jungen bloßzustellen. Der gereifte Erwachsene beschreibt ihn mit demselben feinen Gespür, mit dem er einst die Welt um sich herum aufnahm, sich selber beobachtete und seine Existenz quälend hinterfragte, bis er sie in ein »Nichts« aufgelöst hatte.
Und die Eltern? Wer könnte ihnen einen Vorwurf machen, dass die meiste Zeit »keiner da« ist? Sie werden von Wichtigerem in Beschlag genommen. Nicht nur Matthias, auch seine Mutter scheint darüber unglücklich. Nur in den Ferien, wenn es zu den Verwandten in »unsere eigentliche Heimat« Norwegen geht, fällt alle Last von ihr ab. Ihre Frage, ob er sich vorstellen kann, mit ihr hier zu leben (»wir zwei, du und ich«), lässt ahnen, wie es in ihr aussehen mag. Den Jungen beunruhigt die Frage. Der Mutter zuliebe bejaht er – und hofft doch, sie meine es nicht ernst.
Die erzählten Erfahrungen mit dem »geliebten Vater« könnten den politisch Interessierten zum Schmunzeln verleiten, wären sie nicht so deprimierend für das Kind, das den Preis bezahlt. Einmal besucht die ganze Familie einen Jahrmarkt. Man schleust die drei, belagert von einer Fotografenmeute, durch die teils applaudierende, teils buhende Menge. An einer Losbude fängt Blitzlichtgewitter ein, wie dem Jungen der Hauptgewinn, ein »großer rosa Teddybär«, in die Arme gedrückt wird. Unbeachtet bleibt, dass Matthias zuvor sämtliche Lose im Eimer aufdröseln musste, bis endlich das richtige gefunden war. Ebenso muss er alleine damit fertig werden, dass man ihn mit der riesigen rosa Peinlichkeit in sämtlichen Jungskreisen blamieren wird. An allem, was einen Zehnjährigen wirklich interessiert, geht es dann rasch vorbei. »Auf der Heimfahrt Schweigen.« Ein anderes Mal wird ein Fahrradausflug am Sonntagmorgen arrangiert. Auch hier muss Matthias erkennen, dass er nicht die Hauptperson, sondern das »Anstandskind« ist, eine Art Puffer zwischen zwei Spitzenpolitikern, die einander spinnefeind sind. SPD-Fraktionsvorsitzender Herbert Wehner und der Kanzler sollen sich informell näher kommen. Die Veranstaltung erreicht nach kurzer Zeit ihren Tief- und Endpunkt, als der ungeübte, ungelenke Vater vom Rad stürzt.
Ob historisch korrekt oder nicht – egal. Matthias Brandt debütiert mit einem ganz wunderbaren literarischen Schmuckstück. Ein leicht melancholischer Ton durchweht die meisten Seiten, manch traurige Episode wird dagegen ganz trocken referiert. Seine ungewöhnliche Kindheit hat dem Autor einen einzigartigen Stoff von großem öffentlichen Interesse beschert, aber er widersteht jeglicher Versuchung, damit zu kokettieren oder eine Abrechnung zu verbinden. Hier schreibt ein äußerst feinfühliger, ästhetisch anspruchsvoller und sprachlich hoch begabter Mensch, der sich von seinem Übervater emanzipiert und auf eigene Füße gestellt hat.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Winter 2016 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: