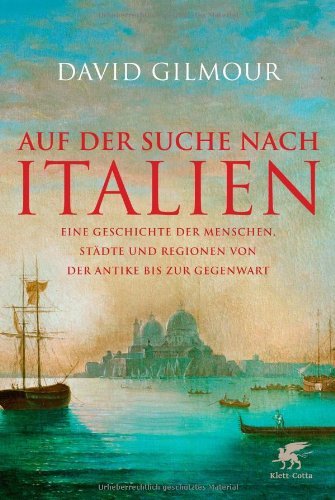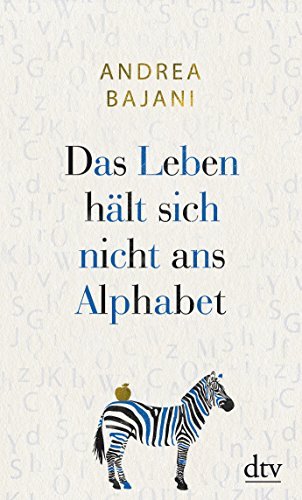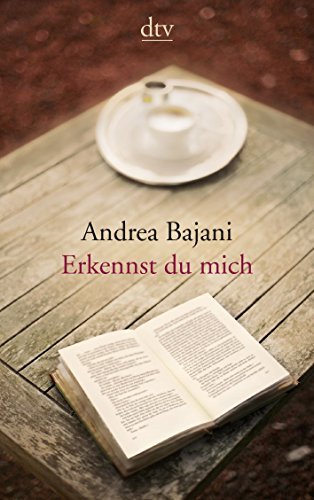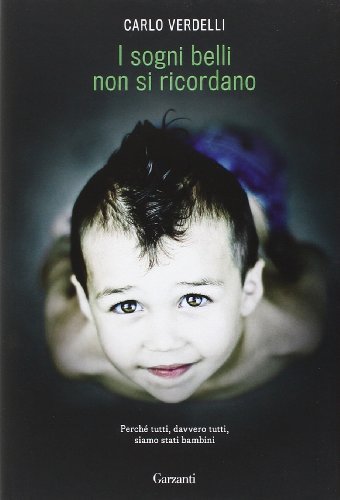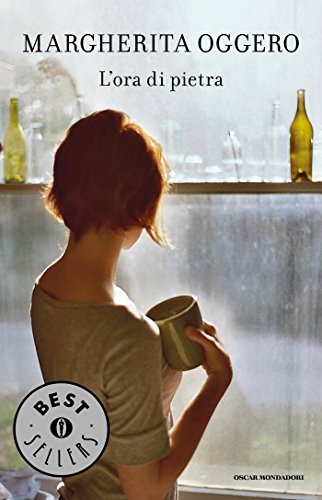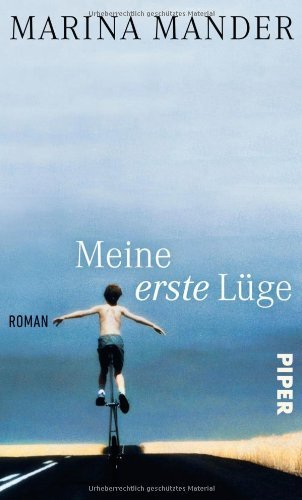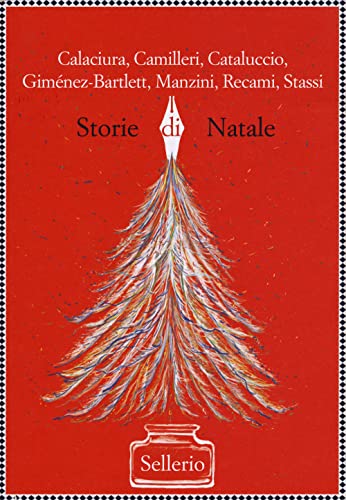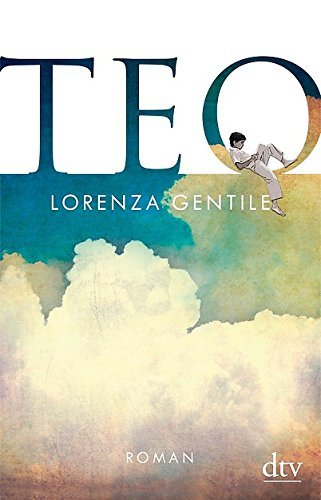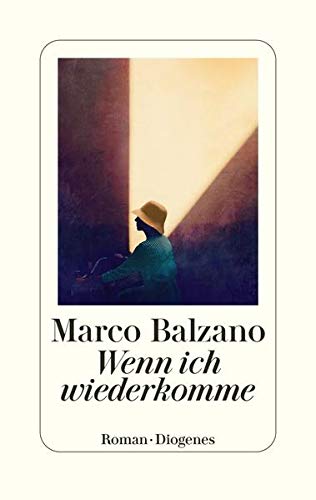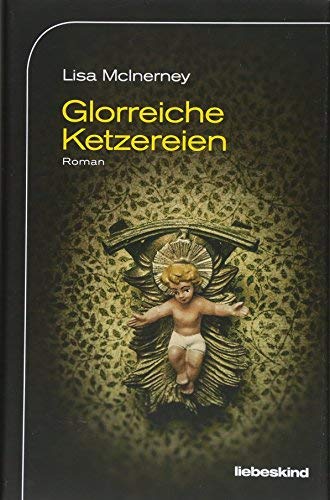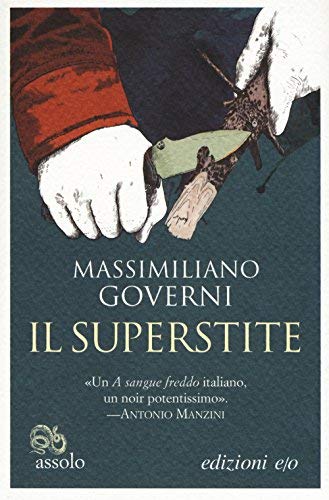
Il superstite
von Massimiliano Governi
Zwei Einbrecher töten eine vierköpfige Familie. Ein Sohn bleibt durch Zufall verschont. Doch sein Leben ist nur noch eine leere Hülle. Das nüchterne Psychogramm eines Übriggebliebenen.
Ohne Ende
Weil er ein paar Meter weiter wohnt, entgeht er dem Tod und findet seine Eltern, seinen Bruder und seine Schwester kaltblütig erschossen in ihrem Haus auf. Die Mörder werden schnell gefasst: zwei Serben, Onkel und Neffe. Letzterer begeht Selbstmord, Ersterer wird in seiner Heimat zu lebenslanger Haft verurteilt.
All das wissen wir nach dem ersten Viertel dieses Romans. Nach dem brutalen Auftakt wähnen wir uns in einem Thriller, fragen uns allerdings, was jetzt noch zu erzählen bleibt – die Tat: rekonstruiert, die Täter: außer Gefecht, die Ermittler und ihre Arbeit: irrelevant. Doch auf eigenartige, kaum erklärliche Weise hat der Autor eine kühle Spannung aufgebaut, die nichts von dem benötigt, was einen Krimi ausmacht. Was uns weitertreibt, ist, was aus dem Erzähler, dem Nicht-Opfer, dem Verschonten, dem Überlebenden wird.
Existentiell betrachtet, sind wir alle »Überlebende« und können uns glücklich schätzen, solange wir wenigstens das nackte Leben genießen dürfen. Der Protagonist und Ich-Erzähler hingegen verspürt niemals ein solches Gefühl. Die Verschonung, die ihm der Zufall geschenkt hat, hat seine Seele entleert.
Das sinnlose Gemetzel (im Haus der Opfer gab es nicht einmal Beute) hat den Mann seiner Blutsverwandten beraubt. Die gewohnten affektiven Bindungen kann er nicht fortführen, nicht einmal in Trauer verwandeln. Wie er den Tatort inspiziert, bald nach dem Verbrechen in das Elternhaus umzieht, ohne die Spuren dort zu beseitigen, seinem Alltag in der Hühnerfarm der Familie nachgeht, später dem Prozess in Serbien beiwohnt, wirkt erschreckend kalt. Seine Erzählung ist reine Berichterstattung, eine Art Protokoll, reich an Sachdetails, aber ohne jede Emotionalität. Unter der routinehaften Oberfläche seines Lebens wirkt seine Existenz wie angehalten, schwebend im Nichts.
Was ihn so lähmt, ist der Täter, »lo slavo«, auch er ein »Überlebender«. Man weiß nicht viel von ihm – ein »nomade«, ein »specialista in evasioni«, der während des Gerichtsverfahrens jeden Blickkontakt vermeidet und dem Erzähler kein Wort schenkt, als der ihn Jahre später im Gefängnis aufsucht. Dieser Mensch, trotz seiner stumpfen Gewalttätigkeit ein körperloser Geist, nicht zu durchschauen, nicht zu fassen, beherrscht den Erzähler und seine Familie (Frau und Töchterchen). Seine bloße Existenz genügt, um in deren Dasein einen numinosen Horror wuchern zu lassen: Wird er ausbrechen, nach Italien zurückkehren, furchtbare Rache nehmen? Weder die Nachricht, »lo slavo« werde lebenslang inhaftiert, noch, dass er gestorben sei, nicht einmal ein Besuch an seinem Grab können die Zweifel zerstreuen, die kafkaeske Angst vor der existentiellen Bedrohung nehmen. Sie äußert sich in Albträumen voller Blutszenen, in Hoffnungslosigkeit, in dem Wunsch, den Verbrecher zu besuchen, ihm in die Augen zu sehen, ein einziges Wort von ihm zu hören. Aber die Erlösung bleibt dem Erzähler verwehrt, er findet keinen Ausweg aus seinem Gefängnis.
Seine Frau hält dem Druck nicht stand. Fünf Jahre nach der Katastrophe zieht sie mit der inzwischen siebenjährigen Tochter für einen unbelasteten Neuanfang nach Arkansas. Ihr Mann verspricht, ihnen bald zu folgen, sucht dann aber sein Heil zu Hause, im vertrauten Alltag, so hohl, schmutzig und monoton er auch sei. Ein einziger Mensch begleitet ihn immer wieder für ein Stück seines Weges, ein Journalist, dessen Artikel über das Gemetzel treffender, umsichtiger, empfindsamer waren und der auf Analogien zu dem Massaker an der Familie Clutter verwies, die Truman Capote in seinem innovativen Thriller »Kaltblütig« (1956) erzählte. »Il giornalista« unterstützt ihn über viele Jahre, reist mit ihm nach Serbien, teilt mit ihm sein eigenes Leid.
Dies ist ein Roman der verlorenen Identitäten. Keine der Figuren hat einen Namen, der Handlungsort bleibt vage (»il luogo dove vivo non esiste quasi«). Oft findet der Protagonist keine Worte, um Gefühle angemessen auszudrücken, er zieht dann vor zu schweigen. Der karge Erzählstil spiegelt seine emotionale Austrocknung. Verstörend, dass er die Abreise von Frau und Tochter wie unbeteiligt in einem Satz abhandelt, aber bis in die kleinsten Details ausführt, wie er den Gerichtsort erreicht, Holzarbeiten ausführt oder eine Wand verputzt. Umso erschütternder sind die kurzen Passagen, in denen er sich »lo slavo« zu nähern versucht und kläglich scheitert.
Das Buch hat nur den Umfang einer längeren Erzählung. Der Erzähler beschränkt sich auf Schlüsselszenen und überspringt lange Phasen aus den zwanzig Jahren erzählter Zeit. Doch bei Massimiliano Governi (Jahrgang 1962) sprechen die Auslassungen, so wie das Nicht-Erzählte mehr über die Befindlichkeit des Protagonisten offenbart als das, was er an oft Belanglosem berichtet, so wie sein Schweigen beredt ist, so wie das Nicht-Sprechen des Mörders eine verheerende Wirkung ausübt. Es sind kleine Dinge, die wiederkehren und symbolische Kraft entfalten: weiße Kieselsteinchen, die Farbe Rot, ein gelbes Blümchen, die Hühner.
Obwohl im Grunde handlungsarm und bedrückend, ist Governis Roman faszinierend zu lesen. Wir durchleben die stille Passion ständigen Scheiterns mit dem Protagonisten, werden mit ihm in heillose Abgründe gesogen und wünschen uns, dass er sich endlich befreien, einen Schlusspunkt setzen und seinen Seelenfrieden finden könne. Der Journalist verfolgt lange Zeit das Projekt, über den Fall einen Roman zu verfassen, doch gelingt es ihm nicht, ein Ende dafür zu finden, weder ein gutes noch ein tragisches. Wie der Erzähler ist selbst die Fiktion dazu verurteilt, in ewiger Schwebe zu verharren.
Ein italienischer Truman Capote? Keineswegs, trotz Parallelen in der Handlung und einigen Anspielungen. Doch Capote ging es darum, das Wesen der Mörder zu verstehen (und eine journalistische Erzählweise zu erproben). Governi lässt ein Opfer davonkommen, nur um es in ein seelisches Verlies zu stoßen.
 · Herkunft:
· Herkunft: