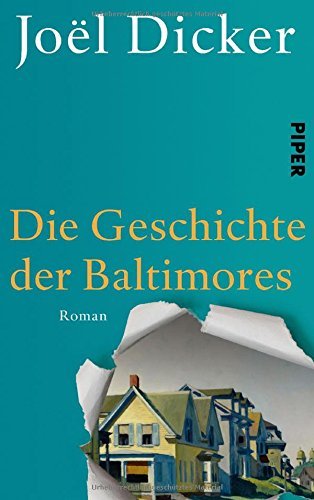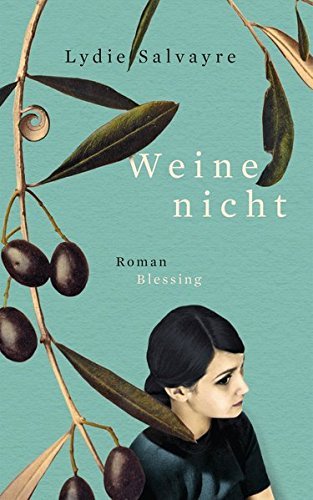
Der heiße Sommer der Umbrüche
Montserrat Monclus Arjona ist so hilflos wie 1921, als sie in einem gottverlassenen katalonischen Dorf auf die Welt kam. Die pflegebedürftige Neunzigjährige hat obendrein fast alles vergessen, was ihr langes Leben erfüllt hat. Doch vollständig intakt sind ihre Erinnerungen an den strahlenden Sommer 1936. Da entdeckte »Montse« das Leben, wurde zu einer jungen Frau, erlebte ein rauschhaftes, alle Sinne und den Verstand betörendes Abenteuer.
Viel kann eine Bauerntochter wie sie damals nicht vom Leben erwarten. Seit Jahrhunderten bestimmen die Feudalherren über das Schicksal der Landbevölkerung, halten sie ungebildet und arm. Doch Montse ist, warum auch immer, aus besonderem Holz geschnitzt. Als die Fünfzehnjährige mit ihrer Mutter bei Don Jaime Burgos Obregón vorspricht, wo eine Stelle als Hausmädchen zu vergeben ist, taxiert sie der von oben bis unten und lässt sich schließlich zu dem Urteil herab, sie sehe »recht bescheiden aus«. Während die Mutter das als Kompliment nimmt und sich artig bedankt, löst die Aussage bei Montse eine klarsichtige Analyse aus, die sie der entsetzten Mutter auf der Straße wütend entgegenschleudert. Der Satz sei eine einzige Demütigung. Niemals werde sie als gehorsames Dummchen widerspruchslos die Anordnungen der Herrschaften ausführen, ekligste Arbeiten verrichten und für einen Hungerlohn auch noch unterwürfig »muchísimas gracias« sagen – »lieber werde ich Hure in der Stadt ... Lieber sterben!«
Die Episode steht am Anfang des Romans, den Montses Tochter Lydie Salvayre nach den Schilderungen ihrer Mutter aus deren Perspektive verfasst hat. Sie beschönigt und verschweigt nichts, übernimmt mit (auch in der Übersetzung merklichem) Vergnügen das oft seltsam verballhornte und drastische Vokabular der Greisin und schafft es doch, im Ton kritische Distanz zu wahren, Charakterzeichnungen mit spitzer Feder zu erstellen, sprachliche Eigenheiten zu kommentieren, historische Fakten und Zusammenhänge zu ergänzen, zu berichten statt in wörtlicher Rede zu dramatisieren.
Das Buch soll mehr vermitteln als ein subjektiv rührendes Frauenschicksal. Es soll vor Augen führen, was Kriege abseits der großen Schlachten in den Menschen und in der Gesellschaft anrichten, wie sie jegliche menschliche Ordnung im Großen wie im Kleinen, in den Institutionen wie in den Köpfen, bei Gebildeten und Ungebildeten zersplittern und zerstören. Sie berichtet dazu von zwei Schauplätzen: Montses Dorf und Palma de Mallorca.
Dass am Tag nach der Szene der Spanische Bürgerkrieg losbricht, erweist sich für Montse als glückliche Fügung. Die Bewerbung ist vom Tisch. Ihr älterer Bruder José, der sich alljährlich in Lérima als Erntearbeiter verdingt, kehrt mit schwarz-rotem Halstuch zurück und gibt seine Begeisterung über das soeben Erlebte in ungewohnter Beredsamkeit an Mutter und Schwester weiter. Man hat dort den Großgrundbesitzer enteignet und den Boden vergemeinschaftet. Plötzlich sind die »Grundfesten erschüttert«, »die Moral auf den Kopf gestellt«, überall tönen Parolen und fordern Revolution, Brüderlichkeit, Kommunen, »Es lebe die Freiheit ... Tod dem Tod!«
Befeuert von neu erworbenem Wissen wettert José gegen »schlechte Reiche« (ein »Pleonasmus«, hat er aus der Zeitung Tierra y Libertad gelernt, da doch alle ihr Vermögen nur gestohlen haben) und gegen General Francisco Franco Bahamonde, den selbst ernannten Anführer der nationalistischen Bande. Politjargon à la Bakunin (»objektiver Verbündeter des Kapitalismus«) geht ihm genauso leicht über die Lippen wie ordinärste Beschimpfungen traditioneller Art (»pfaffenfickender Giftzwerg«). Montse hört ihrem Bruder gern zu, auch wenn sie an seine Luftschlösser einer blühenden Zukunft (»un paraíso« auf Erden) nicht glauben kann. Ihre Mutter hat den Überschwang ihres Sohnes bald satt und ermahnt ihn, lieber in die Realität zurückzukehren.
Auch die Bauern im örtlichen Café lassen sich zunächst mitreißen von Josés umstürzlerischen Ideen, berufen Versammlungen ein, debattieren unter schwarz-roten Fahnen, wollen die »Grundbücher verbrennen« und das Land kollektivieren. Doch rasch schwenken sie um, als ein talentierter Gegenspieler die Bühne betritt – Don Jaimes Adoptivsohn Diego. Obwohl nie sonderlich gelitten, gelingt es ihm, Josés anarchistisches Konzept als chancenlos zu diskreditieren. Einer nach dem anderen lässt sich überzeugen, bis am Ende nahezu alle wieder einmütig zusammenfinden, diesmal auf Diegos Moskau-konformer kommunistischer Seite. Als machthungriger neuer Bürgermeister hängt Diego ein großes Stalin-Porträt auf und wird für eine striktere Ordnung sorgen als je zuvor.
Tief enttäuscht von Wankelmütigkeit, Dumpfheit und Unterwürfigkeit der Bauern beschließt José, nach Barcelona aufzubrechen, und überzeugt seine Schwester, ihn in die »Hauptstadt der Revolution« zu begleiten. Während José dort immer mehr ernüchtert wird, das hohle Pathos der Propagandaphrasen durchschaut, die die Menschen ebenso verführen und verblenden wie die Riten der katholischen Kirche, und schließlich sein Vorhaben, sich den Milizen anzuschließen, aufgibt, wird die chaotische, weltoffene Großstadt für Montse zur Offenbarung. Sie lernt nicht nur ungeahnten Luxus kennen (elektrische Beleuchtung, fließendes Wasser für Toiletten und Badewannen, Telefon, Kühlschrank), sondern auch zügellose Freiheit (Frauen in Hosen, die mit rot lackierten Fingernägeln Zigaretten rauchen) – und die Liebe ihres Lebens, den jungen Franzosen André. Nur einen Tag und eine Nacht sind sie zusammen, dann trennen sich ihre Wege wieder, für immer. Montse kehrt wie José zu ihrer Familie zurück.
Die Ereignisse der wenigen Monate, die das Mädchen jetzt in ihrem Heimatdorf verbringt, symbolisieren geradezu das Chaos, in dem sich die spanischen Verhältnisse bis zur Franco-Diktatur auflösen. Die widerborstige Revolutionärin im Geiste, inzwischen in Kenntnis ihrer Schwangerschaft, entscheidet sich, wie ihre praktisch denkende Mutter es befürwortet, zugunsten einer guten Partie und ehelicht Diego. Der hatte schon lange ein Auge auf sie geworfen und inszeniert die Heirat ohne kirchliche Segnung als antibürgerlichen Skandal. So zieht die Schwester des Anarchisten José ins Haus des (systemischen und persönlichen) Erzfeindes Burgos ein, und zwar als Herrin. Dort lernt das Bauernmädchen die feine Kultur des alten Großbürgers Don Jaime (ihres Schwiegervaters) schätzen, eifert ihm gelehrig nach und versteht sich politisch mit dem Repräsentanten der uralten Zeiten bald besser als mit ihrem stalinistischen Ehegatten.
Kurz bevor Francos Truppen über das Dorf herfallen, gelingt Montse mit ihrer Erstgeborenen Lunita, der älteren Schwester der Autorin, die Flucht nach Südfrankreich. Nach langem Aufenthalt im Flüchtlingslager und der Geburt ihrer zweiten Tochter (der Autorin) gewöhnt sie sich zwar in den französischen Alltag ein, doch die vielen Jahre ihres weiteren Lebens verrinnen in Bedeutungslosigkeit, als »endloser Winter«.
Seine volle Wirkung entfaltet der Roman durch die Einbindung einer zweiten Perspektive. Der französische Schriftsteller Georges Bernanos, überzeugter Katholik und Konservativer, lebte von 1934 bis 1937 in Palma de Mallorca und hielt seine Beobachtungen und Reflexionen über die Bürgerkriegsgeschehnisse auf der Insel in seinem Roman »Die Großen Friedhöfe unter dem Mond« fest. Die Massenverhaftungen einfacher, anständiger Bauern, die systematischen Säuberungen, die Gewaltexzesse und niederträchtigen Tötungen vieler unschuldiger Menschen, die die nationalistische Falange anordnete und ausführte, haben ihn gezwungen, mit seinen alten Sympathien zu brechen. Entsetzt hat ihn vor allem, dass die Kirche schreiendes Unrecht und unübersehbares Grauen mit ihrem Segen reingewaschen hat (»Skandal einer Kirche, die sich mit den Militärs ins Hurenbett gelegt hat«). Als »zerrissener Zeuge« schrieb Bernanos sein Buch. Lydie Salvayre integriert Teile daraus in ihren eigenen Roman.
»Pas pleurer«  (ausgezeichnet übersetzt von Hanna van Laak) ist ein großartiges, vielschichtiges Werk, das individuelle Schicksale und nationale Geschichte, Zeitkolorit, Politik und kritische Nachdenklichkeit auf atemberaubende Weise zusammenbringt und seine Handlung faszinierend erzählt.
(ausgezeichnet übersetzt von Hanna van Laak) ist ein großartiges, vielschichtiges Werk, das individuelle Schicksale und nationale Geschichte, Zeitkolorit, Politik und kritische Nachdenklichkeit auf atemberaubende Weise zusammenbringt und seine Handlung faszinierend erzählt.
Auf einem unbedeutenden Nebenschauplatz des politischen Großgeschehens führt Lydie Salvayre die Gespaltenheit der Menschen vor Augen. Ideologiefrei, verständlich und nachvollziehbar illustriert sie aus deren Perspektive ihre einfache Denkweise gegenüber komplexen revolutionären Theorien. Am Ende obsiegt der Pragmatismus der Dörfler, mit der alten Ordnung besser zu fahren. Im größeren Kontext erleben wir, wie Kommunisten und Anarchisten durch ihre unversöhnliche Rivalität nicht nur jede Chance für eine tatsächliche Gesellschaftsveränderung verspielen, sondern auch noch der heraufziehenden Franco-Diktatur den Weg ebnen. Moralische Institutionen wie die Kirche versagen völlig.
Ganz zu Recht wurde Lydie Salvayre 2014 der Prix Goncourt, Frankreichs bedeutendster Literaturpreis verliehen.
 · Herkunft:
· Herkunft: