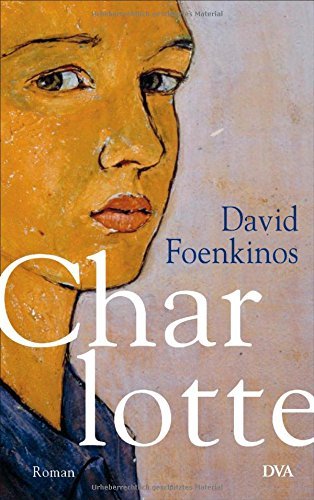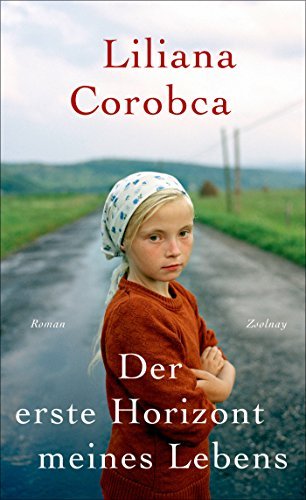
Geweint wird erst um acht Uhr abends
Cristina Dumitrache ist erst zwölf und »nichts als Haut und Knochen, dass man meinen könnte, der Wind müsse sie wegwehen«. Trotzdem füllt sie eine ganze Reihe von verantwortungsvollen Erwachsenenrollen aus. Sie ist eins von über 120.000 Kindern, die sich im wirtschaftsschwächsten Land Europas auf eigene Faust durchs Leben schlagen müssen, während ihre Eltern fern von ihnen Geld verdienen.
Moldova (Moldawien oder Moldau) ist erst seit 1991 ein unabhängiger Staat. Vorher war es eine Sowjetrepublik. Das kleine Land (34.000 qkm, 3,6 Millionen Einwohner) grenzt im Westen an Rumänien und ist in allen anderen Himmelsrichtungen von der Ukraine umgeben, mit der man wegen eines großen Landstreifens jenseits des Flusses Dnister im Streit liegt. Da die Dauermisere des Landes seinen Bewohnern keine Perspektive bietet, ist ein Viertel von ihnen zum Broterwerb ins Ausland gezogen. Von dort überweisen sie mehr Geld nach Hause, als die daheimgebliebenen drei Viertel erwirtschaften können.
Die Autorin Liliana Corobca, 1975 in Moldawien geboren, prangert in ihrem Roman »Der erste Horizont meines Lebens« (Übersetzung: Ernest Wichner) die tristen Bedingungen an, unter denen die zurückgelassenen Kinder leben, viele bei Verwandten, nicht wenige ganz auf sich allein gestellt. Das Buch kommt ohne Rührseligkeit daher, reiht vielmehr ausdrucksstark Episoden aneinander, die teils drastische bis Grauen erregende, teils zarte und poetische Szenen erzählen und reflektieren. Unberührt lässt dieser Bericht aus einem »Kinderland« (so der rumänische Originaltitel) fernab von den Problemen unserer Jugend niemanden.
Cristinas Mutter umsorgt in Italien den Nachwuchs einer italienischen Familie, der Vater ruiniert in einem verstrahlten Bergwerk Nordrusslands seine Gesundheit. Während bei den meisten anderen Kindern im Dorf noch ein Elternteil oder die Großmutter Rat und Beistand bieten können und den Haushalt versorgen, leben Cristina und ihre beiden Geschwister ohne jegliche Bezugsperson im Haus ihrer Familie: »Wir gehören niemandem.«
Haushalt, Garten und Stall in Schuss zu halten ist für ein junges Mädchen schon anstrengend genug. Hund, Kater, Schwein, ein zänkischer Hahn und zehn Hühner sind zu versorgen. Früher hielt die Familie auch Ziegen. Weil sich die störrischen Tiere von Kindern kaum melken lassen, schenkten die Eltern sie Verwandten. Die revanchieren sich jetzt ab und zu mit etwas Milch und Käse als mildtätige Gaben an die drei Kinder.
Viel komplexer ist, was Cristina für ihre Brüder Marcel (3) und Dan (6) leistet. Ihnen ist sie Ernährerin, strenge Erzieherin und wehrhafte Beschützerin. Das geht nicht ohne Konflikte mit ihnen und mit sich selbst. Um jedem gerecht zu werden, muss sie sich zerteilen. Ständig braucht der eine Trost, der andere etwas zu essen, sind kleine Wunden zu behandeln, Streitereien um Spielzeug oder einen Apfel zu schlichten. Wenn die beiden verdreckt ins Haus stürmen, das sie gerade auf Knien geputzt hat, hätte sie Lust, sie »plattzumachen«. Doch ehe sie mit dem Besen zuschlägt, bemerkt sie, wie die Brüder die Arme schützend über ihren Kopf halten, hält inne, spricht dann sanft zu ihnen und erklärt ihnen, warum sie wütend ist. Dass sie sich beherrschen konnte und die Jüngeren wie eine Lehrerin »im Geist der Sanftmut« zu erziehen fähig ist, macht sie stolz.
Von den verschiedensten Seiten drohen der Rumpffamilie Gefahren, und es sind nicht nur Prügeleien unter Jungs. Besitzrechte gelten nichts, das Recht des Stärkeren viel. Der Nachbar stiehlt ihren Spielsand für seinen Hausbau, saufende Väter misshandeln ihre Kleinen, Eltern stiften ihren Nachwuchs zum Klauen an (»Wenn ich nichts mitbringe ..., schlägt mich meine Mutter«). Nachts haben die Kinder Angst, jemand könnte in ihr Haus eindringen und das Geld, das die Eltern ihnen schicken, aus dem Versteck rauben. So gut es geht, verteidigt das rauflustige Mädchen die Brüder, schlägt Angreifer in die Flucht, ist bereit, sich »bis an die Zähne bewaffnet« schützend für sie einzusetzen (mit einem Hämmerchen zum Nüsseaufklopfen, einem Messer fürs Schweineschlachten und einem Beilchen). Im Notfall helfen Magie, Zauberei und Rituale, doch die erzeugen ihrerseits irrationale Ängste.
Cristina ist eine idealisierte Figur. Sie verhält sich einfach immer vorbildlich. Pragmatisch, ohne jedes Selbstmitleid, stemmt sie ihre täglichen Pflichten. Für ihre Hausaufgaben knapst sie etwas Zeit ab, für Lesen oder Fernsehen keine. Sie schenkt sogar vernachlässigten Jungen und Mädchen aus dem Dorf eine Art Asyl, lässt sie in ihrem Haus spielen, stillt ihren »Wolfshunger« mit eingeweichtem Brot und Zucker, gibt ihnen Kleidung mit. Auch ihre Mutter hat ärmeren Mitmenschen immer geholfen, und nun ist es an ihr, Nächstenliebe zu üben. »Seht ihr?«, führt sie ihren Brüdern vor Augen, es gibt gar nichts zu jammern, anderen Kindern geht es schließlich noch viel schlechter als ihnen. Dabei ist Cristina oft selbst zum Weinen zumute. Immerhin ist auch sie noch ein Kind, das sich nach Trost, Zärtlichkeit und Glück sehnt. Aber als die Große muss sie Verantwortung übernehmen. Geweint wird erst um »acht Uhr abends«.
Wenn die zur Frühreife gezwungene Erzählerin über gute und böse »Gedanken«, Zivilisation und Natur, den »Ort des Glücks« philosophiert, verlässt sie die Begrenzungen ihrer kindlichen Rolle in der Handlung und wird zum Sprachrohr der engagierten Autorin. Damit ist die Erzählsituation leider brüchig. Auf den ersten zehn Seiten stellt uns ein allwissender Erzähler in der dritten Person in wenigen Szenen die Protagonistin und ihr Umfeld vor, ehe mit »Liebe Eltern!« ganz unvermittelt Cristinas Brief beginnt. Da er aber in seiner von Anfang an gepflegten, ernsthaften Diktion niemals kindlich wirkt und niemals briefliche Inhalte vermittelt, sondern vielmehr auf den nachfolgenden einhundertsiebzig Seiten eher wie der Blick eines gereiften Erwachsenen auf seine Kindheit daher kommt, stellt sich die Frage nach dem Sinn der Briefform. Die Fortführung der distanzierten Erzählhaltung des Anfangs hätte Effekt und Botschaft des an Eindrücken reichen Romans keinerlei Abbruch getan.
Im Übrigen telefonieren die Kinder jede Woche mit ihrer Mutter. Die Kleinen kosten das Glücksgefühl des Kontakts voll aus. Er bringt mehr als Worte, etwa wenn Mama mit einem lauten Küsschen ein »Wehwehchen« heilt, auf das der Telefonhörer gelegt wurde. Nur die Frage, wann die Eltern endlich heimkehren, sorgt für Traurigkeit. Alle machen im Sommer im Heimatdorf Urlaub, nur Cristinas Eltern nicht. Sie wollen Reisekosten sparen und erwarten, dass der absehbare Tod der verwirrten alten Großmutter sie ohnehin bald nach Hause rufen wird.
In ihren Tagträumen kehrt Cristina in die bessere Vergangenheit ihrer Kindheit mit Vater und Mutter zurück. Als sie sieben Jahre alt war, unternahm sie mit dem Vater einen Spaziergang durch Wiesen und Wälder auf den Gipfel eines Berges. Sie hatte mit dem Finger dorthin gezeigt, wo von unten gesehen der Horizont verlief. Sie wollte hinauf zu »der Linie, die den Himmel von der Erde trennt«. Ist man erst oben, liegt allerdings ein anderer Horizont in der Ferne. Aber Cristina hatte »den ersten Horizont meines Lebens erobert«. Da ist sie glücklich und hat Kraft und Zuversicht gewonnen für die vielen Horizonte, die ihre ungewisse Zukunft noch bringen wird.
 · Herkunft:
· Herkunft: