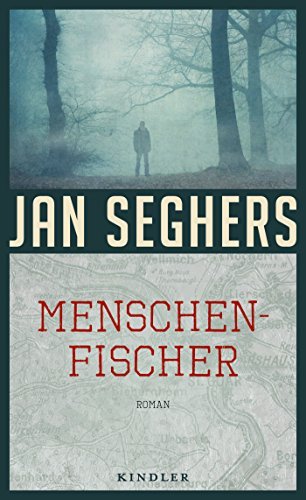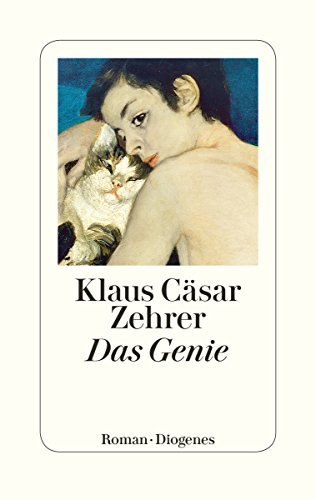
Das Genie
von Klaus Cäsar Zehrer
Außergewöhnlicher Wissenschaftler erzieht seinen Sohn konsequent zu einem Genie. Der Mensch bleibt dabei auf der Strecke.
Das Kind als Versuchskaninchen ehrgeiziger Eltern
An William James Sidis erinnert sich niemand, und nichts erinnert mehr an ihn. Dabei soll sein Intelligenzquotient höher als der des neunzehn Jahre älteren Albert Einstein gewesen sein. Als gefeiertes achtjähriges Wunderkind hatte er schon vier Bücher veröffentlicht, beschäftigte sich mit Naturwissenschaften, Psychologie und der Geschichte der amerikanischen Ureinwohner. Aber nach seinem Tod (1944, nur 46 Jahre alt) geriet er schnell in Vergessenheit.
Der Autor Klaus Cäsar Zehrer hat den Hochbegabten nun wiederentdeckt und sein Schicksal in seinem Debütroman »Das Genie« erzählt. Er gestaltet in drei Teilen eine unterm Strich triste Lebensgeschichte. Der erste erzählt den Werdegang des Vaters Boris Sidis, der zweite, wie der seinen Sohn William erzieht, und der dritte, wie sich der von der Gesellschaft enttäuschte geniale Sohn mit eiserner Konsequenz in eine selbst gesuchte Isolation zurückzieht.
Boris Sidis ist ein eigenwilliger Mensch. 1867 in eine wohlhabende jüdische Familie in Russland hineingeboren, prangert er frühzeitig »die Niedertracht der Mächtigen« im Zarenreich an und muss dafür zwei Jahre in Isolationshaft verbüßen. Im Jahr 1886 wandert er nach Amerika aus, jedoch ohne dem Traum vom leichten Reichwerden nachzuhängen. Im Gegenteil: Gleich in Manhattan entledigt er sich all seiner Habseligkeiten und ist beglückt über einen »Idealzustand, die paradiesische Voraussetzungslosigkeit eines Neugeborenen«. Geld ist ihm nichts, Bildung dagegen unverzichtbar für ein selbstbestimmtes Leben.
Unbeirrbar folgt er dieser Maxime. Mit einfachen Arbeiten schlägt er sich durch und verleibt sich das gesammelte Wissen der öffentlichen Büchereien ein. Er studiert Philosophie, promoviert an der Harvard University und sammelt Anerkennungen für seine wissenschaftlichen Leistungen. Doch weil er sich allen gesellschaftlichen Konventionen widersetzt und aus seinen kritischen Ansichten kein Hehl macht, bleibt er im Kreis der Gelehrten isoliert.
Für Freundschaft, Empathie, Liebe (»Was soll das sein?«) und Intimitäten hat Boris Sidis keine Ader. Dennoch heiratet er 1894 Sarah Mandelbaum, die sich in den attraktiven Wissenschaftler verliebt hat. Arrogant weigert er sich, »altbackene Rituale« zu befolgen, wie die Eltern der Dame um deren Hand zu bitten, aber was er vorhat, das »geht nur mit ihr«: die methodische Erziehung eines Säuglings zum Genie.
Wie der Psychologe seinen Sohn wenige Tage nach seiner Geburt systematisch und strukturiert zu prägen beginnt, mag manchen ambitionierten Eltern heutzutage nicht unattraktiv erscheinen. William lernt wie unter Hypnose oder ständiger Suggestion, aber nie unter Druck. Sein Kinderzimmer ist ein steriler, reizfreier Raum, damit die Wahrnehmung des jungen Gehirns ausschließlich auf die konsequente Schulung durch den Vater konzentriert bleibt. Der hält dem Neugeborenen zum Beispiel Bildtafeln mit einfachen geometrischen Formen vors Gesicht und verknüpft sie mit monoton wiederholten Begriffen (»Drei grüne Quadrate.«). Mit einem Glöckchen fördert er das Hören in Verbindung mit dem Ortssinn: »Das Geräusch kommt von rechts«. Während das Baby »sinnleer« vor sich hin brabbelt (oder ist das bereits eine »Art Supersprache«?), unterstützt sein Vater das Erlernen von vier Sprachen, indem er zu jeder die passende Kopfbedeckung trägt – russische Pelzkappe, englischer Bowlerhut, französische Baskenmütze, deutsches Filzhütchen.
Sarah, die Kindesmutter, ist nur anfangs befremdet (»Er kann doch noch nicht mal scharf sehen.«). Nachdem sie ihr Medizinstudium absolviert hat, steht sie voll und ganz hinter dem wissenschaftlichen Experiment, das, sollte es gelingen und anerkannt werden, dem gesamten Menschengeschlecht eine bessere Zukunft eröffnen kann. Lauter intelligente, selbstständig denkende, freie, also glückliche Individuen ...
Tatsächlich wird aus William wie geplant ein Genie. Mit zwei Jahren liest er die New York Times, mit vier kennt er Cäsars »De Bello Gallico« auswendig. Die Schule kann ihm nichts bieten, er stiftet nur Unruhe, überspringt nach und nach sämtliche Klassen, und nach dem Abschluss sind alle froh, das »besserwisserische Schwatzmaul« endlich los zu sein. Als Zehnjähriger referiert er vor Harvard-Professoren über seine Theorie der vierten Dimension. Als Elfjähriger darf er sich als ordentlicher Student immatrikulieren. Den Zwölfjährigen bejubeln die Zeitungen als »größten Mathematiker aller Zeiten«. Ist das Experiment also geglückt?
Mag sein. Aber der Blick, den uns der Autor in das Innenleben des Versuchsobjekts eröffnet, legt große emotionale und soziale Defizite offen. Die Gründe seien dahingestellt. Sind sie Folge der eiskalten Trimmung auf geistige Höchstleistung unter Vernachlässigung aller anderen Kompetenzen? Sind sie genetisch veranlagt? War die Sozialisierung unzureichend? Hat das Vorbild des empathielosen Vaters den Jungen empathielos werden lassen? Welches Kind könnte glücklich werden, wenn es sich allen Erwachsenen haushoch überlegen weiß, wenn sein Vater seine »geistesschwachen Lehrer« in einer Kampfschrift öffentlich schmäht? Wer könnte Freundschaft schätzen lernen, wenn er sich als Jüngster der Klasse von den dumpfbackigen Kameraden selbst absondert, andererseits gehänselt wird, weil er nicht einmal seine Schuhe selber binden kann und den Münzfernsprecher mit Dollarnoten verstopft? Wer würde sich bei so vielen Frustrationen nicht Rückzugsorte für seine Psyche suchen? Momente sicheren Glückes empfindet dieser Junge – und das sein Leben lang –, wenn er in der Straßenbahn durch die Stadt zuckelt.
Als William Sidis den Zenit seiner wissenschaftlichen Karriere erreicht, beginnt sein schmerzlicher sozialer Abwendungs- und privater Abkapselungsprozess. Schon dem Vierzehnjährigen ist der Umgang mit den älteren Kommilitonen, immer auf Freizeit und Ablenkung bedacht, ein Greuel. Er zieht sich in ein gemietetes Privatzimmer zurück, verfasst einen Lebensplan mit 154 Paragraphen und erlegt sich das Gelübde auf, niemals zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen. Je älter er wird, desto stärker seine Abneigung gegen Sexualität, gegen den Medienrummel um seine Person, gegen die Vereinnahmung seiner Forschungen für militärische Zwecke. Wie sein Vater eckt er aller Orten durch unwirsche Arroganz und schlechtes Benehmen an und vergrätzt noch seine letzten Förderer. Die Universitäten weisen dem Quertreiber die Tür, wenn er nicht trotzig selber kündigt. Auch mit den Eltern überwirft er sich. Am Ende bescheidet er sich in Einfachheit und Einsamkeit und arbeitet zum Beispiel als Straßenbahnschaffner.
Klaus Cäsar Zehrers Roman ist ein vielschichtiges Erzählwerk. Im Mittelpunkt des Interesses steht das Charakterbild seines ambivalenten, exzentrischen Protagonisten: ein Freidenker und Reformer, überzeugter Pazifist, Kriegsdienstverweigerer, Bolschewist und Utopist. Dessen Lebenslauf mit dem radikalen Umbruch vom gefeierten Genie zum verkrachten Sonderling ist der zentrale Handlungsstrang. Er ist eingebettet in ein umfassendes Panoptikum des amerikanischen Zeitgeistes und seines Wandels: Kriegseintritt (1917), Grippe-Epidemie (1918 bis 1920), die Veränderungen der Arbeitswelt und der Metropolen, Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Armut.
Um Vater-Genie und Sohn-Genie angemessen zu porträtieren, bedarf es wohl auch eines Autor-Genies. Zehrer hat ausführlich recherchiert und beeindruckend viel an Wissen und Esprit investiert. Das Buch wimmelt von Zitaten, fremdsprachlichen Schnipseln, unendlichen Details und Episödchen über die unbekannten und außergewöhnlichen Individuen der Familie Sidis. Die Fülle fasziniert, unterhält und bildet, fordert aber auch. Ein Buch, das zum Nachdenken über viele Themen anregt, die uns heute bewegen, wie etwa die Planbarkeit menschlichen Glücks.
 · Herkunft:
· Herkunft: