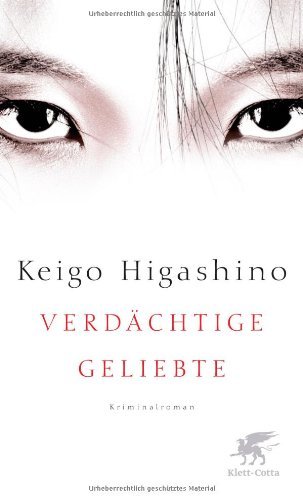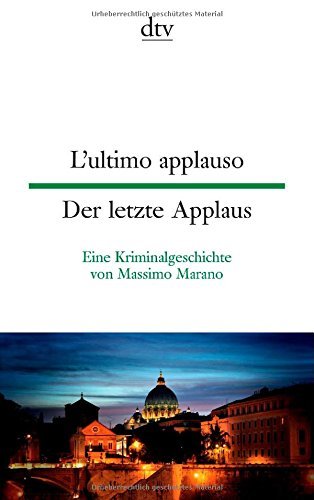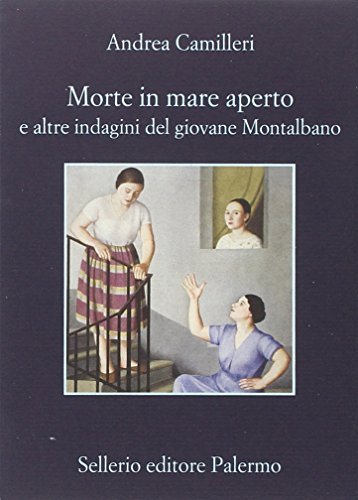Pulver im Kaffee
Die merkwürdige Ehe von Ayane und Yoshitaka Mashiba hielt nur ein Jahr. Als romantisches Bündnis fürs Leben war sie allerdings nie konzipiert. Yoshitaka, der Bräutigam, hat nicht viel am Hut mit Liebe und Schwärmerei; was er suchte, war eine »Gebärmaschine«. Deswegen koppelte er die Eheschließung an eine »Abmachung«: Sollte Ayane binnen eines Jahres nicht schwanger sein, würde die Ehe aufgelöst. Und da sich kein Nachwuchs eingestellt hat, ist die Ehefrau »so überflüssig wie ein Blumentopf«. Auch die Tatsache, dass Ayane ihn und seinen Haushalt rund um die Uhr schlichtweg perfekt umsorgt hatte, beeinflusst seine Denkweise nicht im Mindesten.
Bevor die Trennung vollzogen wird, möchte Ayane für ein verlängertes Wochenende zu ihren hilfebedürftigen Eltern nach Sapporo reisen. Damit Noch-Ehemann Yoshitaka keinen Nachteil erleidet, übergibt sie ihrer besten Freundin Hiromi die Hausschlüssel, auf dass sie gelegentlich bei ihm nach dem Rechten sehe.
Während Ayanes Abwesenheit wird die Ehe scheidende »Abmachung« unerwartet hinfällig, denn der Tod spricht sein unumstößliches Machtwort. Beim Kaffeetrinken im großzügigen Salon seiner eleganten Villa wird Yoshitaka eine Dosis Arsen zum Verhängnis. Hiromi findet den Leichnam am Boden liegend und verständigt sogleich die Polizei. Kommissar Kusanagi und seine Kollegin Utsumi übernehmen den Fall.
Schnell stellt sich heraus, dass Hiromi und Yoshitaka schon seit Längerem ein Liebesverhältnis unterhielten. Könnte es sich so unerträglich entwickelt haben, dass Hiromi den Geliebten umgebracht hat?
Die zweite Verdächtige ist naturgemäß Ehefrau Ayane. Man informiert sie vom Tod ihres Mannes, und Kommissar Kusanagi holt sie persönlich am Flughafen ab. Vom ersten Augenblick an nimmt ihre faszinierende Erscheinung ihn gefangen. In ihrer Villa befragt er sie nach Details, insbesondere danach, wie im Haushalt üblicherweise Kaffee zubereitet wurde. Das Gift könnte ins Kaffeepulver, ins Leitungswasser, in den Wasserkessel gemischt worden sein.
Leicht befremdet ist Kusanagi darüber, wie herzlich Ayane ihrer Freundin Hiromi begegnet. Sie umarmt und tröstet die emotional aus der Bahn geworfene Rivalin, als wisse sie gar nicht um deren Verhältnis zu ihrem Mann. Oder täuscht Ayane mit eiskalter Berechnung Ahnungslosigkeit und Unschuld vor? Aber sie hat ja ohnehin ein wasserfestes Alibi in Sapporo.
Lange will Kommissar Kusanagi, bis zur Blindheit eingenommen von der schönen Witwe, einfach nicht wahrhaben, dass sie in den Giftmord an ihrem Mann verwickelt sein könnte. Kollegin Utsumi hat da erheblich größere Zweifel; sie hält Ayane für eine besonders raffinierte Mörderin. Doch wie soll man ihr auf die Schliche kommen, wenn nicht einmal die Spurensicherung die geringsten Erkenntnisse zutage fördern konnte, wie zum Beispiel darüber, auf welchem Weg das Arsenpülverchen in die Kaffeetasse fand?
In dieser Notlage wendet sich Utsumi an Professor Yukawa. Der hatte bereits in einem anderen Fall (über eine »Verdächtige Geliebte«) die richtigen Hinweise gegeben [› Rezension]. Eigentlich wollte er danach nichts mehr mit polizeilichen Ermittlungen zu tun haben, aber Utsumi zuliebe lässt er sich breitschlagen, ihr zu helfen – unter der Bedingung, dass Kommissar Kusanagi nichts davon erfährt. Professor Yukawa ist überzeugt, dass Ayane irgendeine Form von »Trick« angewandt hat, und er nähert sich der Lösung des Rätsels durch »das Ausschlussverfahren« ...
Sonderlich spannend ist der zweite Kriminalroman des japanischen Autors Keigo Higashino nicht, weder in kriminalistischer noch intellektueller Hinsicht. Wer Yoshitaka vergiftet hat, steht nach wenigen Seiten fest. Bleiben die Fragen, wie er das angestellt hat und wie es ihm nachzuweisen ist. Der Roman ist darauf angelegt, dass der Täter quasi ohne verräterische Utensilien, ohne weitere Personen zu involvieren und ohne Spuren zu hinterlassen, einen »perfekten Mord« inszeniert habe. Wie bei den bekannten Puzzles, bei denen man aus einem halben Dutzend Holzplättchen ein Quadrat formen soll, muss die Lösung also förmlich vor Augen liegen. So wie man nicht viel mehr tun kann, als die Puzzleteilchen immer wieder hin und her zu schieben, debattieren die Ermittler unentwegt wie um des Kaisers Bart, ohne dass neue Bausteinchen ins Spiel kommen. Dieses minimalistische Konzept hat einfach nicht genug Kraft, um den Leser über dreihundert Seiten zu fesseln. Der Täter wird denn auch nicht durch eine bewundernswerte Intelligenzleistung, sondern eher zufällig überführt. Und wenn das »Wie« am Ende vollständig aufgedeckt ist, bleiben leise Zweifel, ob das alles einer kritischen sachlichen Prüfung wirklich standhalten könnte.
Mit den Denksportaufgaben seines Debütromans »Verdächtige Geliebte« konnte Keigo Higashino die Fans intellektuell anspruchsvoller Kopfkrimis begeistern. Die »Heilige Mörderin« (übersetzt von Ursula Gräfe) fällt dagegen deutlich ab. An den Erstling erinnert die spröde Zeichnung der Figuren, denen emotionale Tiefe, Empathie und charakterliches Profil fehlen und die wie auf einem Schachbrett bewegt werden. Wo der Autor jetzt auch noch ihre Lebenswelt eindampft, bleibt zu wenig Substanz.
 · Herkunft:
· Herkunft: