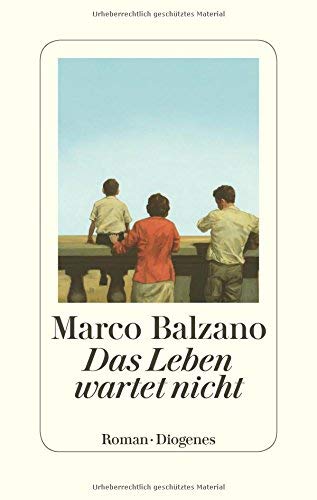Der Lärm der Zeit
von Julian Barnes
Im Mai 1937 wartet ein Mann jede Nacht neben dem Fahrstuhl seiner Leningrader Wohnung darauf, dass Stalins Schergen kommen und ihn abholen. Der Mann ist der Komponist Schostakowitsch, und er wartet am Lift, um seiner Familie den Anblick seiner Verhaftung zu ersparen. Im neuen Roman von Julian Barnes wird das von Repressionen geprägte Leben von Schostakowitsch in meisterhafter Knappheit dargestellt – ein großartiger Künstlerroman, der die Frage der Integrität stellt und traurige Aktualität genießt.
Ein steiniger Weg
Dmitri Schostakowitsch, einer der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts, hatte das Unglück, in einer Zeit und in einem Land zu leben, wo er es niemandem recht machen konnte, selbst wenn er das gewollt hätte. Das außergewöhnliche Talent, 1906 geboren, entwickelte bereits als Jugendlicher eine klare musikalische Persönlichkeit und starke innovative Schubkraft, die ihm schnell einen weltweiten Ruf verschaffte. Seine zweite Oper, »Lady Macbeth von Mzensk«, wurde 1934 in Leningrad uraufgeführt und blieb dort zwei Jahre mit großem Erfolg auf dem Spielplan. Zuvor hatten zwei Ballette und drei Sinfonien den Ruhm des noch nicht einmal Dreißigjährigen begründet.
In den Jahren seines Aufstiegs hatten allerdings auch die Nachfolger der Oktoberrevolutionäre ihre Herrschaft gefestigt und ein grausames Regime der Willkür und des Schreckens errichtet, das seine Untertanen mit bis dahin ungekannter Rigorosität kontrollierte. Bespitzelung, Verhöre und Folter unterdrückten jegliche Kritik im Keim. So lange man in künstlerischem Schaffen hinreichendes Engagement für die Erfolge der Ideologie erkennen konnte, genoss es das Wohlwollen der Herrschenden, andernfalls wurde es schlichtweg verboten.
Schostakowitsch konzipiert sein Werk keineswegs einsinnig. Zwar stellt er sich mit seiner zweiten Sinfonie, einer Auftragsarbeit zum zehnten Jahrestag der Revolution, in den Dienst von Stalins Diktatur, versteckt darin aber dennoch Kritik an den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen. Die Methode, durch geschicktes Erzeugen und Arrangieren von Stimmungen, durch Anspielungen und Aufgreifen unerwünschter Traditionen Kritik zu vermitteln, bleibt auch den Zensoren nicht verborgen, so dass die erste Oper »Die Nase« (1930) und das Ballett »Der Bolzen« (1931) nach kurzer Zeit abgesetzt werden.
Das Schicksal des Komponisten wendet sich endgültig, launenhaft und aus geradezu trivialen Gründen, als »der Stählerne«, wie Stalin sich selbst benannte, am 16. Januar 1936 einer Aufführung der kommunistischen Vorzeigeoper im Bolschoi-Theater beiwohnt. Hinter einem Vorhang verborgen, von Stahlplatten gegen Attentatsversuche geschützt, missfällt dem Diktator zutiefst, was an sein Ohr dringt. Es sind vor allem die fortissimi der Schlagzeuger und Blechbläser, die unterhalb seiner Loge ihr Bestes geben. Von aller Welt gefeiert oder nicht, die Oper vertreibt den Diktator verärgert aus dem Theater. Binnen kürzester Zeit schwenkt die bis dahin enthusiastische offizielle Kritik im Sinne Stalins um. »Chaos statt Musik« und von verfemten Ideologien geprägt sei das Werk, und das Leben seines Schöpfers hängt am seidenen Faden.
Julian Barnes hat über das Leben dieses bedeutenden Künstlers und bemerkenswerten Menschen einen aufwühlenden, desillusionierenden Roman geschrieben. Indem Schostakowitsch stets seinen eigenen Weg ging, war er den einen zu wenig parteikonform, zu wenig heroisch, verherrlichte beispielsweise zu wenig die Siege der Roten Armee, während er gleichzeitig den anderen zu regimeergeben, zu unkritisch, zu undistanziert war. So fiel er allseits in Ungnade, wurde zwischen Ideologien zerrieben.
Nach Stalins vernichtendem Urteil verbringt der Komponist die Nächte wie viele seiner Landsleute bekleidet auf gepacktem Koffer, denn die Agenten der Geheimpolizei NKWD »holten einen immer mitten in der Nacht«. Die Vorbereitung auf das Schlimmste, die Sorge um seine Frau und die einjährige Tochter Galja, die man zur Umerziehung in ein Waisenhaus für Staatsfeinde stecken würde, lassen an Schlaf nicht denken. Gleich beim »Anblick der Uniform«, dem »Nicken des Erkennens« würde er den eintreffenden Beamten seine Pianistenhände entgegenstrecken, damit sie ihn schnell wegbringen, ohne seine Familie zu gefährden.
So wie die Gedanken des Künstlers zu jener Zeit auf jedes Geräusch, jedes Wort, jedes Ereignis hin unaufhaltsam wandern, so wie sie Jahrzehnte später zurück zu den verschiedenen Phasen und Themen seines Lebens schweifen, so arrangiert der Autor sein vielfältiges Material in überschaubaren Textpäckchen. Erzählungen, Berichte, Dokumente, Protokolle wechseln einander ab wie die zeitlichen Ebenen der bewegten Vita dieses außergewöhnlichen wie umstrittenen Mannes, dem gerecht zu werden nicht leicht ist.
Die Häppchenkost ist abwechslungsreich, doch schwer verdaulich, lasten doch über allem die immer drückendere, lebensbedrohliche Staatsmacht und die Depression, die ihr unberechenbares, menschenverachtendes Handeln bald bei ihrem Spielball und Opfer auslöst. Wo jeder, Verwandter, Freund oder Fremder, sich als Feind erweisen kann oder für vorgebliche Sünden eines anderen bezahlen muss, geht jegliche Gewissheit, jede moralische Orientierung leicht verloren.
Nachdem man Schostakowitsch die Lebensgrundlage entzogen hat, wird der »Volksfeind« immer wieder vorgeladen und zu seinen »Freunden« verhört. Gab es Einladungen mit politischen Themen, Hinweise auf das Mordkomplott des Rote-Armee-Marschalls Tuchatschewski gegen den Genossen Stalin? Längst sind alle im Umkreis des Marschalls vom Erdboden verschwunden und hingerichtet. Was immer er jetzt aussagt, würde den tödlichen Kreis erweitern. War er also nicht selbst schon tot, da auch ihn jederzeit jemand als Komplize eines Attentäters denunzieren konnte, so wie er unter Folter allem sofort zustimmen, »alle mit hineinziehen« würde?
Doch die Macht lässt den weltberühmten Musiker leben, um ihn als Mensch zu zermürben und für ihre Zwecke gefügig zu halten. 1949 wird er nach New York entsandt, um streng überwacht de Sowjetunion bei der »Friedenskonferenz internationaler Wissenschaftler und Künstler« zu repräsentieren. Ihn befremdet die Unverfrorenheit, mit der die jubelnden Menschen ihn »im Vollgefühl überlegener Werte« bedrängen: »Hey, Schosti, lächeln!« Auf der anderen Seite verweigert ihm der Exilant Strawinsky den Wunsch einer Begegnung. Mit »sowjetischen Künstlern« wolle er nichts zu tun haben. (Die Verachtung wird später eine gegenseitige, wenn Schostakowitsch seinem Landsmann vorhält, er habe in gleichgültiger Ruhe auf »seinem amerikanischen Olymp gethront«, während in Russland Hetzjagden auf seine Künstlerkollegen und deren Familien veranstaltet wurden.) Gleichzeitig durchlebt der »Star« der sowjetischen Delegation sein eigenes Fegefeuer der Zweifel, empfindet nichts als »Ekel« und »Verachtung« für seine Rolle, die ihm keine freie Rede gestattet. Er verliest einen vorgefertigten Text über seine achte Sinfonie, der zu Hause »ungesunder Individualismus« und »Pessimismus« angelastet wird, verspricht, künftig »melodische Musik für das Volk« abzuliefern, wie die Partei es wünscht, ergänzt immerhin, »immer und aufrichtig« Musik geschrieben zu haben, die nicht »gegen das Volk« sein könne, da doch auch er selbst in gewisser Weise ›Volk‹ sei. Die Rede ist ein großer Erfolg, doch Stalin ist erbost, lässt weitere Repressalien folgen, und der gebrochene Mann zieht sich ins Private zurück, um Präludien und Fugen zu komponieren. Der einzige Weg, um nicht den Verstand zu verlieren?
Dass Dmitri Schostakowitsch als Marionette der Macht weiterleben sollte, ist ein bitterer Sarkasmus des Schicksals. »Statt ihn umzubringen, hatten sie ihn leben lassen, und indem sie ihn leben ließen, hatten sie ihn umgebracht.«
Nach Stalins Tod 1953 folgt unter Nikita Chruschtschow eine Zeit des »Tauwetters«. Doch der Künstler wird nur zum Spielball eines neuen Machthabers. Mit Preisen und Ehrungen überschüttet, gibt Schostakowitsch schließlich dem Druck der Macht, die ihn zertrümmert hatte, nach und tritt ohne große Not in die Partei ein. Den Kommunisten Picasso kritisiert er als reichen Feigling, der »seine ekelhafte Friedenstaube malt«, unterschreibt aber selbst einen widerlichen Brief gegen den oppositionellen Schriftsteller Alexander Solschenizyn, den er bewundert und gegen den er sich dennoch einspannen lässt. »Der Lärm der Zeit hatte ihn taub gemacht.«
Schostakowitschs steiniger, gefährlicher Weg zwischen sich anpassen, sich arrangieren, sich vorsichtig widersetzen ist hinreichend erforscht und erörtert, auch fiktional verarbeitet, zum Beispiel in Sarah Quigleys Roman »Der Dirigent« (2012) [› Rezension]. Was kann Julian Barnes an Lesenswertem hinzufügen?
Neben der Vielfalt der Textsorten ist es insbesondere der unglaublich eindringliche Stil, der dem Leser die düstere Zeit vermittelt und auf dem schmalen Grat voranschreiten lässt, der dem Menschen und Künstler Schostakowitsch für die Gestaltung seines Lebens und seiner Kunst blieb. Es ist die Kraft seiner Worte, in unscheinbar einfache, kurze Sätze gefasst, die gewaltige Aussagen transportieren. So ist mit »The noise of time«  , übersetzt von Gertraude Krueger, eine Biografie sui generis in Moll entstanden, die die deprimierende Atmosphäre eines Tagebuchs mit der grausamen Sachlichkeit von Protokollen und Dokumentationen verbindet und viele Fragen offen lassen muss. Der Leser wird von philosophisch relevanten Gedanken ebenso gefesselt wie von Ironie und bitterem Sarkasmus, wenn etwa von westlichen »Humanitätsaposteln« berichtet wird, die genehmigte Russlandreisen unternehmen, um den »echten Russen« kennenzulernen. Bis zur letzten Seite bleibt dieser Roman packend.
, übersetzt von Gertraude Krueger, eine Biografie sui generis in Moll entstanden, die die deprimierende Atmosphäre eines Tagebuchs mit der grausamen Sachlichkeit von Protokollen und Dokumentationen verbindet und viele Fragen offen lassen muss. Der Leser wird von philosophisch relevanten Gedanken ebenso gefesselt wie von Ironie und bitterem Sarkasmus, wenn etwa von westlichen »Humanitätsaposteln« berichtet wird, die genehmigte Russlandreisen unternehmen, um den »echten Russen« kennenzulernen. Bis zur letzten Seite bleibt dieser Roman packend.
 · Herkunft:
· Herkunft: