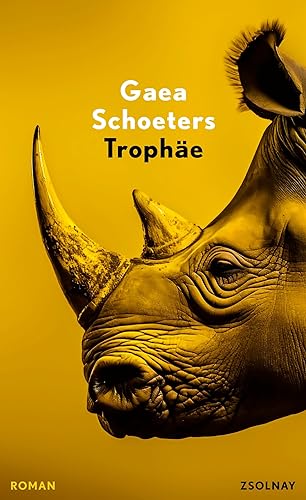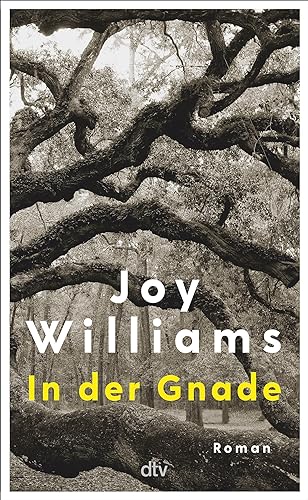
In der Gnade
von Joy Williams
Die Tochter eines gestrengen, übermächtigen Reverend versucht, seinem Einfluss zu entkommen und ein eigenständiges Leben zu führen, doch beides gelingt ihr nicht.
Der allmächtige Vater
Joy Williams wurde 1944 in Neuengland geboren und hat bis heute zwölf Bücher unterschiedlicher Inhalte veröffentlicht. Im Jahr 1973 erschien ihr Debütroman »State of Grace«, er wurde hochgelobt und für den National Book Award nominiert, aber erst jetzt, nach fünfzig Jahren, in der Übersetzung von Julia Wolf auf Deutsch herausgebracht.
Der schwer fassbare Plot, wie er sich über drei »Bücher« entwickelt und mehr durch Persönlichkeiten und Befindlichkeiten als durch Ereignisse, Kausalitäten und zielgerichtete Handlungen herausbildet, erklärt sich in seinen Grundzügen vielleicht aus der Biografie der Autorin Joy Williams. Sie ist – wie ihre Protagonistin Kate – Tochter eines Pfarrers aus Neuengland, floh nach Florida, heiratete und lebte in einem Wohnwagen, verborgen in dunklen Wäldern, und gebar ein Kind. Alles, was die Autorin sich wohl für ihr Leben ersehnt hatte, treibt auch Kate an: Zwängen entkommen, sich selber finden, ein Leben in Freiheit und Ungebundenheit führen. Im Roman kommt es leider enttäuschend anders.
Im ersten Buch lesen wir über hundertzwanzig Seiten hinweg, wie eine namenlose Ich-Erzählerin in den Sümpfen am Golf von Mexiko zusammen mit einem lebensfrohen jungen Mann namens Grady in einem Wohnwagen haust. Erst später stellt sich heraus, dass er ein Student der Naturwissenschaften und seit Kurzem ihr Ehemann ist. Ein symbolischer Ring aus Holz verkörpert den Familienstand. Ein Kind ist unterwegs. Die junge Frau hat Angst, aber nicht vor Grady. »Wir sind verliebt«, konstatiert sie, doch ihre Gedanken gehen in eine andere Richtung: »Natürlich wäre es das Beste, wenn er uns tötet, also Daddy und mich. Ich werde nämlich das verrückte Gefühl nicht los, dass wir sonst ewig so weitermachen. Aber dafür ist es nun zu spät. […] Selbst wenn er hinführe, er würde Daddy nicht finden [und wenn, dann] würde er nicht mit ihm fertigwerden. Immerhin hat Daddy die Religion auf seiner Seite, und damit Gott und den Teufel.«
Nach dieser Einstimmung auf die Grundmotive (Seite 8) folgt eine Unmenge kleiner Szenen mit wechselnden Figuren und Schauplätzen, mit eingestreuten Bibelzitaten, sinnlichen Naturbeschreibungen, naiven Wunschfantasien von einem späteren glücklichen Familienleben im Wohlstand mit stylischem Baumhaus und Land Rover. Die erinnerten Szenen wirken teils wie im Traum erlebt, teils brutal realistisch, teils symbolstark, teils ordinär bis ekelhaft; sie folgen unchronologisch, kontrastiv, assoziativ aufeinander. Dabei behauptet die Ich-Erzählerin: »Der Sinn für die richtige Ordnung der Dinge ist mir angeboren, wie ein Uhrwerk bestimmte er meine Kindheit.« Die aber, so der Grundton, war geprägt von einem übermächtigen, eigenartigen Vater, aus dessen Einflusssphäre sie sich zu befreien sucht, ohne es je zu schaffen. Frühzeitig weiß Kate: »Ich habe keine Zukunft.« Viele Seiten später wird der Roman damit enden, dass Kate nach Hause zurückkehrt, und »Welch ein Frieden.« wird der letzte Satz sein.
Dabei hat die junge Frau in ihrer frühen Auszeit am Golf von Mexiko durchaus an Leben und Werten ihrer Kommilitoninnen teilgenommen, allerdings ohne daraus Befriedigung zu ziehen. In einer umfangreicheren Sequenz erzählt sie, wie sie Grady in sein College begleitet und dort einige frühere Mitbewohnerinnen aus dem Wohnheim wiedertrifft. Offenbar hat sie ihr Studium mit der Ehe aufgegeben und sich seither vollständig von ihren oberflächlichen Altersgenossinnen entfremdet. Wie der Prozess einer Entfremdung von der Realität erscheint auch, wie Kate in einem längeren Gespräch mit einem Polizisten versucht, einen mysteriösen Unfall zu begreifen, in den Grady mit seinem geliebten Jaguar verwickelt war.
Im zweiten Buch erfahren wir Erhellendes aus der Familiengeschichte, jetzt aus der distanzierteren Perspektive der dritten Person. Vater Reverend Jason Jackson zieht mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern auf eine winzige Insel, die aus nur einem Ort besteht. Die dortige Gemeinde ist seit Jahren von Gott und der Welt vernachlässigt. Der Vater ist eine höchst markante, furchteinflößende Erscheinung, geprägt von einem kaputten Auge ohne Lid. Es »stand immer offen und glotzte gleißend blau und unermüdlich in die Welt«. Nur wenn Daddy allein mit seinem Herrn ringt, »gequält und aufgewühlt«, umtost von Sturm und Gischt, verhüllt er es schützend mit einem Schal. Bald sterben Kates »süßes« Schwesterchen und die dem Wahnsinn nahe Mutter, und Kate lebt alleine mit diesem dämonischen, erdrückend präsenten Mann »in seinem Turmzimmer«, »so finster und undurchschaubar«. Obwohl er sich ihr im Alltag durchaus freundlich und anteilnehmend widmet und sie sich artig, zutraulich und wissbegierig gibt, fühlt sie sich vor ihm wie ein nichtiges Insekt im Netz einer riesigen Spinne, glaubt zu einem präkonzeptionellen Nichts zu schrumpfen. Er »sah mein Leben, ehe ich es überhaupt gelebt hatte, und er wusste, jeder Schritt, den ich tat, würde mich am Ende nur wieder nach Hause bringen«. Argwöhnisch beäugen die kinderlosen, von der Eintönigkeit ihres Insellebens abgestumpften Inselbewohner, wie der Reverend mit seinem siebenjährigen Kind umgeht, sie unterrichtet, wie Kate mit »unerträglicher Ausdruckslosigkeit« Passagen aus der Bibel rezitiert: »So ein unangenehmes Kind … der Hauch des geweihten Verbrechens umgibt sie – die Aura einer geweihten Hure … Sie spiegelt einzig ihren Vater.«
Im dritten Buch kehren wir mit Kate als Ich-Erzählerin zurück ins College-Wohnheim. Das Jahr, in dem sie und Grady »wie Eheleute« im Airstream-Wohnwagen im Wald gelebt haben, ist mit dem schweren Autounfall zu Ende gegangen. Nun vergegenwärtigt sie sich wie im Traum frühere Balkonszenen mit ihren hohlköpfigen, auf Äußerlichkeiten fixierten Mitstudentinnen, als sie beispielsweise auf der Straße den mittellosen Schwarzen Corinthian Brown beobachten. Er ist auf dem Weg zu dem Schrottplatz, wo er Autowracks bewacht. Wegen seiner Hautkrankheit säuselt eine der Studentinnen mit süßlicher Stimme: »Dermatitis-Dödel, willst du nicht hochkommen und den Mädchen helfen, Brownies zu machen?«
Dabei ist Corinthian Brown ein wahrer Freund von Kate. »Er beschützt einfach die Dinge, die bereits besiegt und zerstört wurden«, und genießt es, in den besseren Limousinen zu sitzen und gute Bücher zu lesen. Außerdem hat er einen weiteren Job und versorgt die Tiere in einem kleinen Zoo.
Unzweifelhaft belegt dieser Roman Joy Williams’ außergewöhnliches Sprachvermögen. Die Erzählkraft der Autorin ist beeindruckend, viele Szenen bestechen und bleiben im Gedächtnis. Die Charakteristiken der Haupt- und Nebenfiguren sind einfallsreich, teilweise poetisch, ebenso wie viele Beschreibungen der Schauplätze. Nach dem Tod der Mutter etwa durchschreiten wir Zimmer für Zimmer des leergeräumten Pfarrhauses, bis wir in der Küche auf Kate treffen, wie sie »fiebrig und nachdenklich« trockene Cornflakes isst. »Das Ölgemälde lehnte an der Wand.«
Dennoch lohnt das betagte Werk die späte editorische Mühe meines Erachtens nicht mehr so ganz. Stilistisch, erzählerisch und thematisch finde ich es allzusehr seiner Zeit verhaftet, dazu uneingängig, schwer verständlich, bisweilen rätselhaft. Was in den Siebzigerjahren innovative und provokante Formulierungen und Chiffren gewesen sein mögen, hat heute bisweilen Reiz, Relevanz und Originalität eingebüßt.
Obendrein stößt mich (ganz zeitunabhängig) ab, wie die Autorin deutliche Schwerpunkte bei absurd-spleenigen Ideen, schockierenden Verunglimpfungen, obszönen Verstörungen setzt (»eine Vulva aus Plastik« als Anstecknadel, »Eiter in der Kirschtorte«, »in den Weißwein gepisst« und Schlimmeres im Top-Restaurant), um eine überspitzt düstere Atmosphäre zu schaffen. Was leistet ein winziges Detail wie das, der Schrotthändler und Arbeitgeber Corinthian Browns habe »seine erste und letzte Frau getötet, indem er ihr Gesicht zu fest in eine heiße Pfanne mit Essen drückte, das ihm nicht schmeckte«? Oder Kates ausführliche Schilderung, wie eine Touristin im Rolls-Royce die Windel ihres kleinen Jungen wechselt und seine Exkremente detailliert analysiert? Zum Verständnis vieler Szenen aus Kates Fantasie muss man wohl Freud und die Tiefenpsychologie heranziehen, etwa um die Geheimnisse der Tochter-Vater-Beziehung, aber auch von Einzelbildern wie das der »Fische, die in den Mündern ihrer Mütter geboren werden und sich bei Gefahr dorthin zurückflüchteten«, zu erahnen.
Kates Vater steht von Anfang bis zum Ende zwischen ihr und dem praktischen, zuversichtlichen Grady. Ihr ist das bewusst, es liegt schwer auf ihrer Seele, sie möchte Grady reinen Wein einschenken (»Ich muss dir von Vater erzählen.«), aber es kommt nie dazu. So erfährt Grady gar nicht, dass der Reverend so furchteinflößend war, dass Kate einst die Flucht vor ihm ergriff. Als der Vater später nach ihr sucht, um sie zurückzuholen, findet er sie in einem billigen Motel. »Was solltest du suchen, mein Liebling, was dich von mir fortführt?«, fragt er seine Tochter. Ihre Antwort: »Das sage ich dir, Daddy: Liebe. Ich habe Liebe gesucht.«
 · Herkunft:
· Herkunft: