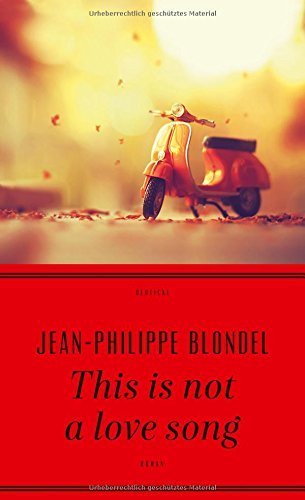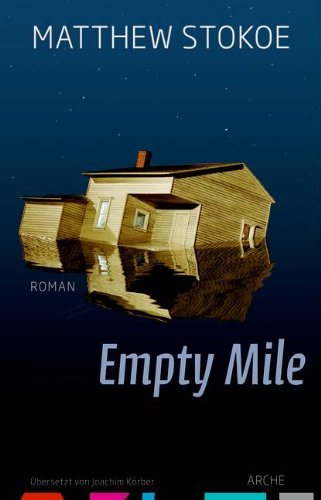Augen zu und durch
»Mein rechter, rechter Platz ist frei.« Und es ist der einzige im Abteil des Morgenzuges, mit dem Cécile Duffaut von Troyes nach Paris reist. Würde sie den Kindergartenreim kennen und mitspielen, so würde sie in seiner Fortführung (»Ich wünschen mir ... herbei.«) viele, aber niemals Philippe Leduc als Sitznachbarn auswählen.
An diesem frühen Montagmorgen ist Cécile in äußerst schlechter Stimmung. Der Wochenendbesuch bei ihren Eltern war eine Strapaze. Die alten Leutchen werden immer verbitterter, die Tochter-Eltern-Beziehung verspannter. In Paris erwarten sie – die Chefin eines expandierenden Unternehmens – eine anstrengende Arbeitswoche und ein weiteres kriselndes Verhältnis, das zu ihrem Ehemann Luc, der in der Partnerschaft zurückstecken muss. Eine Wohltat, dass der Sitzplatz neben ihr unbesetzt ist ... aber warum ausgerechnet der, fragt sich Cécile. Riecht sie? Ist sie hässlich? Wirkt sie einschüchternd?
Während ihre Gedanken schweifen, tritt ein Mann ins Abteil, gewahrt die einzige Leerstelle, fragt pro forma »Entschuldigen Sie, sitzt neben Ihnen schon jemand?« und lässt sich neben Cécile nieder. Ihr resignierter flüchtiger Blick genügte, um ihn wiederzuerkennen: Es ist Philippe Leduc, tatsächlich der Allerletzte, dem sie in ihrem Leben noch einmal begegnen wollte.
Mehr als ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit sie sich zuletzt sahen, als Zwanzigjährige. Obgleich auch Philippe sofort weiß, wen er sich da als Reisebegleiterin an Land zieht, reagiert er nicht etwa mit einem blitzschnellen Rückzieher in den Gang, sondern springt ins eiskalte Wasser. Umgehend werden beide in ihre Gedanken abtauchen, einander eineinhalb Stunden lang den unbekannten Fremden mimen und die Zugfahrt schweigend nebeneinander verrauschen, bis endlich, kurz vor Paris, doch noch ein paar Worte dieser feigsten aller Kommunikationsvarianten ein erlösendes Ende schenken: »Es tut mir unendlich leid.« (Philippe) – »Es ist viel zu spät, um unsere Bekanntschaft aufzufrischen.« (Cécile)
Wo der äußere Handlungsspielraum auf knapp zwei (dahinrasende) Quadratmeter verengt ist und der Soundtrack nichts als gedämpft säuselnden Fahrtwind und gelegentlich quietschende Bremsen zu bieten hat, schließt Jean-Philippe Blondel dem Leser seines Romans »06h41«  (übersetzt von Anne Braun) gleich zwei simultane Innenwelten auf, zwischen denen wir hin und her pendeln. Zwei einstmals eng verbundene Menschen begegnen einander unverhofft und ungewollt, und es entwickelt sich eine Art stummes Kammerspiel.
(übersetzt von Anne Braun) gleich zwei simultane Innenwelten auf, zwischen denen wir hin und her pendeln. Zwei einstmals eng verbundene Menschen begegnen einander unverhofft und ungewollt, und es entwickelt sich eine Art stummes Kammerspiel.
So gut man sich einst kannte, so fremd sind sich nun die beiden Protagonisten. Nach der heimlichen äußerlichen Inaugenscheinnahme fällt jeder sein Urteil über den anderen, dann belauert, beschnuppert man sich vorsichtig weiter, ist eigentlich interessiert am anderen, hofft auf ein erstes Wort, das das Eis brechen könnte, und fürchtet es gleichzeitig, denn egal wie ein Gespräch seinen Anfang nähme, es kann nur peinlich werden.
Was war Philippe doch früher für ein arroganter Schönling! Die einstige, von den Mädchen angehimmelte Pracht ist dahin. Mit schütterem, ergrauendem Haar, schlaffem Bewegungsapparat und Bierbauch findet Cécile ihn jetzt bemitleidenswert.
Was ist nur aus dem hässlichen Entlein geworden? Philippe war damals froh, als er die unscheinbare Cécile, nicht mehr als ein Durchschnittsmodell, nach knapp drei Monaten wieder los war. Zugegeben, sie als »Ameise auf einem Rasenstück« zu bezeichnen war, wie vieles andere, schon sehr verletzend ... wenn auch ein Nichts im Vergleich zu dem Überding, das er sich dann in London leistete. Wo er Cécile jetzt als gut aussehende, selbstsichere Powerfrau in den besten Jahren im Augenwinkel hat, tut ihm das, was längst vergessen war und nun wieder hochwabert, leid.
Aus den alternierenden Innenansichten der beiden Reisenden fügt sich ein Gesamtbild. Es umfasst die Vergangenheit der beiden Gymnasiasten in Troyes und die Jetztzeit, in der sie ihr Aus- und Ansehen gewissermaßen getauscht haben. Während Cécile mit dem entwürdigenden Wochenende in London ihre schlimmste Niederlage und Demütigung durchlitt, fällt Philippes Resümee seiner Gegenwart enttäuschend aus. Beruflich hat er es nicht weiter als zum Fachverkäufer für TV-Geräte gebracht; seine Frau ist mit Kind, Kegel und fliegenden Fahnen zu einem anderen übergelaufen, einem Arzt, der der Familie ein wohliges Nest bieten kann. Ein einziger Freund ist Philippe verblieben, der Star einer TV-Show, doch er leidet an Krebs im Endstadium. Und wo Philippe jetzt mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, muss er sich eingestehen, dass er nichts als ein eingebildeter, aufgeplusteter Gockel im Hühnerstall war, der tragfähige Werte wie Zielstrebigkeit oder Sparsamkeit verachtete und dem Anstand eine unbekannte Größe war.
Jean-Philippe Blondels Roman »6 Uhr 41« ist ein apartes Experiment, ein Zweipersonenstück fast ohne Dialog. Doch 95 Minuten schweigend-meditierend abgesessener Zugfahrt wollen mit Inhalten gefüllt sein. Zwei Teilbiografien (Lebensjahre 20 bis 47) im Rückblick mit der verschüchterten Perspektive auf den Passagier nebenan bieten allerhand aufschlussreiche und spannende Themen: der familiäre Hintergrund, das jugendliche Wesen, Anbandeln und abrupter Abbruch der kurzen Liebesbeziehung, die hernach diametral auseinanderdriftenden Lebenswege. Doch die 192 Seiten enthalten auch manchen Füllstoff und manch charakterliche Überspanntheit der auf sich zurückgeworfenen Reisenden (Können die Fetzen eines geplatzten Luftballons ein Kind trösten? Kann ein Leberfleck am Handgelenk das ganze Wesen eines jungen Mannes offenbaren?).
Erkenntnis ist das zentrale Thema dieser Eisenbahnfahrt. Sie hat eine gewissermaßen kathartische Wirkung auf die beiden Sitznachbarn, denn allein mit sich selbst sind sie aufrichtig. Ob sie diese Größe in einem Gespräch aufbringen könnten, ist hingegen fraglich. Gerade die Diskrepanz zwischen albernem Versteckspiel und schonungsloser Offenheit macht den Reiz der Geschichte aus. Wer hat schon Lust, sich ausgerechnet in einem Zugabteil um 6 Uhr 41 unbequemen Wahrheiten zu stellen? Dann lieber Augen zu und durch. Der Mensch ist schließlich ein Meister des Verdrängens.
 · Herkunft:
· Herkunft: