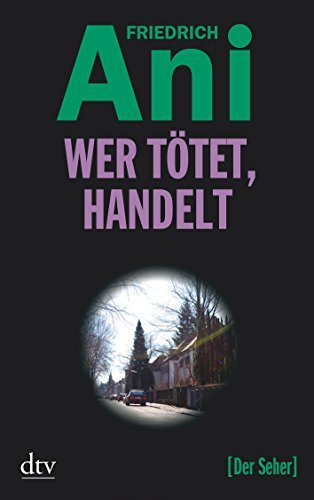Im Vertrauen auf eine gute Zukunft
Christiane, verheiratet und Mutter zweier Söhne, ist an Brustkrebs erkrankt. Es ist eine der aggressiven Formen, und sie wird daran sterben. Der Erzähler, einer der Söhne, kommt zur Ruhe, er besinnt sich. In Rückblicken erlebt er noch einmal seine Kindheit, Jugend und das Erwachsenwerden. Manche Kapitel beginnen in Kursivdruck: "Ich bin zehn Jahre alt und habe Sommerferien." Da lebt er mit seinen Eltern in der DDR und freut sich auf das jährliche Sommerlager.
Andere Kapitel sind mit Erinnerungen an die Geschichte seiner Großeltern gefüllt. Christianes Mutter verliebte sich während der Nazi-Zeit in den Physiker Johannes Figulla, einen Juden. Um ihn zu heiraten, hätte sie alles getan. Jüdin zu werden ist ihr durch das Ariergesetz verboten. Bald muss Johannes fliehen – sie wird ihn nie wieder sehen. Da sie schwanger ist, schwebt sie in Lebensgefahr. In Brandenburg überlebt sie den Krieg mit ihrer kleinen Tochter Christiane, der Mutter des Erzählers. Später heiratet die Großmutter, wird aber mit diesem Mann – einem Kommunisten und Anhänger Stalins – nicht glücklich.
Neben Christianes Erkrankung beschäftigt den Erzähler das Thema seiner jüdischen Zugehörigkeit, denn als Sohn einer Halbjüdin ist er ja ein Vierteljude. Vor der Wende gab es nur noch wenige Juden in Ost-Berlin, also auch keine Synagoge und keinen Rabbiner. Erst während seiner Studienaufenthalte in den Metropolen Boston und New York mit ihrem vielfältigen jüdischen Leben erlernt er es als Selbstverständlichkeit, Jude zu sein.
Zurück in Deutschland wird er wieder mit der Problematik des Jüdisch-Seins konfrontiert. Einerseits war seine Mutter vor der Geburt "zu jüdisch" – sie musste versteckt werden. Aber nach ihrem Tod ist sie nicht jüdisch genug, um auf dem jüdischen Friedhof in Berlin beerdigt zu werden. Weitere Beispiele, wie er als "zu jüdisch" oder auch "nicht richtig jüdisch" eingeschätzt wird, folgen.
Ein schwieriges Buch, vor allem für Menschen wie mich, die nach dem Krieg geboren wurden und in deren individualistischem Weltbild die Frage, zu welchem Grade sich jemand einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt oder von anderen als zugehörig definiert wird, nicht zu den zentralen Problemen der Identitätsfindung gehört.
 · Herkunft:
· Herkunft: