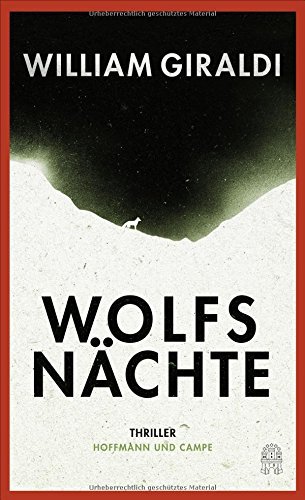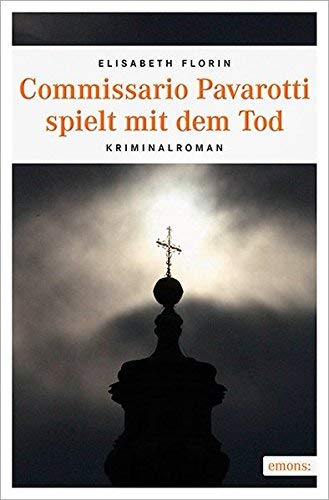Alles wird gut
Wer an diesem Sommertag 1920 aus dem Zugabteil oder aus dem Stationsvorsteherhaus von Oxgodby, Yorkshire, zuschaut, wie Tom Birkin seine Siebensachen aus dem Waggon auf den Bahnsteig hievt, wird es sich gleich denken: Einer dieser verhärmten, mittellosen und traumatisierten Kriegsheimkehrer. Der Mantel zu groß und geflickt, die linke Gesichtshälfte ständig von einem furchterregenden Zucken verzerrt. Was niemand sieht: Überdies ist ihm vor Kurzem seine Ehefrau weggelaufen.
Doch der Fünfundzwanzigjährige ist voller Tatendrang aus London angereist. Endlich hat er einen Auftrag ergattert – seine erste eigenständige Arbeit als Restaurator, seit er vor dem Krieg das London College of Arts besuchte. Freilich hat das Gemälde, dem er seine Kunstfertigkeit widmen soll, seit Jahrhunderten niemand mehr gesehen, wenn es denn überhaupt existiert. Man mutmaßt lediglich, dass etwas Derartiges unter dem Putz der Chorwand des Dorfkirchleins verborgen sei.
Toms Ansprechpartner, Reverend Arthur Keach, ist nur wenige Jahre älter und eine sehr irdische Krämerseele. Zügig und keinesfalls teurer als ausgemacht soll Tom die Malerei irgendwie ans Licht bringen. Es handle sich wohl nur um die fixe Idee einer kürzlich verstorbenen Dame. Nachdem Miss Adelaide Hebron selbst schon an der Wand herumgekratzt und ein, zwei Köpfe gefunden habe, habe sie die Freilegung des Kunstwerks in ihrem Letzten Willen verfügt, und erst wenn alle ihre Vorgaben erfüllt sind, wird ihr Vermächtnis einer großzügigen Kirchenstiftung ausbezahlt. Die ist dem Ortsgeistlichen wichtig, das Wandbild gleichgültig. Tom könne nach Belieben ausbessern, übermalen, ergänzen, so lange er mit dem vereinbarten Lohn von ein paar Guineen hinkomme.
Das ist nicht einfach, aber für einen, der wie Tom schwere Jahre hinter sich hat, nicht unmöglich. Er braucht nicht mehr als Brot, etwas Käse und am Wochenende ein Ale, und da er sich ein anständiges Privatzimmer nicht leisten kann, quartiert er sich in der Glockenturmkammer über seinem Arbeitsplatz ein. Was wiederum das Missfallen des Reverend erregt, dessen anderer Wesenszug eine ewig skeptische, sauertöpfische Miesepetrigkeit ist. Tom – hoffentlich Kirchgänger? – sei sich ja wohl bewusst, dass er an einem geweihten Ort wirke. Ärgerlich genug, dass die Andacht der Gläubigen jetzt durch die Arbeiten, das Baugerüst und womöglich den freigelegten Wandschmuck abgelenkt werde.
Tom – schon lange kein Kirchgänger mehr – nimmt's leicht, genießt seine kleinen Freiheiten und macht sich voller Enthusiasmus ans Werk. Schon nach wenigen Tagen erkennt er, dass an der großen Fläche zwischen dem Chorbogen und dem Dachfirst unter unzähligen Putz- und Rußschichten, aber gut erhalten eine hochwertige Darstellung des »Jüngsten Gerichts« auf ihn wartet. In zahlreichen fachkundigen Details vollziehen wir nach, wie sich Tom seinem namenlosen mittelalterlichen Kollegen, seiner Denkweise, seinen Techniken und sogar als Mensch annähert.
Verbergen und aufdecken, sich entfernen und annähern, zweifeln und vertrauen – dies sind die gegenläufigen Kräfte, die die Handlung dieser zarten Geschichte sanft vorantreiben. Das Dorf Oxgodby, seine Bewohner, deren Mentalität und Gewohnheiten sind der andere Schatz, den Tom Birkin hebt. Es sind einfache Landleute, deren natürliche Zurückhaltung (und breiter Dialekt) sie anfangs abweisend wirken lassen. Ein paar Vorboten – die vierzehnjährige Kathy Ellerbeck, klug und ein wenig naseweis, ihre tüchtigen Eltern, der kauzige Archäologe Moon, der in einem Zelt über einer Art Minischützengraben wohnt und nach den Knochen eines unseligen Hebron-Vorfahren sucht – öffnen dem aufgeschlossenen, unprätentiösen Tom den Zugang zu einer gastfreundlichen, arglosen Gemeinschaft, den Reverend Keach noch nicht gefunden hat.
Eine besondere Rolle spielt Alice, eine rehäugige Botticelli-Schönheit. Ihr changierendes Wesen von mal frappierender Unbekümmertheit, mal scheuer Zurückhaltung fasziniert Tom ebenso wie ihre Wohlgestalt. Mehr als einen bloß erträumten Kuss von ihr darf er sich bei aller gegenseitigen Sympathie nicht erhoffen, denn sie ist verheiratet. Wie und warum ausgerechnet mit Reverend Keach, das ist Stoff für allerlei Spekulationen zwischen Tom und seinem baldigen Vertrauten Moon.
Dass es eine jenseitige Hölle gibt, führt der mittelalterliche Meister seinem modernen Hilfsarbeiter (denn nur als solcher versteht sich Tom demütig) mit der Emblematik seiner Zeit drastisch vor Augen. Dass es auch diesseitige Höllen gibt, haben Tom, Moon und andere selbst durchlebt. Von den grausamen Kriegserfahrungen in Flandern, denen die beiden durch glückliche Fügung entkamen, lesen wir nur skizzenhafte Stichwörter; die Folgen, die die Männer alltäglich quälen, sprechen eine hinreichend deutliche Sprache.
Lebensfreude, Wissbegier, Zufriedenheit in einem schlichten, aber ausgefüllten Leben mit der Natur, unverstellte Offenheit und eine Art kollegial-tolerantes, friedliches Miteinander erlebt Tom als bislang unbekannte beglückende Erfahrungen. Sie verdrängen kaum merklich alte Ängste und Skepsis. Am Ende dieses Sommers ist Toms Gesichtszucken verschwunden.
Es ist eine zarte Geschichte, die dieses kleine Büchlein – eher eine leichte Novelle als ein Romanuniversum – erzählt. »A Month in the Country«  ist in Großbritannien ein moderner Klassiker. Er erschien bereits1980, erhielt den Guardian First Book Award, wurde für den Booker Prize nominiert und 1987 mit Colin Firth und Kenneth Branagh verfilmt. Sein Autor, J.L. Carr, starb 1994 mit 82 Jahren. Jetzt bringt DuMont die erste deutsche Übersetzung auf den Markt, sehr stilsicher und sensibel angefertigt von Monika Köpfer.
ist in Großbritannien ein moderner Klassiker. Er erschien bereits1980, erhielt den Guardian First Book Award, wurde für den Booker Prize nominiert und 1987 mit Colin Firth und Kenneth Branagh verfilmt. Sein Autor, J.L. Carr, starb 1994 mit 82 Jahren. Jetzt bringt DuMont die erste deutsche Übersetzung auf den Markt, sehr stilsicher und sensibel angefertigt von Monika Köpfer.
Von dem einzigartigen, strahlenden Sommer, den er, »beseelt vom Gefühl unendlicher Zufriedenheit«, als »eine glückliche, gesegnete Zeit« erlebte, erzählt Tom Birkin fast sechzig Jahre später in einer Rückschau voller Wehmut. Wir können seine Glücksempfindungen nachvollziehen, wie »der Mann, der in der Kirche wohnt«, in der Dorfgemeinschaft freundlich aufgenommen wird. Sonntags laden ihn die Ellerbecks regelmäßig zum Mittagsmahl, in respektvoller Anerkennung seiner Kompetenzen drängt man ihn – gelegentlich mit einer Portion Boshaftigkeit – in ihm teilweise wesensfremde Vertrauenspositionen: Laienprediger, Schiedsrichter beim Cricketspiel, Harmoniumkäufer. Ganz von selbst macht er sich an seinem freien Tag auf dem Feld nützlich, darf später beim Erntedankausflug mitfahren.
Wie im Brennglas leuchtet in dem kurzen Sommer 1920 eine längst vergangene Epoche auf – das Ende des Pferdezeitalters, mit Dampflok, Kutschwagen und »Gabelimbiss«. Eine unzeitgemäße Suche nach einer verlorenen Idylle? Rückwärtsgewandte Sehnsucht nach einer heileren Welt? Naja, eine Portion Eskapismus darf man bei dieser Lektüre schon ausleben. Aber der Kitsch-Verdacht zieht nicht. Der Autor blendet die harte Realität der Zeit – Armut, Krankheit, Kriegsleiden – keineswegs aus, stellt sie aber nicht zur Schau. Und die kleinbürgerliche Enge der Dorfgesellschaft kritisiert er in bester britischer Tradition statt durch Drastik lieber durch einen feinen, süffisanten Erzählton voller beschwingter Ironie. Tatsächlich erinnert sein Stil an Altmeister Thomas Hardy (der zwei Mal namentlich erwähnt wird), und viele Szenen lassen dessen Stimmungen anklingen: die Erntearbeit, das Fest mit Picknick im Grünen, erste Maschinen; ständig trinkt man Tee, bringt einander frische Eier, Speck und Beerenküchlein; dazu wundervolle Beschreibungen lieblicher Landschaften mit blühenden Wiesen, Wäldern, Wegen.
Während die wuchtigsten von Thomas Hardys Romanhandlungen auf der Folie scheinbarer ländlicher Idylle gewaltige moralische Konflikte aufbauen und ihre Protagonisten auf verschlungenen Wegen in die Hölle stürzen, befreit diese Geschichte der feinen Spannungsbögen und subtilen Motivgeflechte ihren Ich-Erzähler aus den Fängen seiner Vergangenheit und offenbart ihm, dass er auf Erlösung hoffen darf. Doch die Perspektive der melancholischen Rückschau aus großer Distanz lässt befürchten, dass Glück und Hoffnung den erzählten Sommer nicht unbeschadet überdauern konnten. J.L. Carr hat ein virtuoses kleines Meisterwerk geschaffen, das die Mittel der viktorianischen Ära transponiert, in eine neue Zeit mit neuen Arten von Himmeln und Höllen.
 · Herkunft:
· Herkunft: