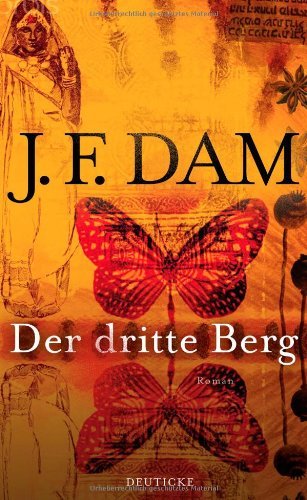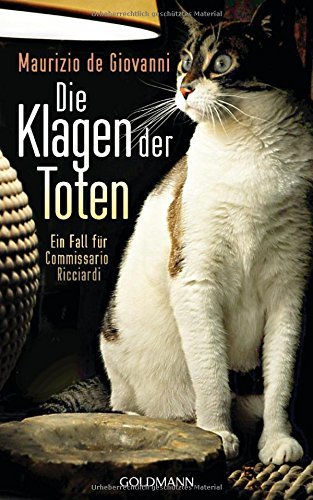Der ewig Suchende
Thomas und Christina Well stehen mittendrin im prallen Treiben. Erfolgreich im Beruf, wohlhabend, weitgereist, bestens integriert in einen Freundeskreis von Gleichgesinnten, können die Mittdreißiger ein selbstbestimmtes, anspruchsvolles und zufriedenstellendes Leben in Rundum-Sicherheit führen. Er arbeitet in einem angesehenen Architekturbüro. Sie mischt die Modebranche heftig auf.
Dann reist Tommy mit seinem Freund, dem Fotografen Jo, nach Zentralburma. Daraus soll ein essayistisches Reisebuch entstehen. Jo fängt Landschaften, Tempel und Menschen ein, Tommy hält seine Gedanken zur asiatischen Tempelarchitektur fest. Eines der eindrucksvollsten Bilder gelingt Jo, während sie einen Mönch, der sich unter einem eiskalten Wasserfall gewaschen hat, beobachten. Selbstzufrieden sitzen die beiden Freunde, als Jo das Foto im Kasten hat, im Schatten einer Pagodenspitze und mümmeln Bananen und Kekse, während am milchigblauen Himmel über ihren Köpfen lautlos Geier kreisen.
Wie die Vögel schon ahnen lassen, schlägt wenig später das Schicksal zu. Jo wird von einer Schlange gebissen. Die winzige Giftmenge setzt seinem Leben ein Ende, ohne dass Tommy es verhindern kann. Für Tommy ist fortan nichts mehr, wie es einmal war. »Ich war berührt worden von den richtigen Dingen: Leben, Tod, Wahrheit, Abgrund, und sie lähmten mich.«
Erfolgsmensch Thomas stürzt von der Sonnenseite in die düsteren Tiefen einer Lebenskrise. Nachts schläft er schlecht. In seiner Freizeit lungert er herum. In seinem Büro sitzt er hoffnungslos verloren vor seinem PC. Wie soll er den Entwurf einer Kunstgalerie fertigstellen, das Modell eines Büroturms aus Glas zu Ende bringen, wo ihm doch »alles unfassbar leer, nichtig, eigentlich albern« ist?
Christina, durch und durch rational, hat für die Vanitas-Episode ihres Ehemannes kein Verständnis. Schon vor seiner Reise hielt sie seine Asien-Faszination und die damit verbundenen Fotoband-Pläne schlichtweg für die »Marotte einer über Gebühr prolongierten Jugendzeit«. Tommy soll endlich erwachsen werden und sich lieber darauf konzentrieren, dass er im Architektenteam als vollwertiger Partner aufgenommen wird.
Ablenkung soll Tommy ein Konzertbesuch mit den besten Freunden, dem Ehepaar Michael und Helen bringen. Doch erneut hält das Schicksal eine überraschende Initiative bereit, die sich im Foyer konkretisiert. Während sich Christina lautstark und angeregt mit Michael (»der schlaksige Schulbüchergott im Bildungsministerium ... an der Schaltstelle des Abendlandes«) austauscht, sieht Tommy dessen Frau, Neurologin in Teilzeit, auf einmal mit anderen Augen: »ihr Gesicht, ihre rehbraunen Augen«, »ein Traumgesicht«, »ein Botticelligesicht «, und er fragt sich, wie ihm all das »so lange hatte entgehen können«.
Wie sich das Schlangengift in Jos Körper ausbreitete und ihn zur Strecke brachte, so dringt nun Amors Pfeilspitze in Tommys Seele ein. Betäubt dessen bittersüßer Wirkstoff die vom Prosecco geschwächten Sinne? Oder sind die Berührungen durch Helens Hand, ihr flüchtiger Abschiedskuss auf seine Wange, begleitet von der Anregung »Das müssen wir unbedingt noch einmal zusammen machen« (nota bene: »Konzert, meine ich«) Signale aus Helens Herz?
In jedem Fall ist Tommy schwer getroffen, und es gibt kein Gegenmittel. Schon in der folgenden Nacht findet er keine Ruhe mehr, »versuchte jede Art von Qual ihr Glück in mir«. Er rennt in die Küche, trinkt Shiraz, stellt den Fernseher an, wird auf dem Balkon gewitternass, kehrt abgetrocknet ins warme Bett zurück, wo Christina selig schläft. Er ist »in Ketten gelegt«, kann Gedanken und Bilder von Helen, ihren Augen, ihrem Busen nicht mehr abschütteln, bis sie »langsam den fast grenzenlos weiten Raum in meiner Gehirnschale ausfüllten«. Das Erlebnis wird den Mann psychisch-pathologisch so krank machen, dass ihn zeitweise Selbstmordgedanken umtreiben.
Diese Leiden des jungen Thomas, der sich nach Schönheit, Leib und Wesen seiner edlen Helen verzehrt und sie doch niemals zu erreichen vermag, stehen im Mittelpunkt der Erzählung von J.F. Dam. Die beiden kurzen Zitate, die er seinem Roman voranstellt (aus Dantes Jugendwerk »Vita nova« und aus Goethes »Werther«), verweisen auf die uralten literarischen Traditionen, mit denen er spielt und die er in zeitgemäßer Form fortführt. Die Thematik des Leidens an einer überwältigenden Liebe, deren Erwiderung unsicher, deren Erfüllung unmöglich ist, kann J.F. Dam inhaltlich unverblümter füllen als die Minnesänger des Hochmittelalters, und natürlich schöpft er aus dem vollen Repertoire psychologischer Finessen.
Wir lesen das faszinierende Psychogramm eines überdreht liebeskranken Mannes, der emotional bisweilen neben der Spur zu stehen scheint wie ein pubertierender Erstverliebter und doch präzise und wortgewaltig zu beschreiben vermag, wie es um ihn und die Menschen in seiner Umgebung steht. Für literarische Überhöhung sorgt zum Beispiel die Symbolik des Auftrags, mit dem der Leidende sich beruflich quälen muss: Ein gläserner Turm in Form eines muschelartigen Labyrinths ist zu ersinnen und zu realisieren.
So sehr Tommy hofft, hadert und halbherzige Avancen wagt, so sicher kann er doch sein, dass seine angebetete hehre vrouwe niemals ihre Ehe aufgeben, ihre Kinder im Stich lassen würde. Er ist ja selbst stets besorgt, seine Ehe mit Christina und die Freundschaft zu Michael nicht zu gefährden. Andererseits ist er mit allen Sinnen darauf eingestellt, Zeichen von Helens Zuneigung zu erhaschen. Die beiden Paare treffen sich im Spanienurlaub, man geht gemeinsam in eine Disko. Der genossene Alkohol hebt die Stimmung und senkt die Hemmschwelle. Michael führt Christina auf die Tanzfläche, sie versinken in Tango-Trance, ihre Körper verschmelzen spannungsgeladen . Tommy und Helen, interessiert und befremdet zugleich, beobachten das offensichtlich lustvolle Treiben ihrer Partner. Tommy lässt sich zu holprigen Komplimenten hinreißen: »Du bist eine viel schönere Frau. Du bist alles, was Christina nicht ist.« Als die Tänzer ihr Spiel am Tisch fortsetzen, bemüht, »so viel Ironie wie möglich hineinzupacken«, überrascht ihn Helens kühne Reaktion: Sie kippt ihr Glas auf ex, erhebt sich vom Stuhl und setzt sich »rittlings auf meinen Schoß ... ganz ohne Ironie«. Die beiden küssen sich heftig, »wir vergaßen die Welt ... existierten nur für uns allein«.
Schon in diesem entrückten Moment ist es Tommy leider nicht vergönnt, zu verstehen, was Helen ihm ins Ohr flüstert. Vielleicht besser so, denn am nächsten Tag – Tommy ist mit Helen allein am Strand, seine Gedanken kreisen zu ihren aufreizenden Bikini-Zonen, nur mit Mühe kann er seine Hand zurückhalten – dämpft sie wieder sein aufgewühltes Innenleben: »Du nimmst das gestern nicht so ernst?«
»Die Nacht der verschwundenen Dinge« ist ein prickelnder, oft süffisant-ironischer, durchgehend brillant formulierter gesellschaftskritischer Roman. Sein Protagonist, schon seit Studienzeiten »orientierungslos« und von Selbstzweifeln gequält, hatte sich auf die übermächtige, perfektionsbesessene Christina eingelassen, eine Frau, der immer schon »alles zu Füßen gelegen« hatte, eine »Meisterin des Erscheinenlassens «. Mit ihr im Bunde hat er sich in einem intellektuellen Freundeskreis eingenistet, den er im Innern zutiefst verabscheut, für den zu interessieren er lediglich vorgibt. Es sind fast ausschließlich kinderlose Doppelverdiener-Paare, »Vertreter des neuen aufgeklärten Spießertums, das, im Vollbesitz der Wahrheit, keine abweichende Meinung duldete«. Wie »alle Mitglieder meiner Generation« ist auch Tommy kein »Rebell«, der gegen diesen »mutlosen Morast« von vorgeblich guten Mülltrennern aufstehen könnte oder wollte. Seine Reise nach Asien ist der Versuch, den »kleinlichen Realistenfiguren « zu entfliehen, doch der Versuch scheitert und hinterlässt überdies eine zwei Jahre lang schwärende Wunde, bis sein Leben mit Helen einen neuen vagen Inhalt, ein neues schwankendes Ziel findet.
J.F. Dam kultiviert einen eigenständigen, ästhetisierenden Stil, der barock ausladen, nüchtern auf den Punkt bringen, lyrische Töne anschlagen, vor bitterbösem Witz und Sarkasmus strotzen kann. Insgesamt schimmert dieser Roman wie eine feine Goldschmiedearbeit – preziös, schön und klug konstruiert, entrückt, ein kühles Artefakt.
 · Herkunft:
· Herkunft: