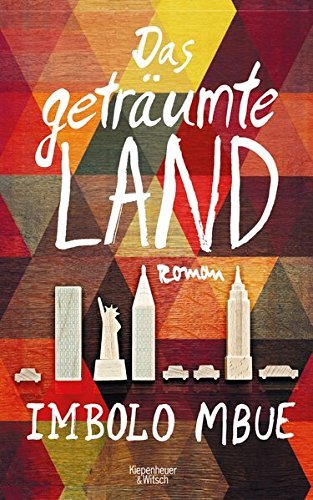
Zuckerguss über zerbrochene Träume
In Kamerun »muss man als jemand geboren werden, damit man jemand werden kann«. Da hat Jende Jonga Pech, denn er ist ein »Niemand«. Aber in Amerika, wo ein Farbiger bald Präsident werden will, müsste doch auch er eine Chance haben, ein »angesehener Mann« zu werden. Warnende Stimmen ignorierend, lässt er mutig seine Heimat hinter sich, um mit Frau Neni und Söhnchen Liomi eine bessere Existenz im Land der Träume anzustreben.
Gut zwei Jahre hält die Familie in New York City durch, bis Wermutstropfen auf Wermutstropfen ihre Zuversicht vergällt. Den letzten Schlag fügt ihnen der Börsencrash 2008 zu. Was die Wirtschaft weltweit in Turbulenzen stürzt und viele, viele Menschen um Job und Wohlstand bringt, kostet auch Jende den Arbeitsplatz, darüber hinaus das letzte Quäntchen Hoffnung und Würde, und er kehrt mit seiner Familie – inzwischen wurde noch ein Mädchen geboren – nach Kamerun zurück.
Bis auf die letzten beiden Schritte teilt die Autorin Imbolo Mbue das Schicksal ihrer Protagonisten. Wie Jende wurde sie 1982 in Limbé, Kamerun, geboren, zog etwa zur gleichen Zeit wie er in die USA, verlor durch das Wall-Street-Debakel ihre Arbeit. Doch statt aufzugeben und nach Afrika zurückzugehen, schloss sie ihre Universitätsstudien ab und begann, ihren ersten Roman zu verfassen. Als sie für »Behold the dreamers«  einen zahlungsfreudigen Großverlag fand, war der Durchbruch geschafft. Jetzt können wir das weniger glückliche Pendant ihrer eigenen Migranten-Erfolgsgeschichte auch auf Deutsch lesen (Übersetzung: Maria Hummitzsch). Darin entzaubert sie den American Dream in Zeiten hemmungsloser Gier als große Illusion und Amerika als Land der Albträume, und das, ohne irgend jemandem weh zu tun.
einen zahlungsfreudigen Großverlag fand, war der Durchbruch geschafft. Jetzt können wir das weniger glückliche Pendant ihrer eigenen Migranten-Erfolgsgeschichte auch auf Deutsch lesen (Übersetzung: Maria Hummitzsch). Darin entzaubert sie den American Dream in Zeiten hemmungsloser Gier als große Illusion und Amerika als Land der Albträume, und das, ohne irgend jemandem weh zu tun.
Familie Jonga lässt sich im Stadtteil Harlem nieder, beantragt Asyl und tut alles, um in der amerikanischen Gesellschaft aufgenommen zu werden. Tatsächlich eröffnen sich im Herbst 2007 rosige Perspektiven, als Clark Edwards, ein hohes Tier bei Lehman Brothers, Jende als Privatchauffeur einstellt und gut bezahlt. Gewissenhaft und willfährig tut Jende seine Pflicht und erwirbt sich bald das Vertrauen seines Brötchengebers. Wenn die beiden in ihrer Limousine durch New York gleiten, reden sie über Gott und die Welt, und zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine gewisse Intimität, die ihnen Einblicke in Mentalität und Weltbild des anderen gewährt.
Natürlich leben sie auf entgegengesetzten Polen der amerikanischen Gesellschaft. Familie Edwards (Clark, Gemahlin Cindy, ein schulpflichtiger und ein studierender Sohn) residiert mit in einem Luxusapartment an der Upper East Side und schwelgt im Wohlstand. Die Jongas hausen in einer ärmlichen Wohnung voller Ungeziefer. Neni rackert sich zehn Stunden pro Arbeitstag als Pflege-Hilfskraft ab, erledigt am Abend die Hausarbeit und hilft dann Liomi bei den Hausaufgaben, auf dass er es einmal besser habe als seine Eltern: Arzt ist ihm als Fernziel gesteckt. Wenn er eingeschlafen ist, büffelt Neni noch ein paar Stunden für ihre eigene Fortbildung, denn sie möchte Apothekerin werden. Trotz aller Plackerei muss die Familie jeden Cent drei Mal umdrehen, um über die Runden zu kommen.
Im Sommer verzahnen sich die beiden konträren Lebenssphären noch enger, denn Neni zieht mit Cindy ins Ferienanwesen in den Hamptons. Dort übernimmt sie gern, was im Haus und am Pool an Arbeit anfällt. So wie sich Jende bei Clark akzeptiert fühlt, kann Neni kaum fassen, wie freundlich die weißen upperclass-Ladies sie behandeln und ihr Komplimente machen. Aber ihr bleibt auch nicht verborgen, dass Cindy unglücklich ist.
Eigenartig, wie starrköpfig – oder naiv – die Jongas an ihren Träumen festhalten. Schon Jendes Cousin, der bereits länger in Amerika lebt und die Anreise seiner Verwandten finanzierte, hat nie einen Hehl aus seiner Überzeugung gemacht, dass die übermächtigen Weißen kein Jota ihres Einflusses oder Besitzes hergeben würden, um anderen Gruppen wirkliche Aufstiegschancen einzuräumen. Und obwohl Jende, während sein Chef im Fond immer nervöser telefoniert, ganz unbeabsichtigt brisante Insider-Informationen zuteil werden (»das Schiff sinkt«), entwickelt er kein Gespür, dass sich eine gewaltige Krise anbahnt.
Nicht einmal Jendes Ohnmacht gegenüber der anonymen, scheinbar willkürlich agierenden Gerichtsbarkeit trübt sein Vertrauen, er könne im Land of the Free ein kleines, aber gesichertes Glück finden. Uneinsehbar wie hinter kafkaesken Palastmauern zieht sich das Verfahren um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung über zwei Jahre hin, bis den Jongas das Urteil zugestellt wird. Mit dem Börsencrash bricht alles zusammen, im Großen wie im Kleinen. Jende verliert seinen Job, Clark orientiert sich neu, die zaghafte Bindung zwischen den ungleichen Familien zerreißt.
Bei der Kontrastierung der beiden Milieus lässt die Autorin keinen Aspekt und kein Klischee aus. Das strahlende Leben der erfolgreichen Weißen ist pure Fassade. Während workaholic Clark ganz für seine Firma lebt und die Familie vernachlässigt, langweilt sich seine Frau im materiellen Überfluss und betäubt ihr sinnleeres Alleinsein mit Alkohol und Medikamenten. Der ältere Sohn schmeißt, angewidert vom väterlichen Karriere- und Gewinnstreben, sein Jurastudium und begibt sich auf einen Selbstfindungstrip (nach Indien, wohin sonst?). Geld macht also nicht glücklich – wer hätte das gedacht?
Dagegen lebt das schwarze Ehepaar trotz seiner Sorgen um die ungewisse Zukunft in einer glücklichen Partnerschaft – arm, aber edel. Indem Nemi an Selbstbewusstsein gewinnt, distanziert sie sich von den Traditionen ihrer afrikanischen Herkunft, denen gemäß zum Beispiel der Mann in wichtigen Angelegenheiten über seine Frau bestimmen kann. Dies führt zu einem dramatischen, aber kurzen Konflikt, als sich ihre Lage zuspitzt und Jonga die Rückkehr nach Kamerun beschließt. Als Neni sich mit recht unausgegorenen Vorstellungen, wie sie mit den beiden Kindern in Amerika bleiben könne, widersetzt, fällt Jende in alte Rollenmuster zurück und wird – aus Verzweiflung, verletzter Ehre, Scham und Hilflosigkeit – handgreiflich. Doch sogleich bereut er dies zutiefst, und man versöhnt sich wieder.
Ebenfalls eigenartig: In Mbues Romanwelt tritt kein einziger Fiesling auf. Ihre Figuren sind durchweg liebenswert. Auch Clark Edwards ist keiner von den Unersättlichen. Schon frühzeitig warnt er seinen Vorgesetzten, die Lage der Nation sei ernst, man müsse »unsere Langzeitstrategie ändern«. Wie er seinem Fahrer offenbart, wäre er ohnehin am liebsten ein anderer Mensch – und trägt ihm ein selbst verfasstes Gedicht vor. Reich und edel.
Die afrikanische Migranten-Familie scheint dem Handbuch der Weißen für perfekte Einwanderer entsprungen zu sein. Ohne Fehl und Tadel werkeln sie fleißig und zuverlässig an ihrer Zukunft, versorgen mit ihrem kleinen Einkommen die Verwandten in der Heimat und legen überdies noch Notgroschen zur Seite, um niemandem zur Last zu fallen. Ergeben nehmen sie alles hin, was auf sie zukommt, fügen sich in ihre kärglichen Umstände, klagen nicht über die ihnen verweigerten Rechte. Dass Jende, der gute Vater und liebende Ehemann, für einen Moment die Selbstbeherrschung verliert, als die herzlose Realität seine Familie einholt, fügt dem Zuviel an Gutem ein geradezu wohltuendes bitteres Beigeschmäckle hinzu, und auch Neni darf sich wenigstens eine fragwürdige Episode erlauben.
Trotzdem ist Imbolo Mbues Romankonzept nicht einfach naiv. Sie hat vielmehr Verständnis und Mitgefühl für ihre Charaktere, wie sie sich redlich bemühen, ihre Träume zu realisieren, aber zu spät erkennen, dass sie zweifelhaften Idealen nachjagen. Die einen wie die anderen malen sich ihre Welt schön und bemerken gar nicht, wie die Realität sich verschlimmert – bis die Katastrophe sie endlich aufweckt und ihre Illusionen platzen lässt. Es gibt genug Analysen und fiktionale Werke, die aufdecken, dass solche Entwicklungen nicht vom Himmel fallen, sondern zum Schlechteren oder Besseren beeinflusst werden können. Imbolo Mbue aber stellt keine Verantwortlichen bloß, verzichtet auf jegliche konkrete Kritik, legt keinen Finger in die Wunde des Rassismus, deckt keine Mißstände auf, wie rechtlose Einwanderer als billige Arbeitskräfte ausgebeutet und diskriminiert werden. So ist »Das geträumte Land« nicht mehr als eine allzu leichte, dazu auch sprachlich schlichte Unterhaltungslektüre.
 · Herkunft:
· Herkunft: 

