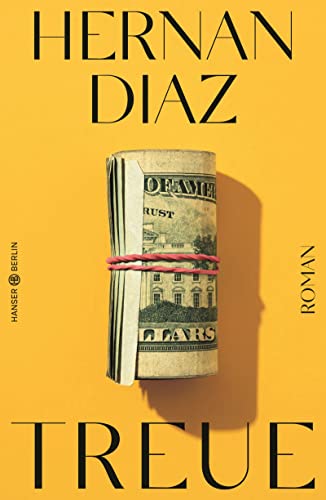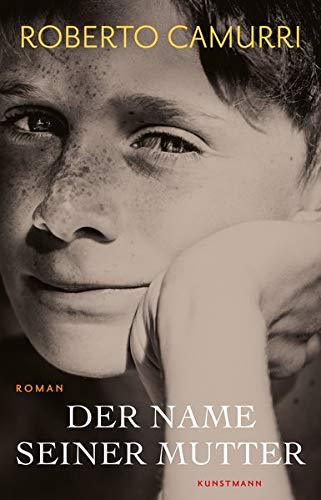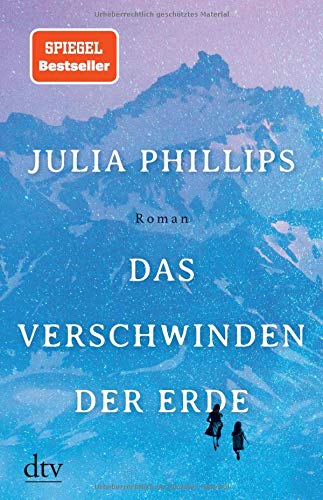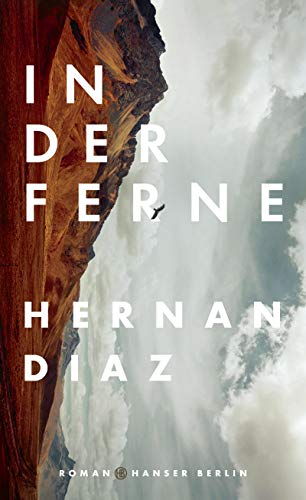
In der Ferne
von Hernan Diaz
Ein junger Schwede wandert mit seinem Bruder ins Goldgräber-Amerika aus, verliert ihn aber. Auf der unermüdlichen Suche nach ihm treibt der wortkarge Antiheld mit vermeintlich schlichtem Gemüt jahrelang durch endlose Weiten und Abenteuer.
Aufbruch und Desillusion
Die Erzählsituation erinnert an Joseph Conrads wort- und schicksalsgewaltige Seefahrerromane. Ein Alaska-Schoner steckt im Eis fest, die Passagiere – hartgesottene Goldgräber – vertreiben sich die Zeit mit Seemannsgarn, und einer unter ihnen, gerade vom Bad in einem Eisloch hervorgekrochen, zieht nach und nach mit seinem imposanten Auftreten und seinen knappen Worten unwiderstehlich aller Aufmerksamkeit und Respekt auf sich. Dem schwerfällig wirkenden, weißhaarigen »Titan« eilt ein überlebensgroßer Ruf voraus, in dem Wahrheit und Fama, Ruhmestaten und Mordgerüchte nicht zu trennen sind. Beim Schein eines Feuers lauschen alle »bis zum Sonnenaufgang« seiner packenden Erzählung, insbesondere ein fünfzehnjähriger Junge. Bei Conrad würde der zum Binnenerzähler; hier präsentiert nach der Eingangsszene ein auktorialer Erzähler in 24 chronologisch angeordneten Kapiteln eine Geschichte, die auch uns Leser komplett in den Bann schlägt und nachhaltig beeindruckt.
Der Koloss im selbstgenähten Kapuzenmantel aus Fellen sämtlicher Wildtierarten des Kontinents heißt Håkan Söderström, für amerikanische Ohren einfach »Hawk« (Habicht, Falke). Aufgewachsen ist er mit seinem älteren Bruder Linus unter bitterarmen Verhältnissen in Schweden. Im fernen Amerika, so glauben ihre Eltern, würde ihnen eine bessere Zukunft winken, und so soll ein Schiff die beiden ins Land der Verheißung tragen. Doch im Gewühl der Wartenden am Auswandererpier verlieren sich die Jungen und besteigen unterschiedliche Schiffe, so dass Håkan ganz allein in San Francisco an Land geht statt, wie geplant, in New York. Ohne Geld und ohne Sprachkenntnisse, vor allem aber ohne Linus, der sich hingebungsvoll um ihn gekümmert und ihn mit fantastischen Geschichten auf die Fremde vorbereitet hatte, ist Håkan jedoch verloren. Linus in New York zu finden wird für Jahre sein einziges Lebensziel.
Wie Simplicius Simplicissimus verschlägt es den naiven Hawk, der glaubt, zu Fuß nach »Nujårk« zu kommen, nun von Station zu Station – ein Einzelgänger, ein Suchender mit klarem Ziel vor Augen und doch ein ahnungslos Irrender. Eine irische Familie hatte ihn schon während der Überfahrt notdürftig versorgt und nimmt ihn mit, doch keineswegs in Richtung Osten, sondern zu den Goldsuchern. Wie Seifenblasen zerplatzen sämtliche Träume, die Linus’ Geschichten ausgemalt hatten. Die Menschen erweisen sich als feindselig und raffgierig, nutzen die Not der anderen erbarmungslos aus. Schnell sind die Iren all ihren Besitz für etwas Proviant und zwei alte Esel los, so dass ihnen Håkan als billiger Lastenträger bei der mühseligen Expedition zu den Goldfeldern gerade recht kommt. Als der Familienvater tatsächlich Nuggets findet, kann keine Raffinesse verhindern, dass ihm sein Claim weggenommen wird und Håkan in die Hände zwielichtiger Gestalten fällt.
Irgendwann gelingt ihm die Flucht, und er nimmt seinen Marsch nach New York wieder auf. Tagelang irrt er durch die endlosen, leeren Weiten des Westens, ohne Wasser und Nahrung, ohne verlässliche Orientierung, den Körper gegen die erbarmungslose Sonne mit Blut beschmiert. Nachdem er bewusstlos zusammengebrochen war, wacht er im Planwagen eines Naturkundlers auf, der ihn fand und gesund gepflegt hat. Auch er ist mit seinen Begleitern auf der Suche. Ihr Treck ist unterwegs zu einem Salzsee, um das Mysterium der Schöpfung zu ergründen und Hinweise zum Ursprung der Menschheit zu finden. Dem gelehrigen jungen Analphabeten Håkan vermittelt er Grundkenntnisse der Anatomie und der Heilkunde.
Bald zieht Håkan, mittlerweile zum Riesen gewachsen, weiter, gut beraten und großzügig ausgerüstet. Er solle den Routen der Siedler folgen, jedoch entgegen deren Wagentrails nach Osten. Auf diesen Wegen sei er sicher und finde immer freundliche Hilfe. Doch er gerät in einen Treck, dessen Familien sich in zwei Lagern zerstritten haben, und der egoistische Anführer kann Håkan, der die Zusammenhänge nicht versteht, für seine Zwecke einspannen. Der Glaube an seine Verheißungen, er werde die Gruppe in ein paradiesisches Tal führen, zerbröselt, Zweifel, Misstrauen und Meuterei liegen in der Luft. Wieder will Håkan sich absetzen, um New York zu suchen, doch erst muss er sich in einem grausamen Gemetzel mit Indianern und weißen Reitern bewähren. Die barbarischen Akte, die er wahrnimmt und selbst ausführen muss, belasten ihn schwer und rauben ihm den letzten Glauben an das Gute im Menschen.
Håkans Wanderjahre durch das Purgatorium des frühen »Wilden Westens«, der gerade erst grausam erschlossen wird, führen ihn durch das ganze Spektrum des Bösen, der Gewissenlosigkeit, der Unmoral, der Gewalt, und unter Sadisten, Prostituierten, Marodeuren wird auch der »Hawk« als Verbrecher gesucht. »In was würde das Töten ihn verwandeln?« Wenngleich er sein Ziel niemals aus den Augen verliert, so verliert es sich doch sozusagen selbst. Ist es dem tumben Tor aus Schweden anfangs eine wunderreiche, zu Fuß erreichbare Stadt irgendwo in der fremden Welt, so lösen sich über die Jahre des Wanderns alle Vorstellungen von Ort, Entfernung, Richtung und Zeit auf. Am Ende ist Håkan wie verloren, dem geografischen Ziel kein Stück näher als am Anfang und doch unendlich viel weiter entfernt. Das Wandern bleibt.
Hernan Diaz’ Roman »In The Distance«, 2018 für den Pulitzer Prize und den PEN/Faulkner-Award nominiert, ist ein ernüchternder Anti-Western. Sein Anti-Held und sein Anti-Plot lassen keinen Hauch vom Mythos des »Wilden Westens« spüren. Selbst die gewohnten grandiosen Landschaftsgemälde werden entzaubert. Die »allumfassende Monotonie« der ewig gleichförmigen Landschaft, des »unerreichbaren Horizonts«, des in den Augen brennenden, Mund, Nase und Lunge verstopfenden Staubs hebt Raum und Zeit auf, und der Autor schildert drastisch (und poetisch), wie sie den Menschen quält und reduziert, nur noch »von irgendeinem vergessenen, aber noch funktionierenden Mechanismus angetrieben«, bis der Verstand »erstarb« und der Körper übermannt wird »von einer aktiven, alles verschlingenden Leere … einer Stille, die nichts mit Frieden zu tun hatte … einem ansteckenden Nichts, das alles besiedelte«. Den physischen Rest, bis der Tod eintritt, besorgen von Demütigungen begleitete grausame Torturen der Häscher, Feinde, Milizen.
Ganz im Gegensatz zum wortkargen, etwas einfältigen Protagonisten ist der Erzähler, der konsequent seine Perspektive einhält, aber präzise Beobachtungen und eine tiefgründige Philosophie beisteuert, außergewöhnlich eloquent. Hannes Meyers überzeugende Übersetzung fesselt uns von der ersten bis zur letzten Seite und macht das Buch dank seiner sprachlichen Qualität, seiner durchgängig hohen Spannung, seiner unerwarteten Wendungen und seiner Charakterzeichnung zu einem rundum empfehlenswerten Leseabenteuer.
 · Herkunft:
· Herkunft: