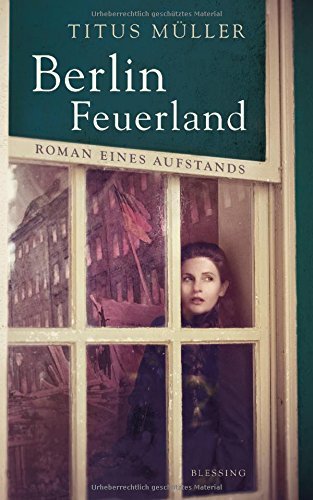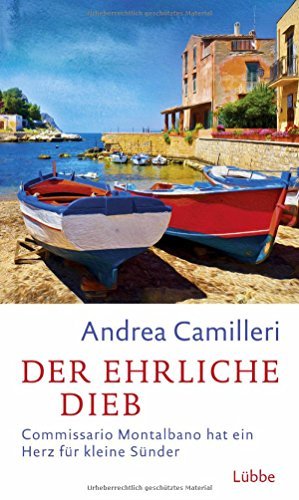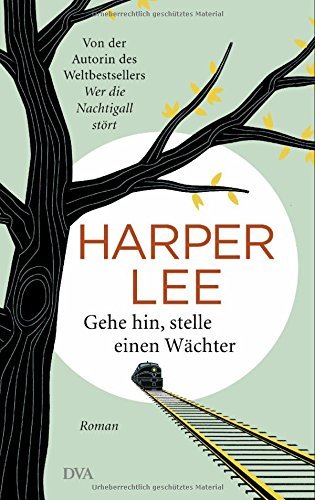
Das Gewissen: eine Insel
Jean Louise Finch, 26, hat wie jedes Jahr Sehnsucht nach ihrer Heimat. Deswegen reist sie aus dem mondänen, aufgeklärten New York, wo sie lebt und arbeitet, nach Maycomb, der Kleinstadt in Alabama, wo sie geboren wurde und aufwuchs. Zwei Wochen später ist das heroische Bild, das sie von ihrem Vater gehegt hatte, in Trümmern und sie selbst zur Erwachsenen gereift.
Jean Louise hat stets respektvoll und bewundernd zu Atticus Finch aufgeschaut – ein renommierter Anwalt, aufgeschlossener Gentleman und die »mächtigste moralische Kraft in ihrem Leben«. Jetzt, mit 72 Jahren, ist er allerdings von Arthritis geplagt und auf Hilfe angewiesen. Statt des schwarzen Hausmädchens Calpurnia, die Jean Louise und ihren kürzlich verstorbenen Bruder Jem nach dem frühen Tod der Mutter liebevoll aufgezogen hatte und inzwischen selbst aus Altersgründen in den Kreis ihrer Familie zurückgekehrt ist, führt jetzt die resolute Tante Alexandra das Regiment, hauptsächlich darauf bedacht, dass das Ansehen der feinen Familie keinen Schaden nimmt. Da sind Konflikte mit der freisinnigen Jean Louise, die sich um Verhaltenskodizes nicht schert, vorprogrammiert.
Auch dem liebenswürdigen Onkel Jack fällt auf, wie sehr sich seine Nichte im Norden verändert hat. Selbst ein unkonventioneller Lebenskünstler, hat er aber immer ein offenes, vertrauensvolles Ohr für sie.
Schon am Bahnhof traf Jean Louise ihren alten Schulfreund Hank wieder. Atticus hatte sich des begabten Jungen aus zerrütteten Verhältnissen früh angenommen. Jetzt ist er 31 und bereit, den Platz seines Ziehvaters in dessen Kanzlei einzunehmen. Dann wäre er auch gesellschaftlich qualifiziert, seine Jugendliebe Jean Louise (damals »Scout« genannt) zu heiraten und eine Familie zu gründen. Obwohl Jean Louise seine Zuneigung erwidert (sie ist »fast in ihn verliebt«) und sich ein Leben im unverfälscht gebliebenen Maycomb gut vorstellen kann, will sie sich noch nicht festlegen. Sie hat das innerfamiläre Gebot »Liebe, wen du willst, aber heirate deinesgleichen« verinnerlicht und fürchtet, womöglich könnte eines Tages nach der Hochzeit »der Mann auftauchen, den sie von vornherein hätte heiraten sollen«.
In der Schlüsselszene des Romans hockt Jean Louise wie früher auf ihrem Stammplatz auf dem Balkon des Gerichtssaals. Unten leitet Atticus Finch eine Bürgerversammlung. Neben ihm sitzt ihr Verlobter Hank, und beide hören dem fremden Gastredner zu, wie er sich für die »Wahrung der Lebensweise der Südstaaten« ereifert. Die Wortfetzen, die zu ihr herauf dringen, quälen sie wie Messerstiche: »Weder von irgendwelchen Niggern noch vom Obersten Bundesgericht oder sonst wem« werde sich der Mann »sagen lassen, was er zu tun habe ... Rasse so strohdumm ... grundlegende Minderwertigkeit ... ungewaschen und stinkend ... eure Töchter heiraten ... die Rasse bastardisieren ...«. Um »den Süden (zu) retten«, wolle er – unter Berufung auf Gottes Willen – dafür sorgen, dass »die Rassen getrennt bleiben«.
Wie geht dies mit der Szene an gleicher Stelle aus ihrer Jugend zusammen, an die sie sich nun erinnert? Ihr Vater hatte mutig die Verteidigung eines schwarzen Jungen übernommen, der der Vergewaltigung eines vierzehnjährigen weißen Mädchens angeklagt war. Ungeachtet der Vorverurteilung in der Öffentlichkeit war Atticus Finch von seiner Unschuld überzeugt – und erwirkte am Ende einen Freispruch.
Und nun erlebt sie, wie der furchtlose, gütige, gerechte Anwalt, der seinen Kindern das Rüstzeug für ein menschenfreundliches, weltoffenes Leben mitgegegeben hat, neben einem grölenden Rassisten ausharrt, ohne ihm die Stirn zu bieten. Im Gegenteil: Atticus Finch spricht sich selbst für die Beibehaltung der Segregation aus. Von seiner Tochter zur Rede gestellt, begründet er seine Haltung mit der Sorge, dass die in Washington propagierte staatsbürgerliche Gleichstellung der Schwarzen den Niedergang des Südens einleiten werde. »Willst du scharenweise Neger in unseren Schulen und Theatern? Willst du sie in unserer Welt?«
Für Jean Louise fällt eine Fassade, zerbricht eine Ikone. Sie muss sich einer neuen, hässlichen Realität stellen – der Broschüre »Die schwarze Pest« auf Vaters Zeitungsstapel, seiner Vorstandsposition im Bürgerrat, seiner Sympathie für den Ku-Klux-Klan – und ihrer eigenen Blindheit.
Zutiefst enttäuscht erklärt Jean Louise ihren Vater innerlich für »tot«, geht ihm aus dem Wege, will sich wieder nach New York absetzen. Erst im Verlauf vieler Gespräche, insbesondere mit Onkel Jack, begreift sie, was geschehen ist. »Die Insel eines jeden Menschen, der Wächter eines jeden Menschen ist sein Gewissen. So etwas wie ein kollektives Gewissen gibt es nicht«, hält Jack ihr vor Augen. Je mehr sie ihren Vater idealisierte und überhöhte, desto mehr gab sie von ihrer eigenen kritischen Gewissensinstanz auf, definierte durch sein Vorbild sich selbst – sein Gewissen wurde ihr Gewissen, und sie bezog daraus ihre eigene moralische Sicherheit.
Jetzt erkennt sie, dass sie »farbenblind« war, indem sie nur das Gute, die Humanität in ihrem Vater (und in sich) wahrzunehmen bereit war und seine (ihre) Fehlbarkeit gar nicht ins Kalkül zog. Der »Sehfehler« schützte auch ihre eigene Integrität. Aus dieser Falle konnte sie sich nicht selbst befreien; erst das schockierende Erlebnis im Gerichtssaal öffnete ihre Augen für die verborgenen Wahrheiten, um den Preis, dass auch ihr allzu hochmütiges Selbstbild ins Wanken geriet. »Du musstest dich selber abstoßen, oder er musste dich wegstoßen, damit du als eigenständiges Wesen funktionieren konntest.«
Als übler Rassist, wie seine zornige Tochter es ihm an den Kopf wirft, will sich Atticus Finch nicht beschimpfen lassen. Er vertritt die Ansicht des Gründervaters Thomas Jefferson, dass Staatsbürgerrechte verdient werden müssen, nicht »leichtfertig vergeben« werden dürfen, wie es jetzt unter dem Druck der NAACP für die schwarze Bevölkerung der Südstaaten durchgesetzt wird. Diese aber, »als Volk noch in den Kinderschuhen«, »rückständig« und wirtschaftlich wie politisch ahnungslos, sei nicht reif für das kostbare »Privileg« etwa des Wahlrechts, geschweige denn für verantwortungsvolles Regieren im Interesse des Ganzen (»Wir [Weißen] sind nämlich in der Unterzahl.«). Wenn Atticus fürchtet, dass zum Beispiel das schulische Niveau gesenkt werde, »um es den Negerkindern anzupassen«, so gibt er gewiss den Zukunftsängsten der großen Mehrheit ›anständiger‹ weißer Amerikaner seiner Zeit Ausdruck.
Der Roman endet versöhnlich. Jean Louise kann mit Atticus Frieden schließen, sich abnabeln, mit sich ins Reine kommen, erwachsen werden.
Die amerikanische Schriftstellerin Harper Lee aus Monroeville, Alabama, (wo im Nachbarhaus Truman Capote aufwuchs, zwei Jahre älter und ein lebenslanger enger Freund) wurde 1960 schlagartig weltberühmt, als ihr Roman »To Kill a Mockingbird« (bibliografische Übersicht am Ende) erschien, 1962 mit Gregory Peck als Atticus Finch großartig verfilmt und seither in über 40 Millionen Exemplaren verkauft. Ähnlich ihrem Kollegen Jerome D. Salinger (»The Catcher in the Rye«, 1951; »Der Fänger im Roggen«) zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück, gab keine Interviews mehr, bekundete, kein zweites Buch schreiben zu wollen.
Kein Wunder also, dass bereits die Ankündigung eines neuen Romans riesiges Aufsehen und Spekulationen hervorrief. Ihrem Vorsatz, nichts Neues zu veröffentlichen, ist die Autorin nicht wirklich untreu geworden, denn »Go Set A Watchman« – der Titel ist ein Bibelzitat (Jesaja 21:6) – war bereits 1957 fertig, also vor ihrem Debüt-Meisterwerk. Genaugenommen ist es dessen erste Version. Die tüchtige Lektorin des Verlagshauses Harper & Brothers erkannte das herausragende erzählerische Talent der jungen Schriftstellerin (Präzision, Empfindsamkeit und Unmittelbarkeit des Stils, die frische Leichtigkeit des ironisch gefärbten Tons), riet ihr aber zu einigen Änderungen: Rückversetzung aus der Gegenwart der Fünfziger in die Dreißigerjahre, Ich-Perspektive der burschikosen, quirligen, klugen Göre »Scout« statt des reifen Erzählers in der 3. Person, stärkere Akzentuierung der Gerichtsverhandlung um den unschuldig angeklagten Schwarzen (den die Geschworenen trotz Atticus Finchs Einsatz jetzt schuldig sprechen), ungebrochene Heroisierung des Vaters als aufrechter Kämpfer für Gerechtigkeit. Mit diesen substantiellen Modifikationen verlor der Roman zwar an Differenziertheit der (manchmal etwas dozierend vorgestellten) Positionen, gewann aber an Klarheit, Ausdruckskraft und Akzeptanz, denn er traf den Zeitgeist besser und bot eingängigere, erbaulichere Identifikation mit dem grundanständigen, unbeirrbaren Anwalt des guten neuen Amerikas der Kennedy-Jahre (wobei der zwiespältigere weiße Patriot Atticus Finch I. gewiss die realitätsnähere Variante war). So erschuf Harper Lee, über zwei Jahre hinweg von ihrer Lektorin begleitet, einen Klassiker der Weltliteratur, der seit seiner Veröffentlichung zum Lesekanon nicht nur amerikanischer Bildungsinstitutionen gehört.
Wozu aber wurde nun – nach einem halben Jahrhundert – die ›Vorstufe‹ des Meisterwerks veröffentlicht? Der weltweite Organisations- und Publicityaufwand (das Original erschien im Sommer 2015 fast gleichzeitig mit vielen Übersetzungen) ging mit einiger Geheimnistuerei und Spekulationen um die Auffindung des Manuskripts, um die Absichten (oder Geldsorgen?) der neunundachtzigjährigen Autorin in Monroeville, um die Machenschaften ihrer Anwältin einher. Welche Motive auch immer dahinter stecken: Die Lektüre lohnt sich, egal ob man die wundervoll erzählte Geschichte in ihrer eigenständigen Qualität genießen oder zusätzlich über die Akzentverschiebungen zum ›offiziellen‹ Debüt reflektieren möchte.
Ausgaben:
• »Go Set A Watchman«  ;
;
• »Gehe hin, stelle einen Wächter« (Übersetzung von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel)  ;
;
• »To Kill a Mockingbird«  (auch als Schulausgaben mit Vokabelhilfen erhältlich, z.B. von Diesterweg
(auch als Schulausgaben mit Vokabelhilfen erhältlich, z.B. von Diesterweg  );
);
• »To Kill a Mockingbird & Go Set A Watchman« (Doppelausgabe) 
• »Wer die Nachtigall stört« (in neuer Übersetzung, Juli 2015)  .
.
 · Herkunft:
· Herkunft: