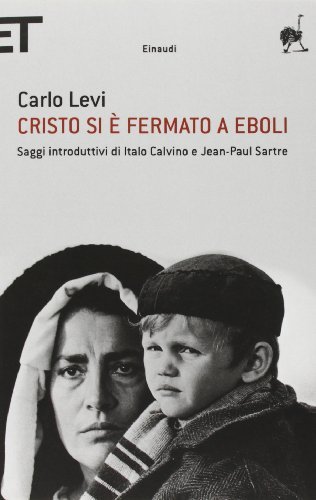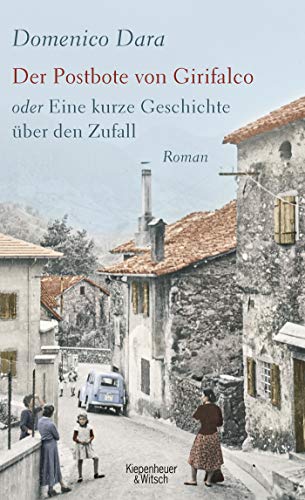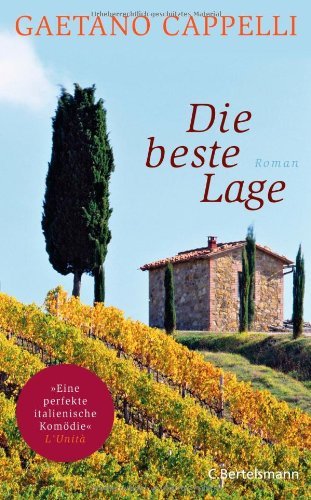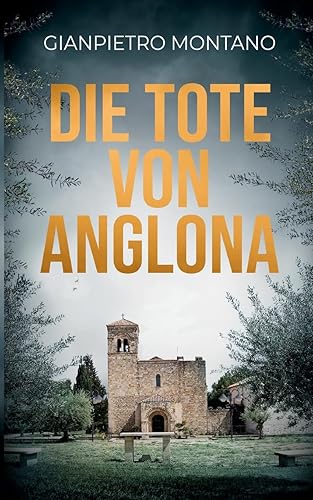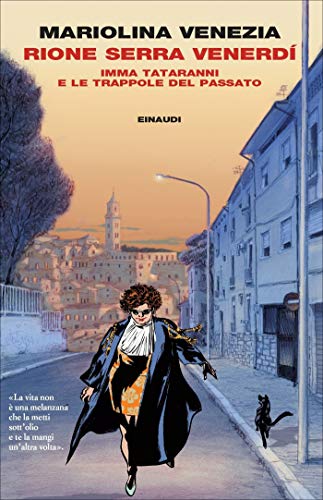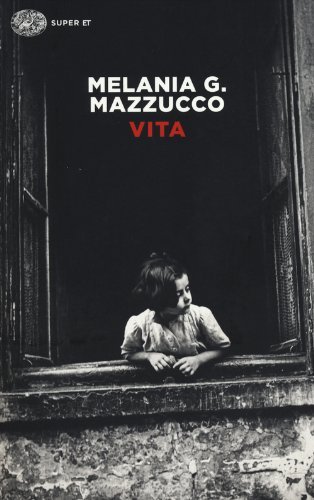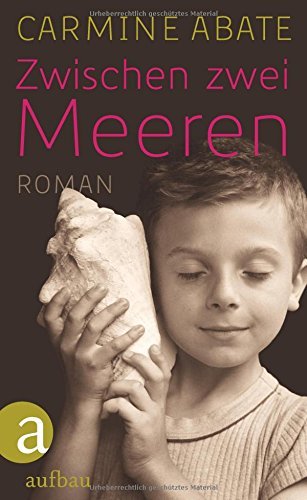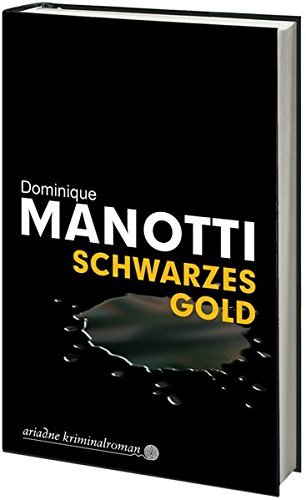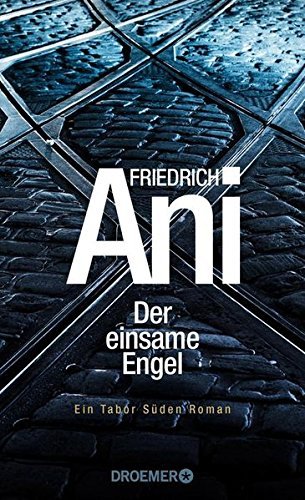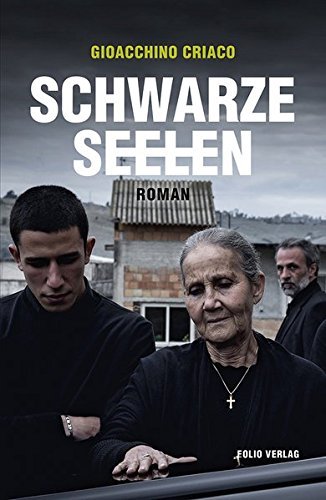
Um die Zukunft betrogen
Dunkel sind die wilden Bergregionen des kalabrischen Aspromonte. Im äußersten Süden des italienischen Stiefels, zwischen den Städten Catanzaro und Reggio Calabria, dem Tyrrhenischen und dem Ionischen Meer erhebt sich dieser Gebirgszug bis auf fast zweitausend Meter Höhe. Die Natur ist in einem ausgedehnten Nationalpark unter Schutz gestellt, und auch der in einigen Dörfern noch gesprochene griechische Dialekt (»Grekaniko«) soll vor dem Aussterben bewahrt werden. Im Übrigen sind die Menschen, die hier abgeschieden wohnen, auf sich allein gestellt und, so hat es den Anschein, zeitlosen Gepflogenheiten ausgeliefert.
Die drei jungen Männer, deren Lebenswege der Roman »Anime Nere«  von Gioacchino Criaco erzählt (Karin Fleischanderl hat ihn übersetzt), stehen stellvertretend für viele andere mindestens in den letzten Jahrzehnten, und ihr gemeinsamer Nenner ist die Ausweglosigkeit ihrer Existenz, unabhängig davon, ob der eine oder andere materielle Erfolge sammeln oder ein paar Stufen auf der Karriereleiter einer Befehlshierarchie erklimmen darf. Am Ende bleiben sie doch gefangen im dunklen, undurchsichtigen Dickicht ihres »rauen Berges« (so die Übersetzung des schmucklosen Namens »Aspromonte«), von dessen Jahrhunderte zurückreichenden Wurzeln sich niemand lösen zu können scheint, ohne sich selbst zu verlieren.
von Gioacchino Criaco erzählt (Karin Fleischanderl hat ihn übersetzt), stehen stellvertretend für viele andere mindestens in den letzten Jahrzehnten, und ihr gemeinsamer Nenner ist die Ausweglosigkeit ihrer Existenz, unabhängig davon, ob der eine oder andere materielle Erfolge sammeln oder ein paar Stufen auf der Karriereleiter einer Befehlshierarchie erklimmen darf. Am Ende bleiben sie doch gefangen im dunklen, undurchsichtigen Dickicht ihres »rauen Berges« (so die Übersetzung des schmucklosen Namens »Aspromonte«), von dessen Jahrhunderte zurückreichenden Wurzeln sich niemand lösen zu können scheint, ohne sich selbst zu verlieren.
Der namenlose Ich-Erzähler und seine Freunde Luciano und Luigi sind Kinder armer Ziegenhirten. Wie ihre Vorfahren seit fast drei Jahrtausenden wachsen sie in den Sechzigerjahren als »Söhne der Wälder« im Aspromonte auf, der den Familien trotz erbärmlichster Lebensumstände nicht genug zum Überleben bietet. Die einzige Möglichkeit, sich etwas dazuzuverdienen, bietet der Clanchef der ’Ndrangheta. Für jeden Job, und sei er noch so niederträchtig – damals waren es Entführungen und Lösegelderpressung –, findet er Handlanger, die sich für ihn die Finger schmutzig machen und den Arm des Gesetzes fürchten müssen, während »der Don« wie die Made im Speck auf seinen Landgütern lebt. Die meisten hassen ihn, nicht nur, weil er ihre einträglichen Leistungen mit ein paar Lire abspeist, den größten Batzen aber für sich einbehält, sondern für die Willkür seiner Herrschaft, mit der er etwa die Aufträge vergibt. Konsequent und berechenbar ist er jedoch gegenüber all jenen, die sich seinem Einfluss entziehen wollen. Einige Dorfbewohner haben den Versuch mit dem Leben bezahlt. Luciano zum Beispiel hat seinen Vater nie kennengelernt. Man fand ihn vor der Geburt seines Kindes auf, »von Blei durchsiebt«.
Trotzdem zieht Luciano des Nachts mit den beiden anderen Jungen durch das unwegsame, von Wildschweinen zerfurchte Gelände enger Pinienhaine, niedriger Eichen-, Buchen- und Lärchenwälder und dorniger Ginsterbüsche, bis sie auf den Vater des Erzählers treffen. Der Mann der Berge weiß: Wer hier geboren wurde, wird auch hier sterben, »aus Armut oder im Kugelhagel«. Gemeinsam warten sie auf die lebende Ware, die ihnen per Lastwagen zugestellt wird. Dieses Mal ist es ein Mann, der keine Anzeichen von Angst erkennen lässt. Wie immer wurde ihm eine Kapuze über den Kopf gestülpt. Im Morgengrauen würden sie mit der Geisel (die alle nur »das Schwein« nennen) aufbrechen, ihn für Monate in einem Stall verstecken und schließlich an einem anderen Ort wieder freilassen – sofern das Lösegeld bezahlt wurde.
Mit neunzehn Jahren haben die Jungen bereits eine Menge auf dem Kerbholz: Diebstahl, Überfälle, Entführungen, ja sogar Mord. Geprägt von ihrer kümmerlichen Kindheit sind sie besonders hungrig nach einem besseren Leben, und »wir nahmen uns, was wir wollten«. So soll denn auch der nächtliche Marsch durchs Gebirge, der den Roman einleitet, auf ihr eigenes Konto gehen, nicht auf das des Don. Es ist der erste Schritt auf ihrer »Fahrt in die Hölle«. Sie führt sie hinunter in die Niederungen der Schwerstkriminalität, und weit weg vom Aspromonte errichten sie in Mailand einen international agierenden Drogenring und Waffenhandel.
Erst viel zu spät (mit knapp fünfzig Jahren) erkennen die drei skrupellosen Kriminellen, dass sie, obwohl sie unvorstellbar reich geworden sind und »viel mehr bekommen haben, als wir eigentlich wollten«, dennoch »mittlerweile nur mehr die Komparsen, nicht die Protagonisten einer Aufführung, bei der andere Regie führen«, sind. Sie »gehören einer vergangenen Epoche an«, ihr Betätigungsfeld ist globalisiert. So leben sie ein Leben, das ihnen nicht gehört, zusammen mit Leuten, die sie nicht mögen, und irgendwann werden sie ein Messer im Leib haben oder im »Gefängnis vermodern«. So oder so sind sie Todgeweihte – »schwarze Seelen«.
»Anime nere« ist nicht als Kriminalroman konzipiert, nicht einmal auf Spannung ausgerichtet. Es ist der Versuch einer sachlich-dokumentarischen Bestandsaufnahme, wie sich das Böse in Menschen hineinfrisst und vollständig Besitz von ihnen ergreift, die doch ursprünglich im Charakter unschuldig geboren wurden. Aus bitterer Not aufgebrochen, um ein besseres Leben zu führen, bleiben sie in den Fängen der verhängnisvollen Vergangenheit ihrer Heimat.
Wie wenig Möglichkeiten den Bewohnern des Gebirgszuges zwischen Sizilien und Süditalien durch die Jahrhunderte blieben, bringt der Autor immer wieder zum Ausdruck. Der mythologische Traum des vorchristlichen Osker-Volkes ging niemals in Erfüllung. Der Osker-Held Kyria, mit dem sich der Erzähler gern identifiziert, war des Kämpfens, der Hungersnöte und Krankheiten müde. Er rief die Götter an, dem Gemetzel ein Ende zu setzen, und träumte von Frieden und einer waldreichen Landschaft inmitten von Bergen, wo sich seine Leute auf einem Hügel niederlassen, »in Frieden Tiere hüten und Wildschweine jagen« konnten. Die Götter zeigten ihm den Weg. Doch lange währte ihr idyllisches Paradies nicht, da fielen die Griechen über sie her. Es folgten Römer, Bourbonen, Savoyer, Faschisten, schließlich die Republik, und alle brachten neue Regelungen, Ansprüche, Forderungen und Lockungen. Zurück blieben bis heute nachwirkende konkrete und abstrakte Zerstörungen – und die Seuche der Mafia. »Nur in unseren Bergen waren wir normale Menschen, außerhalb wurden wir zu Tieren in Gefangenschaft … Uns ging es gut mit unserem schwarzen Brot, unserem Hunger, unseren Krankheiten, unserer Rückständigkeit, wir brauchten keine Hilfe … Warum durfte ein tausendjähriges Volk seine Zukunft nicht selbst wählen und auf dem eigenen Land nach eigenen Vorstellungen leben? Wir haben ihre Integration, ihren Fortschritt, ihre Sprache, ihr Geld nicht gewollt. Sie haben dem Teufel die Tür geöffnet.«
Der Autor Gioacchino Criaco (dessen Vater Domenico 1993 in einer Fehde ermordet wurde und dessen Bruder Pietro bis zu seiner Festnahme 2008 zu den meistgesuchten Kriminellen Italiens gehörte) zeichnet ein hoffnungsloses Bild seiner Heimat, deren kriminelles Netzwerk von den höchsten Kreisen der Politik und Justiz bis zum kleinsten Hirten reicht und unentwirrbar erscheint. Sein lapidarer, emotions- und wertungsfreier Schreibstil passt zur Interpretation der Entwicklung des Landstrichs und seiner Mafiosi als unschuldig geborene Opfer der Umstände, denen nie eine Wahl blieb.
Anschließen kann ich mich dieser Betrachtungsweise dennoch nicht. Schließlich gehen nicht alle »Söhne der Wälder« einen derart üblen Weg wie die drei hier vorgestellten, und selbst die waren keineswegs gezwungen, das zu werden, was sie wurden: brutale, abgestumpfte Killer. Einmal so tief gesunken, macht sie auch der leicht melancholische Ton, in dem Criaco sie in ihrer Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies vorzeitlicher Unschuld porträtiert, nicht sympathischer. Als sie endlich Gelegenheit gefunden haben, Rache zu nehmen, und den »Herrn des Todes« auf bestialische Weise ermordet haben, ist die Rede mitnichten von Läuterung. »Nie zuvor war ein Tod so befreiend gewesen«. Wir waren »zufrieden, zur Gänze und ohne Gewissensbisse«.
Dass sie Schuld auf sich geladen haben, gestehen sie uneingeschränkt ein (»es war nur gerecht, dass wir büßten«) und suchen bei diversen Göttern (inklusive den heidnischen) um Vergebung nach. Dennoch pokern und taktieren sie mit den diversen Abteilungen der Justiz und mit den befreundeten und verfeindeten Clans, als gehe es um eine Simultanschachpartie, nicht um Menschenleben. Mit ihren bewährten Mitteln gelingt es ihnen, sich aus jeder Affäre zu ziehen. Schaffte es der verhasste Richter Barresi zunächst, die Gangster »ein paarmal zu Lebenslänglich und zu Haftstrafen von zwanzig bis dreißig Jahren« zu verurteilen, heißt es später: »Die Übereinkunft sah für mich keine Haftstrafe vor.« Selbst Festnahmespektakel – Geländewagenkonvoi stürmt abgelegenen Ziegenstall – ähneln eher Klassentreffen: Die Protagonisten aller Seiten kennen, befehden, unterstützen oder täuschen einander seit Jahren, und jetzt umarmen sie sich und trinken erst einmal einen Kaffee zusammen, ehe man getrennte Wege geht.
Trotz der angemerkten Fragezeichen ist Criacos Romanerstling von 2008 gerade wegen seiner Insider-Perspektive ein lesenswertes, wenn auch sprödes Buch. Francesco Munzi hat es 2014 ziemlich frei verfilmt, wobei er als Drehort Criacos Heimatdorf Africo wählte und dessen Dialekt beibehielt (weshalb der Film selbst in Italien nur mit Untertiteln verstanden wird).
 · Herkunft:
· Herkunft:  · Region: Kalabrien und Basilicata
· Region: Kalabrien und Basilicata