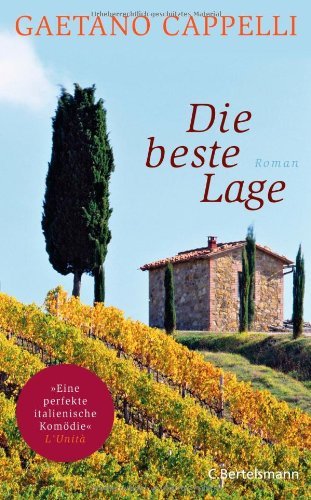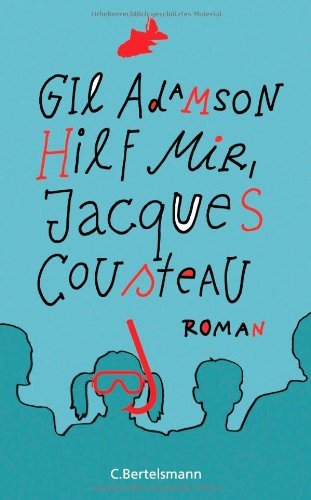
Alle ein bisschen gaga
In dieser Familie ist niemandem zu helfen, daran könnte auch Jacques Cousteau nichts ändern. Tag für Tag sprudelt der helle Wahnsinn, und Autorin Gil Adamson zieht uns mitten hinein in die Strömung. Ich-Erzählerin Hazel berichtet in Kurzkapiteln voller lakonischer Momentaufnahmen, was da so blubbert; am Ende sind knapp zwanzig Jahre verflossen, und immer noch sind alle ein bisschen gaga wie am ersten Tag ...
Hazel war gerade mal vier, als sie mit Papa North und Mama Janey auf der »Lakemba« von Australien zurück nach Vancouver reiste. Den Äquator querten sie bei hohem Wellengang, nichts blieb waagerecht. »Ich sehe das lange, schwere Sofa über das Linoleum auf mich zu schlittern und trete aus seiner Bahn« – so trocken und nüchtern wie im ersten Satz des Buches sieht Hazel die Welt, selbst wenn sie furchterregend schwankt, und die Menschen, selbst wenn sie grün sind wie »die meisten Leute im Salon«.
Mutter Janey ist anders, beispielsweise abergläubisch. Wer, wie sie, weiß, dass »jemand stirbt, wenn man einen Hut aufs Bett legt«, kauft natürlich keine Kindersachen, ehe ein Baby wohlbehalten auf der Welt ist. Daher ruht Brüderchen Andrew, der alsbald Hazels Einzelkindstatus beendet, in einem Pappkarton unterm Küchentisch und schläft in einer »Wäscheschublade«.
Schule ist und bleibt für Hazel »etwas, das andere Leute ernst nehmen müssen«. Sie sitzt lieber mit baumelnden Beinen auf dem Dach und beobachtet durchs Fernglas bis spät in die Nacht die Nachbarn. Da lernt sie damit umzugehen, was das Leben an Möglichkeiten zu bieten hat. Wie etwa sollte man jemanden begrüßen, der sich die Füße auf dem Sofatisch von der Katze ablecken lässt? Andere Nachbarn bessern bereitwillig Hazels Taschengeld auf, damit sie ihre Fische sittet.
Die Männer in Hazels Clan sind nicht minder originell als ihre weiblichen Komplementäre. Hazels Dad ist beseelt von »eingefleischtem Optimismus«, aber wenn die Realität nicht mitspielen will und kleine oder größere Katastrophen drohen, dann flüchtet er sicherheitshalber in den Keller. Obwohl »linkisch« und »weltfremd«, findet er sein seelisches Gleichgewicht, indem er das Haus neu verkabelt. Dabei können schon mal die Lichter im Haus ausgehen – Hauptsache, der Fernseher läuft und »im Wohnzimmer schwimmt Jacques Cousteau herum«.
Auch Vaters zwei Brüder sind ein bisschen neben der Spur. Der reiche Onkel Castor gilt allseits als personifizierter Schrecken. Tiere liebt er über alles, allerdings nur wenn sie »schneeweiß« sind. Andersfarbige bringen ihn in Rage. Kein Wunder, dass seine Frau das eheliche Haus am See bald geräumt und vorsorglich das Weite gesucht hat. Derart im Stich gelassen ist Onkel Castor leider noch unberechenbarer geworden. Eines Sommermorgens lädt er zur Erheiterung aller zu einem skurrilen Wettspiel ein. Teilnehmer sind seine Tiere: Katze, Hund, Gans und Pferd scheucht er ins Wasser, und dann geht es »darum, welches Tier als Erstes wieder an Land gelangt«.
Onkel Bishop profiliert sich gern als Weltenbummler und nervt alle, wenn er ständig frisches spinnertes Seemannsgarn spinnt. Hazel findet: »Vielleicht ist nicht alles wahr. Aber wenigstens gut erfunden.«
Indem Hazel von Kapitel zu Kapitel älter wird, erfahren wir mit jeder Episode weitere Absurditäten aus ihrer Sippschaft samt Aunties, Cousins und Großeltern. Opa fährt zu den Treffen wie gewöhnlich im Cabrio vor – einmal streckt sich auf der Rücksitzbank sein dahingeschiedener Hund Rufus aus. Wie passt Hazel nur selbst in diesen Rahmen? Es fällt ihr nicht leicht, Ähnlichkeiten zwischen sich und den anderen aufzuspüren. Der Schluss liegt nahe: »Ich gehöre gar nicht zu dieser Familie. Im Krankenhaus ist etwas Furchtbares passiert.«
Im letzten Kapitel finden sich fast alle zum Weihnachtsfest in einem proppenvollen Berghotel zusammen; nur die Großeltern fehlen – sie verzocken in Las Vegas ihr Geld. Besonders glücklich ist Hazel über das Erscheinen von Mutter Janey, die die Familie verlassen und die sie sehr vermisst hatte. Die Nobelherberge hat Onkel Castor ausgesucht (nicht ganz selbstlos, denn sie ist eins seiner Investment-Objekte). Besinnlichkeit darf man in dieser Truppe natürlich nicht erwarten, jedenfalls nicht im konventionellen Sinn. Spontan beschließen alle, gemeinsam an einer Beerdigung teilzunehmen, freilich ohne zu wissen, wer da eigentlich begraben wird.
Hazel liebt ihre Familie mit all ihren Macken. Bevor der Weihnachtspudding explodiert und alles ins Chaos verfällt, wünscht sich Hazel, genau diesen Augenblick für immer festhalten zu können: »Es ist fantastisch, genial.«
Damit findet Gil Adamson genau den richtigen Absprung. Denn wiewohl auch wir Leser diese schräge Familie inzwischen einfach ins Herz geschlossen haben werden, bröckelt ihre Fassade an vielen Stellen. Hazels Eltern haben sich getrennt, und die Großeltern bedürften größerer Aufmerksamkeit. Noch macht man sich lustig über ihre Ausfallerscheinungen – sie haben halt »einen an der Waffel«. Und was wird wohl aus Hazel? Sie jobbt nun als »Sweetie« bei einer unzufriedenen Optikerin und wechselt Männerbekanntschaften wie ihre Unterwäsche. Dabei hatte sie doch immer davon geträumt, Schriftstellerin zu werden ...
Die kanadische Schriftstellerin Gil Adamson (*1961) hat seit 1991 u.a. Gedichtsammlungen und Erzählungen veröffentlicht. Ihr erster Roman (»The Outlander« ) erschien 2007 und liegt in der Übersetzung von Maria Andreas ebenfalls bei C. Bertelsmann vor: »In weiter Ferne die Hunde«
) erschien 2007 und liegt in der Übersetzung von Maria Andreas ebenfalls bei C. Bertelsmann vor: »In weiter Ferne die Hunde« (2009). Adamsons zweiter Roman »Help Me, Jacques Cousteau«
(2009). Adamsons zweiter Roman »Help Me, Jacques Cousteau« basiert auf einem gleichnamigen Band von short stories aus dem Jahr 1995 und wurde wiederum von Maria Andreas ins Deutsche übersetzt.
basiert auf einem gleichnamigen Band von short stories aus dem Jahr 1995 und wurde wiederum von Maria Andreas ins Deutsche übersetzt.
 · Herkunft:
· Herkunft: