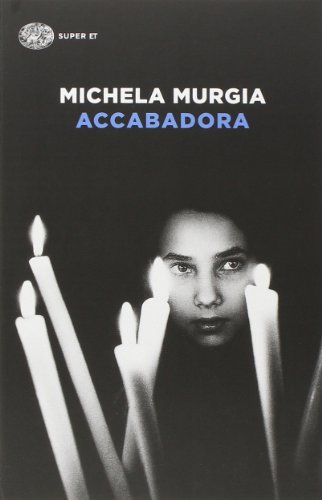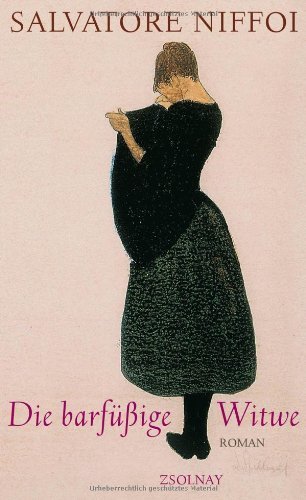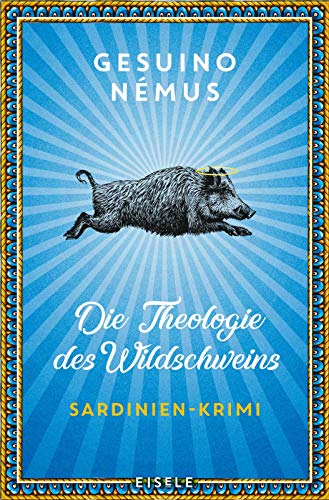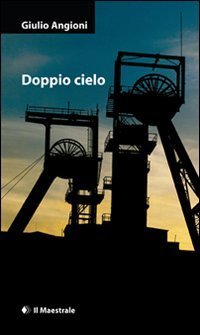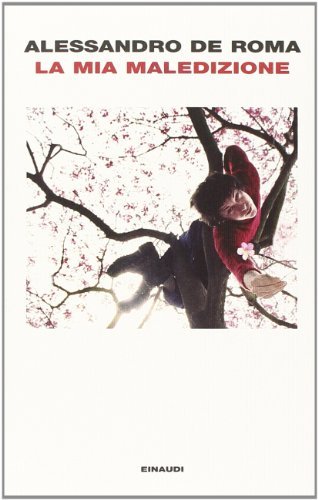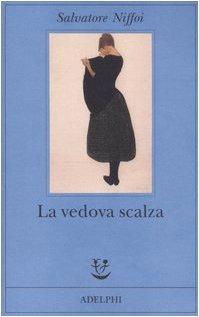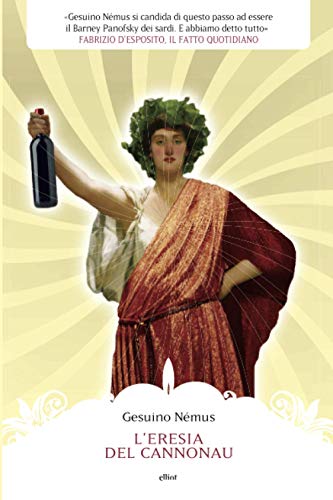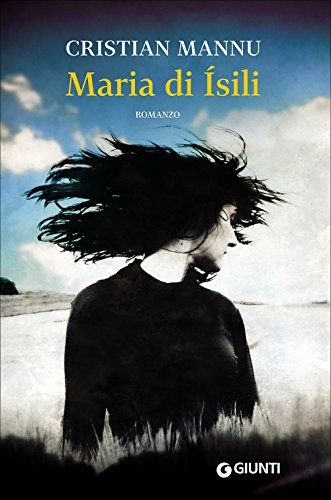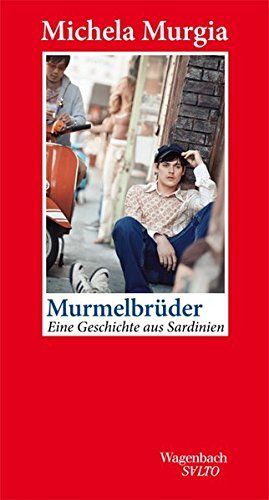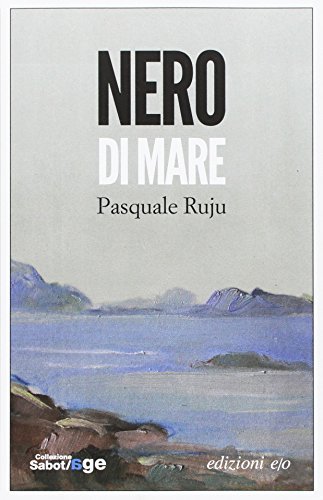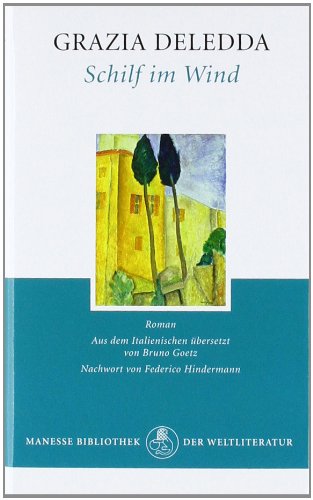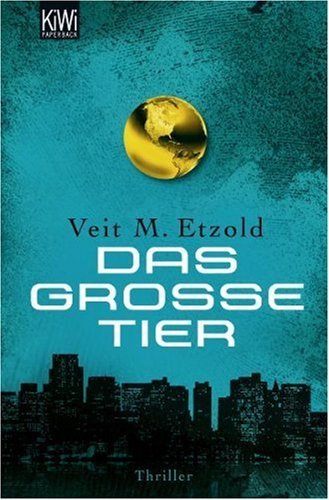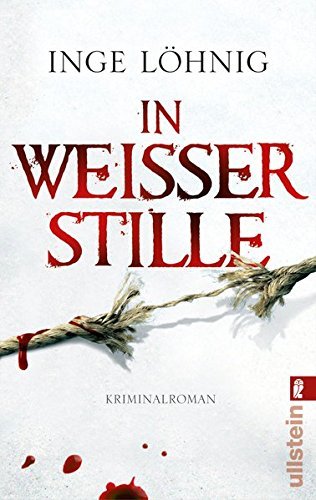Emanzipation aus der Steinzeit
Dies ist ein autobiographischer Roman über eine erschütternd harte Kindheit und Jugend in einem archaischen Sardinien der Hirten: Was anmutet wie Steinzeit, trug sich erst »kürzlich« zu – zwischen 1938 (Leddas Geburtsjahr) und ca. 1970.
Schauplatz ist das Dorf Siligo im hügeligen Nordwesten Sardiniens (Provinz Sassari), vor allem aber die endlosen Weiden darum herum. Die sind von Trockenmauern umfasst, bieten eine karge Hütte als Unterschlupf und Schutz gegen die Unbilden der Natur und müssen Tag und Nacht argwöhnisch bewacht werden gegen Räuber aus der Tier- und Menschenwelt. Glücklich kann sich schätzen, wer eine eigene Ziegenherde besitzt; arm bleibt er trotzdem, und Schicksalsschläge wie Krankheiten und Unwetter können jederzeit eine Wende bringen. Deswegen sind die Familien feste Gemeinschaften, in denen jeder mit anfassen muss und der Vater ein starres Regiment führt.
Wie Abramo Ledda, herrisch und erbarmungslos, den kleinen Gavino ab seinem fünften Lebensjahr zum Hirten abhärtet, ist eine ergreifende Geschichte. Als erstes nimmt er den sensiblen Jungen wieder aus der Schule; die Einwände der Lehrerin zählen nichts gegen die schlichten Erfordernisse einer Hirten- und Bauernfamilie. Die Lektionen, die der Vater ihm erteilt, kennen nur zwei Lernziele: das Überleben in der rauen Wildnis und die Verteidigung des mageren Besitzes. Alles, was diese beiden Anliegen und die Existenz der Familie gefährden könnte, muss getilgt werden (Angst, Zärtlichkeit, Freude, Vertrauen, Individualität); alles, was ihnen dient, wird gestärkt (absoluter Gehorsam, Kälte, Misstrauen, Vorsicht, Vorausschau, Genügsamkeit, Pflichtbewusstsein, Härte gegen sich selbst und andere). Die Erziehungsmethoden des Patriarchen sind schlicht: knappes Erklären – Vormachen – den Knaben Situationen aussetzen, in denen er sich bewähren muss – brutale Züchtigung, wenn er Fehler macht. Lob und Ermutigung, Verständnis und Eigeninitiative gehören nicht dazu. Statt einer Kindheit durchlebt der Junge ein Martyrium.
Die erbärmlichen Lebensbedingungen der sardischen Kleinbauern haben sie offenbar emotional und sozial verkümmern lassen. Obwohl alle gleichermaßen arm sind, befehden und bestehlen sie sich sogar untereinander. Das Ausmaß ihrer Verrohung wird vor allem im Umgang mit Kindern und Frauen erkennbar, denen sie weniger Fürsorge zuteil werden lassen als den Schafen und Ziegen. Gavinos tyrannischer Vater ist keine Ausnahme, aber gewiss eine besonders extreme Ausprägung eines solchen archetypischen Patriarchen.
Das Kind hat gar keine andere Wahl, als sich dem grausamen väterlichen Despotismus zu unterwerfen. Aber seine Gedanken sind frei, insbesondere in der Stille und Einsamkeit der Weiden und Hügel, allein mit der Herde, den wilden Tieren, die in den Nächten ihr Unwesen treiben, und den widrigen Naturgewalten. Die wenigen Impulse aus der Schulklasse und sein wacher Geist treiben ihn voran, auch Träume zu entwickeln und mit bewundernswerter Entschlossenheit zu verfolgen. Der vollkommen verständnislose, uneinsichtige und unnachgiebige Vater drischt blindlings und wie vom Teufel besessen auf seinen Sohn ein und kann doch dessen Willen nicht brechen. Die offenkundige Einbuße an Macht durch einen erwachsenden Rivalen, der ihm nicht an Körperkraft, wohl aber an Willensstärke und geistigen Fähigkeiten überlegen ist, bringt die Fundamente seiner Weltsicht ins Wanken, und er weiß sich nicht anders zu wehren als durch rohe Gewalt.
Eine ungehinderte Entwicklung zu einem eigenständigen Charakter kann dem Jungen nur gelingen, wenn er sich dem Zugriffsbereich des Tyrannen und am besten auch den entbehrungsreichen Konditionen der Insel entzieht. Diese Möglichkeit verspricht Gavino Ledda das Militär.
Erst auf dem »Kontinent« (dem italienischen Festland) erhält er endlich Zugang zu Bildung und der modernen Welt, zu Technik und Literatur. Freilich muss er sich dazu durch weitere Stationen der Demütigung kämpfen, denn Sarden wurden als unzivilisierte Hinterwäldler verspottet und mussten Italienisch oft wie eine Fremdsprache erlernen. Außerdem war die Kaserne natürlich ein neuerliches Gefängnis mit streng hierarchischen Strukturen. Aber Gavino Ledda bringt sich unermüdlich Lesen, Schreiben und Mathematik bei und absolviert erfolgreich Prüfungen, bis er Radiotechniker ist und einen Schulabschluss schafft.
Er verlässt das Militär und kehrt in sein sardisches Heimatdorf zurück. Seine Hoffnung, er werde dort Anerkennung für seine Leistungen finden, wird jedoch bitter enttäuscht. Die Welt des »padrone« hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt; die Talente und Qualifikationen des begabten Sohnes haben darin keinerlei Wert oder Vorteil – im Gegenteil: Geistiges Arbeiten ist für ihn faules Herumhocken. Des Vaters Herrschsucht ist ungebrochen, und noch immer sieht er keinen anderen Weg für einen Sohn, als sich zu fügen und Hirte und Bauer zu werden wie seine Vorfahren. Das Jahr ist 1962 ... Der endgültige Bruch zwischen den beiden Männern ist unvermeidlich.
Unweigerlich wird man an die alten Sagen der griechischen Mythologie erinnert. Die über fast zwanzig Jahre hin von beiden Seiten unnachgiebig geführte Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn schlägt uns ebenso in den Bann wie die Schilderungen der archaischen Rückständigkeit der Insel.
Seit dem Erscheinen des Buches (1975) fasziniert, berührt und befremdet die Erzählung Millionen Leser weltweit. 1977 gewann die in den Dialogen weitgehend wortgetreue, puristische Verfilmung durch die Brüder Vittorio und Paolo Taviani bei den Festspielen in Cannes die Goldene Palme. 1978 erschien die deutsche Übersetzung (»Mein Vater, mein Herr«). Im Original ergänzt der Autor seinen italienischen Text bisweilen durch die entsprechende Phrase in sardischer Sprache, was sehr aufschlussreich ist. Die deutsche Übersetzung belässt dieses Verfahren erfreulicherweise, obwohl natürlich der unmittelbare Vergleich mit dem Italienischen verlorengeht.
In der Erzählung seiner Kindheit und Jugend beschönigt Gavino Ledda nichts – nicht die Lebensbedingungen auf dem Niveau von Tieren, nicht die Bestialität der Menschen, nicht die brachiale Gewalt, nicht die sexuellen Nöte, nicht die existentiellen Ängste. Daher ergreift uns sein Buch auf viel elementarere, schonungslosere Weise als die Romane anderer großer sardischer Schriftsteller mit vergleichbaren Themen – etwa »Diario di una maestrina« von Maria Giacobbe [› Rezension], das elegische »Canne al vento | Schilf im Wind« der Nobelpreisträgerin Grazia Deledda [› Rezension] oder Michela Murgias »Accabadora«, der Bestseller, der 2009 eine Renaissance traditionsbewusster sardischer Literatur auslöste [› Rezension].
Hinweise zu Film- und Audioversionen:
»Padre padrone« auf YouTube suchen
 · Herkunft:
· Herkunft: