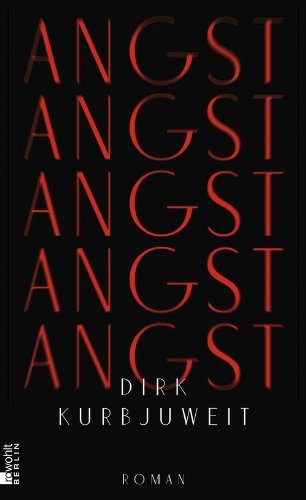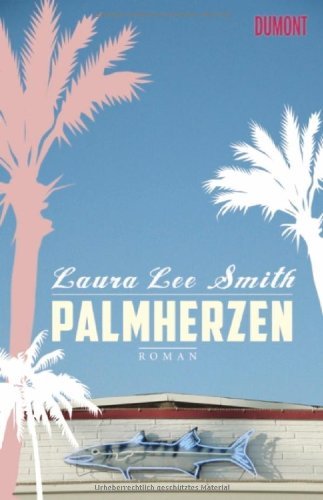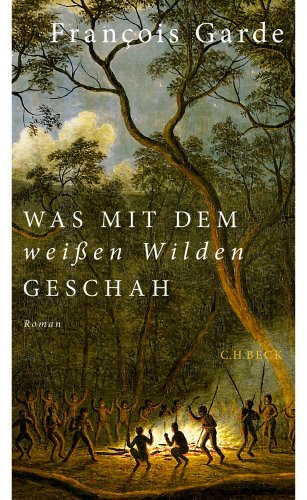
Zwischen den Kulturen
»Ich heiße Narcisse Pelletier und bin Matrose auf der Saint-Paul.« Immer und immer wieder spricht der junge Franzose diesen Satz, um seine Identität nicht zu verlieren. Denn er ist allein am Ende der Welt. Achtzehn Jahre später hat er den Satz und mit ihm alle Errungenschaften seiner Zivilisation vergessen. Übriggeblieben sind nur Fetzen seines Namens: »R'sis- L'tié- Let-Pol«.
Die Saint-Paul ankert am 5. November 1843 in einer einsamen Bucht an der australischen Küste. Ein paar Seeleute gehen an Land, um Süßwasser zu holen. Eine Stunde später kehren sie unverrichteter Dinge und ohne den achtzehnjährigen Narcisse zurück. Die Suche nach ihm bleibt ohne Erfolg. Das Schiff legt ohne ihn ab.
1861 greifen Matrosen eines Frachtschiffs am nahen Strand einen Mann auf, allein, nackt, über und über tätowiert, »der Haut, dem Haar und der Größe nach eindeutig ein Weißer«. In Sydney übergibt man ihn dem Gouverneur, der jedoch mit dem verwilderten Subjekt, das lediglich unverständliche Silben zu nuscheln vermag, nichts anzufangen weiß, ihn in einer Gefängniszelle einquartiert und möglichst schnell wieder loswerden möchte.
Zufällig erfährt Vicomte Octave de Vallombrun von dem Neuankömmling. Seit vier Jahren widmet sich der französische Adlige als Mitglied der »Société de Géographie« der Wissenschaft. Doch er ist frustriert. Im pazifischen Raum sind »terrae incognitae« nicht mehr zu entdecken, und das Leben der »Wilden« hat unter dem Einfluss christlicher Missionare und europäischer Händler seine Authentizität verloren. Den Vicomte zieht es zurück nach Frankreich.
Der »weiße Wilde« erweckt in ihm neues Interesse, und er begegnet ihm bei einer Inaugenscheinnahme, zu der der Gouverneur europäische Repräsentanten der Wissenschaft, der Kurie, des Adels, des Handels und der Seefahrt geladen hat. Im Garten hockt der Mann, »dessen Ohrläppchen zerfetzt und halb abgerissen ist«, »stumm und starr« auf seinen Füßen, nur mit einem Tuch um die Lenden bedeckt, isst und trinkt nur widerwillig und mit den Händen, spuckt den angebotenen Wein voller Ekel aus. Man wendet sich in verschiedenen Sprachen an ihn; er reagiert auf die Unterschiede im »Klang und Rhythmus«, bestätigt »Verstandesschärfe«, aber kein Verstehen, und er spricht selbst nicht. Allein Vicomte Octaves Erwähnung des Kaisers Napoleon löst ein langsam und mühevoll hervorgebrachtes »Po-lon« aus, und weitere Silben folgen. Gesten wie »Hand aufs Herz« nimmt der Wilde auf und ahmt sie nach; Freude und Tränen treten in seine Augen. Alle Anwesenden sind ergriffen, wie es dem Vicomte gelungen ist, Vertrauen zu schaffen und eine unüberbrückbar scheinende Kluft zu überwinden.
Nun spricht alles dafür, dass der rätselhafte Mensch aus Frankreich stammt; die Schiffspassage dorthin bezahlt ihm bereitwillig der Gouverneur, und Vicomte Octave de Vallombrun erhält die Vormundschaft. Wie ein Vater will er sich um seinen Schützling kümmern – und dabei seine einzigartige Chance ergreifen, endlich doch noch bahnbrechende Forschungsergebnisse vorweisen zu können. Was er über die Abenteuer seines Landsmanns »im Exil bei den Wilden« aus erster Hand erfährt, wird er niederschreiben und der »Société« als sein »Abschiedsgeschenk« überreichen.
Wie ein Kleinkind muss Narcisse alles neu erlernen, was zu einem zivilisierten Dasein gehört, Sprache und korrektes Benehmen, und der Vicomte erstattet dem Vorstand der »Société« regelmäßig Bericht über die rasanten Fortschritte seines Zögling. Fragen nach seinem Vorleben beantwortet Narcisse allerdings mit Schweigen – nicht aus Unwillen oder Trotz, sondern weil sie ihm unverständlich sind. Indem er sich der Welt seiner Herkunft nähert, entfernt er sich mehr und mehr von der der Wilden. Erneut gibt er eine Identität auf, um eine andere anzunehmen.
Im September 1861 erreichen Octave und Narcisse Paris, wo sie die Vollversammlung der »Société« erwartet. Der Saal ist überfüllt: feine Herrschaften, Journalisten, Wissenschaftler. Octave hat Narcisse gut auf die Anhörung vorbereitet, muss er doch befürchten, dass er sich in verschüchtertes Schweigen zurückzieht. Dennoch gerät die Veranstaltung zum Desaster. Warum, so wird Octave nach seiner Eingangsrede gefragt, hält sich die Hauptperson im Hintergrund? Wie sicher könne man sein, dass er nicht ein Deserteur oder Schwindler sei, der auf diese originelle Weise unschuldig und kostenfrei nach Frankreich zurückkehren konnte? Und als man Narcisse dann mit Fragen zu Ernährung, Religion, Behausung, Kindererziehung und dem Zusammenleben von Männern und Frauen überhäuft, bringt er nur unverständliche Wortbrocken hervor, »schwer zu interpretieren«. Wenn er kein Schwindler ist, so sei der junge Mann »ein Schwachkopf«, argumentiert an vorderster Front Révérend Père Leroy; er werde ihn in seine »Gebete mit einschließen«.
Der öffentlich »durchlittenen Erniedrigung« folgt eine private Enttäuschung. Zwar empfängt Familie Pelletier – der Vater ist Schuster – den totgeglaubten Sohn mit einem Dorffest und einem Gottesdienst, aber nach Jahren der Entfremdung ist niemandem ein herzliches Wiedererkennen möglich, und um ihn bei sich aufzunehmen fehlt es an Raum und an Geld.
Was soll nun aus dem einstmals zivilisierten, dann verwilderten, dann re-zivilisierten Forschungsobjekt werden? Desillusioniert muss Octave erkennen, dass er Narcisse nun in sein eigenes Leben entlassen muss, ohne jemals Genaueres über die Ureinwohner Australiens von ihm zu erfahren. Als sie sich im Dezember 1867 zum letzten Mal begegnen, ist Narcisse verheiratet und arbeitet als Lagerverwalter des Leuchtturms auf der Insel Ré. Octave führt ihn an Hand seiner Aufzeichnungen immer weiter zurück in die Vergangenheit, dringt Frage um Frage in ihn, »und davor, Narcisse?«, quält ihn damit »im Namen der Wissenschaft«. Narcisse leidet, weicht aus. »Davor war es nicht Narcisse ... Danach war es nicht Narcisse ... Wer warst du?« bedrängt ihn Octave. Schließlich bricht Narcisse zusammen: »Reden ist wie Sterben.«
Alternierend lesen wir die persönlichen Briefe des Vicomte an »Monsieur le Président« und – aus Narcisses Perspektive, aber in der 3. Person geschildert – »was mit dem weißen Wilden geschah«. Allerdings gestaltet auch Octave seine Berichte gern szenisch und dialogisch aus, so dass ein durchweg intensives, lebendiges Leseerlebnis entsteht, das beide Perspektiven und Zeiträume (vor bzw. nach Narcisses Wiederauffindung) erschließt.
Nachdem Narcisse am Strand überrascht feststellt, dass seine Kameraden ohne ihn abgelegt haben, hält er noch ein paar Tage an der Gewissheit fest, sie würden ihn bald abholen. Doch stattdessen wird er Jahre mit den einheimischen Wilden verbringen. Die beachten ihn zunächst gar nicht. Immerhin ist ihm ihre Gleichgültigkeit lieber als die Aussicht, angegriffen und verspeist zu werden. In seiner Einsamkeit am Rande des Stammes – »Nichts, er hatte nichts mit ihnen gemein.« – treiben ihn Fluchtpläne und Selbstmordgedanken um. Mit der Zeit wandelt sich jedoch seine Haltung und seine Gefühlswelt. Schmerz, Einsamkeit und der Verlust jeglicher Zwischenmenschlichkeit weichen elementaren Nöten: »Angst, Hunger, Schmerz, Durst, Langeweile, Erschöpfung, Verzweiflung, Wut, Niedergeschlagenheit«. Endlich ergibt er sich seinem Schicksal zwischen der »Unfähigkeit, in diesem Stamm zu leben, [und der] Unfähigkeit, ohne ihn auszukommen«. Egal wohin es die Wilden zieht, er folgt ihnen mit Abstand. Sie essen, was sie jagen oder fangen können, und sie leben ohne Zeit und Ziel. Sie geben ihm den Namen »Amglo«, was »Sonne« heißt.
François Gardes preisgekrönter Roman »Ce qu'il advint du sauvage blanc«  (mit dem Prix Goncourt geadelt und von Sylvia Spatz übersetzt) beruht auf Tatsachen. Die abenteuerliche Biographie des französischen Matrosen Narcisse Pelletier (1844-1894) inspirierte den Autor. Anders als dem literarischen Vorfahr Robinson Crusoe nützen Narcisse Pelletier die Errungenschaften der zivilisatorischen und kulturellen Neuzeit rein gar nichts. Während sich Daniel Defoes Held mit Gott und Ratio seine Insel untertan macht und den wilden Freitag auf eine höhere Daseinsebene befördert, symbolisiert Narcisses Nacktheit, wie er restlos allem, was einstmals (vermeintlich) wichtig war, beraubt und auf seine bloße Körperlichkeit zurückgeworfen ist. Im Vergleich zu den Wilden ist er schwach; ausgesetzt in der Wildnis, ist er nicht überlebensfähig. Freilich ist François Garde auch nicht Johann Gottfried Seume; Narcisses Insulaner sind niemals »edle Wilde«.
(mit dem Prix Goncourt geadelt und von Sylvia Spatz übersetzt) beruht auf Tatsachen. Die abenteuerliche Biographie des französischen Matrosen Narcisse Pelletier (1844-1894) inspirierte den Autor. Anders als dem literarischen Vorfahr Robinson Crusoe nützen Narcisse Pelletier die Errungenschaften der zivilisatorischen und kulturellen Neuzeit rein gar nichts. Während sich Daniel Defoes Held mit Gott und Ratio seine Insel untertan macht und den wilden Freitag auf eine höhere Daseinsebene befördert, symbolisiert Narcisses Nacktheit, wie er restlos allem, was einstmals (vermeintlich) wichtig war, beraubt und auf seine bloße Körperlichkeit zurückgeworfen ist. Im Vergleich zu den Wilden ist er schwach; ausgesetzt in der Wildnis, ist er nicht überlebensfähig. Freilich ist François Garde auch nicht Johann Gottfried Seume; Narcisses Insulaner sind niemals »edle Wilde«.
Ohnehin lebt der Stamm auf seiner Insel bereits in einem kulturellen Reservat. Der Vicomte findet auf seinen Reisen zu seinem Bedauern keine ursprünglichen Menschen mehr; überall haben Missionare (kirchliche und merkantile) den »Wilden« längst das Nacktsein abgewöhnt und ihnen dafür etwas von ihrer eigenen, turmhoch überlegenen Zivilisation mitgebracht. Bald werden auch Amglos Leute ihre Identität aufgeben müssen.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2014 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: