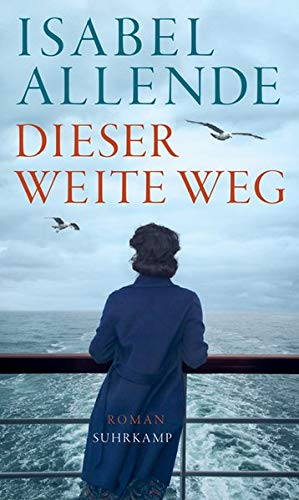Langsame Jahre
von Fernando Aramburu
Als Achtjähriger wird der Erzähler in der Familie seiner rigorosen Tante in San Sebastiàn aufgenommen, wo er im Arbeitermilieu unter der Franco-Diktatur aufwächst. Ist sein älterer Cousin in den baskischen Widerstand involviert? Und wird der Autor seinen Roman wirklich schreiben?
Wie es war – aus zweiter Hand
Was man kaum erwarten würde: Dieses Buch besticht durch seinen hintergründigen Humor, die leise Ironie, den trockenen, derben Realismus seiner Beschreibungen. Darüber hinaus wartet es mit einer ganzen Reihe weiterer Originalitäten auf, die für ein unterhaltsames und gleichzeitig qualitätsvolles Leseerlebnis sorgen. Dies sei vorausgeschickt, weil der Titel und das historisch-politische Thema mit Ernsterem, Tristerem rechnen lassen. Dass der Autor dies keineswegs ausblendet, sondern mit nachhaltiger Wirkung einzubinden weiß, beweist seine Meisterschaft. Jedenfalls liest man »Langsame Jahre« nicht in erster Linie als ›politischen Roman‹.
Vier Jahrzehnte lang lähmte die Politik des Francisco Franco das öffentliche Leben Spaniens. Noch bis kurz vor seinem Ende (1975) unterschrieb der Generalísimo »mit schlaffer, zittriger und immer hinfälligerer Hand … Todesurteile« für missliebige oder vermeintliche Gegner. Während anderswo in der Welt das Leben immer rascher pulsierte, herrschte in Spanien eine Zeit »historischen Dahinsiechens«, »langsame Jahre«, denn, so empfand es der Erzähler, »eine Minute der Diktatur … dauerte anderthalb oder zwei Minuten«. Aus dem Alltag jener Zeit erzählt Fernando Aramburu, 1959 in San Sebastián geboren, in seinem 2012 erschienenen Roman »Años lentos«, den Willi Zurbrüggen ins Deutsche übersetzt hat. Der Autor zeichnet darin ein Bild kleinbürgerlichen Lebens im Baskenland gegen Ende der Sechzigerjahre. Eine alleinerziehende Mutter – der »Kerl« von Vater hat sich abgesetzt – kann ihre drei Söhne unmöglich aus eigener Kraft durchbringen, doch ihre in San Sebastián verheiratete Schwester, Tante Maripuy genannt, lässt sich breitschlagen, den jüngsten, stillsten und artigsten Sohn aufzunehmen. Doch die knappen räumlichen und finanziellen Ressourcen der Arbeiterfamilie Barriola setzen ihrer Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe Grenzen.
Als sich der Protagonist und Ich-Erzähler Anfang 1968 als Achtjähriger mit einem Karton voller Hühner als Mitbringsel auf den Weg in die Stadt machen darf, gilt er als »Glückspilz«. Doch am Ziel seiner Reise begrüßt ihn nur die Tante herzlich. Onkel Visentico ignoriert ihn, und der gut zehn Jahre ältere Cousin Julen, der fortan sein Zimmer mit ihm teilen muss, demütigt ihn gnadenlos. Allnächtlich durchleidet der Junge ein grausames Ritual, wenn Julen von seinen Freunden eintrudelt, die letzte Zigarette des Tages raucht, seine infernalisch stinkenden Füße entblößt und den vor Heimweh weinenden »Scheißer aus Navarro« all seine Verachtung spüren lässt: »Wärst du ein Baske, würdest du nicht weinen.«
Materiell hängt die Familie Barriola am Tropf der örtlichen Seifenfabrik. Onkel Visentico arbeitet dort als Handlanger, zu Hause verdienen die anderen durch Einwickeln der Seifenstücke ein paar Peseten dazu. Nach der Arbeit zieht es Visentico in die einzige Bar des Viertels, wo er nichts sucht als seinen Frieden. Jedem Streit geht er aus dem Weg, auch bei seiner Frau, der er »mehr Befehlsgewalt als Jesus Christus« zuschreibt: »So stark wie du bist, kannst du dich selbst verteidigen.«
Doch nicht einmal die Tatkraft Tante Maripuys, dieser robusten Löwin, die ihre Familie immer wieder gegen üble Nachreden aller Art verteidigt, vermag die Zügellosigkeit ihrer schwierigen siebzehnjährigen Tochter einzugrenzen. Mari Nieves, »nicht besonders hübsch, gesund und kräftig, ein bisschen mollig«, hat den »starken, zu Herrschsucht neigenden Charakter« ihrer Mutter, dazu jedoch einen »maßlosen sinnlichen Appetit«. Bald ist sie schwanger und weiß selbst nicht so genau von welcher beiläufigen Gelegenheit. Nun ist Tante Maripuy vor die schwierige Aufgabe gestellt, einen Jungen aufzutreiben, der schlichten Gemüts genug ist, um Maris ramponierte Ehre durch Verehelichung zu kitten
Es sind die einfachen Leute, die mit ihrem individuellen Schicksal geschlagen sind, es hinnehmen, wie es kommt, und irgendwie damit klarkommen. So rau, vulgär, missgünstig und schadenfroh sie bisweilen miteinander umgehen, so wenig schmälert das ihren Zusammenhalt. All diese Episoden zeugen von der Enge in den ärmlichen Lebensumständen der Menschen und sind doch so leichthin erzählt, dass ein feiner persönlicher Humor im Vordergrund steht. Im Hintergrund aber überwölbt die politische Sphäre die private Ebene immer bedrohlicher. Wie dicke Tinte dringt der spanische Franquismus in das Alltagsleben der Familie, des Dorfes, des Baskenlandes und verdrängt die Leichtigkeit. Neben Mari Nieves und ihrem Bastard erweist sich im weiteren Verlauf Cousin Julen als das eigentliche Sorgenkind, dessen undurchschaubare Aktivitäten ihn, seine Familie und andere gefährden können.
Bald erkennt Julen die charakterlichen Qualitäten seines kleinen Zimmergenossen, unseres Erzählers. Eines Nachts vertraut er ihm sein Geheimnis an: Unter seiner Matratze hütet er eine baskische Flagge. Insgeheim ist er nämlich Mitglied einer patriotischen Untergrundgruppe, die, angestachelt vom fanatischen Pfarrer, darauf zielt, Widerstand gegen Francos Spanisierungspolitik zu leisten. Ihr identitätsstiftendes Medium ist die baskische Sprache: »Baske ist nur der, der Euskera spricht.« Deswegen quält sich Julen, ein großmäuliger Hitzkopf und »miserabler Schüler«, nach des Tages Arbeit in einer Brauerei des Nachts mit Vokabeln und Grammatik. Sein Mitbewohner wird zum Zuhörer seiner hochfliegenden Ambitionen – er werde als Attentäter Francos in die Geschichte eingehen –, kann damit aber nicht viel anfangen. Doch auch der Junge registriert, wie der Überwachungsdruck im verhängten Ausnahmezustand steigt und polizeiliche Willkür jeden treffen kann.
Aber gibt es dieses Buch überhaupt? Was uns Fernando Aramburu hier vorlegt, ist lediglich ein Werkstück im Entstehungsprozess. Er gibt vor, einen »wahrhaftigen« Roman über ein Viertel von San Sebastián zur Zeit seiner eigenen Kindheit schreiben zu wollen. Darüber hat er sich in der Planungsphase offensichtlich mit einem guten Bekannten gleichen Alters unterhalten und darum gebeten, ihm authentisches Material zukommen zu lassen. Dieser Zeitzeuge hat »Herrn Aramburu« verabredungsgemäß seine Erlebnisse formuliert, so wie ihm »der Schnabel gewachsen ist«, ohne sich »um Struktur und Stil« zu kümmern (»das ist ja Ihre Sache«).
So wie es zwischen den Buchdeckeln aussieht, hat »Herr Aramburu« allerdings einfach die Texte seines Lieferanten arrangiert und dazwischen seine eigenen Anmerkungen in 39 »Notaten« festgehalten. Das sind hingeworfene Notizen und Skizzen, Überlegungen, Ideen, Schriftsteller-Tricks, inhaltliche Ergänzungen, Dialogentwürfe, Episoden, Stilfragen, die er abarbeiten müsste, wenn er das konzipierte Werk denn jemals fertigstellen würde – was durchaus fraglich erscheint. Denn der Autor will nur verarbeiten, was »literarisch etwas her macht«, und sich überhaupt nur Zeit dafür nehmen, »wenn ich merke, dass die Geschichte flutscht«.
Einen Roman (vorgeblich) in den frühen Phasen seiner Entstehung, als Konzept, als bloße Materialsammlung vorzulegen ist zweifellos eine originelle und amüsante literarische Idee. Die »Notate« führen vor Augen, welch grenzenlose Gestaltungsfreiheiten ein Schriftsteller genießt, und das unfertige Produkt illustriert die kritische Distanz zu seiner »Quelle«. Der Ich-Erzähler berichtet sein eigenes Erleben ungekünstelt, ohne Hintergedanken, mithin glaubwürdig, muss aber einräumen, gewisse Umstände selbst nur aus zweiter Hand oder gar gerüchteweise vernommen zu haben. Gleichzeitig ersucht er um Anonymisierung seiner Geschichte, um jegliche Wiedererkennung zu vermeiden. Die Vorgänge in der Franco-Diktatur – Bespitzelungen, Feigheiten, Verdächtigungen, Geheimaktionen, Manipulationen … – sind unliebsame Wahrheiten, die besser niemals ans Licht des Tages kommen sollen, könnten sie doch heute noch Missstimmungen hervorrufen. Wie der Erzähler in der Deckung der Anonymität bleiben, keine Verantwortung aufgebürdet bekommen möchte, so zieht sich in diesem Spiel mit dem Leser auch der Autor aus der Affäre, indem er sich der Gestaltung verweigert.
Fernando Aramburu wurde mit seinem 2016 veröffentlichten Buch »Patria«  weit über seine Landesgrenzen hinaus bekannt. Der in viele Sprachen übersetzte Roman, der sich mit dem politischen Terror der ETA im Baskenland, mit seinen Tätern und Opfern, mit seinen Langzeitfolgen auf die Menschen und die Gemeinschaft auseinandersetzt, wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet (u.a. dem »Premio Strega Europeo 2018«). Im Rückblick erscheint »Años lentos«, vier Jahre zuvor erschienen, in mancher Hinsicht wie ein Vorentwurf zu seinem Bestseller.
weit über seine Landesgrenzen hinaus bekannt. Der in viele Sprachen übersetzte Roman, der sich mit dem politischen Terror der ETA im Baskenland, mit seinen Tätern und Opfern, mit seinen Langzeitfolgen auf die Menschen und die Gemeinschaft auseinandersetzt, wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet (u.a. dem »Premio Strega Europeo 2018«). Im Rückblick erscheint »Años lentos«, vier Jahre zuvor erschienen, in mancher Hinsicht wie ein Vorentwurf zu seinem Bestseller.
 · Herkunft:
· Herkunft: