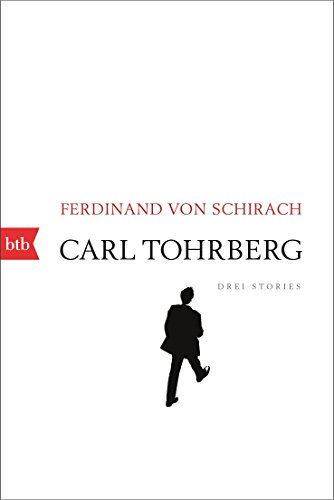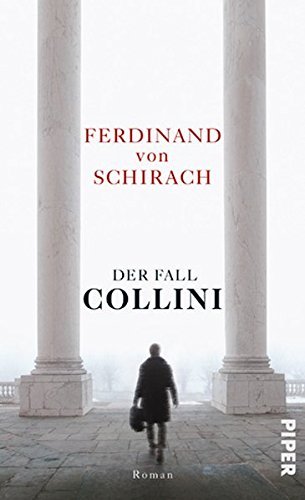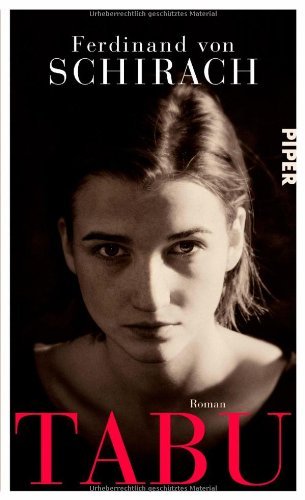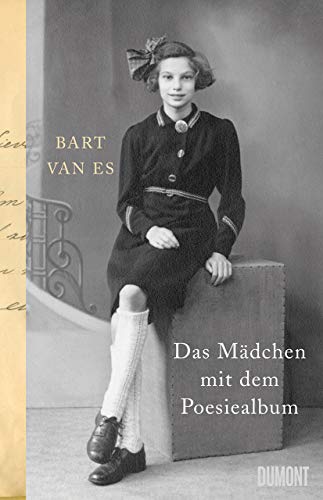Kaffee und Zigaretten
von Ferdinand von Schirach
Erlebnisse, Begegnungen, Ansichten, Geschichten, Porträts, Gedanken, Betrachtungen, Zitate, Gerichtsfälle, Sentenzen
Kluges für zwischendurch
Beiläufiges und Schwerwiegendes enthält dieses Buch. Sein Text ist in 48 Kapitel gegliedert, die zwischen ein paar Zeilen und acht Seiten lang sind. Ein Gliederungsprinzip, eine Gesamtstruktur ist nicht erkennbar. Der Ton ist durchweg ernst, reflektierend, zwischen den Zeilen blitzt manchmal ein Funken Ironie auf. Der Autor berichtet mehr als er erzählt. Er trägt seine klaren Ansichten vor, und da stehen sie dann. Von Schirach missioniert nicht.
Das Cover knüpft stilistisch an die früheren Bestseller-Erfolge an, doch das Buchinnere bringt anderes: autobiografische Episoden (Erlebnisse, Erinnerungen, Begegnungen, Literatur- und Filmerfahrungen), Rechtsfälle (auf die bekannte Weise erzählt wie Kurzgeschichten), bedeutsame Ereignisse aus Politik, Kultur, Gesellschaft. Was die einzelnen Gegenstände berichtenswert macht, wird oft erst in ihrer Kombination deutlich. Einem Gerichtsurteil von 1962 stellt der Autor eines von 2017 gegenüber, woraus ein Wandel der Moralvorstellungen erkennbar wird. Die Charaktere der drei porträtierten RAF-Anwälte Otto Schily, Hans-Christian Ströbele und Horst Mahler tragen die Gegensätze in sich selbst. Eine Seite lang berichtet der Autor von einer Jordanienreise und einem Ausflug in die Wüste, übergangslos verblüfft der nächste Absatz: »Am 4. Januar 1960 will Albert Camus mit der Bahn nach Paris fahren.« Das Verfahren ist Prinzip.
Wer übrigens auf Interna aus der bedeutenden Familie von Schirach spekuliert, wird enttäuscht sein. Nur das Eingangskapitel gewährt ausführlicheren Einblick in das Elternhaus des 1964 geborenen Ferdinand. Noch in den Sechziger-, Siebzigerjahren pflegte man dort den strengen, düsteren Lebensstil eines elitären Adelsgeschlechts: Tantenbesuche, Fuchsjagden, diskretes Personal. Das feinfühlige Kind (»gefährdet«) wird einem kargen Jesuiteninternat in einem finsteren Schwarzwaldtal überlassen. Der Vater ist nur durch Postkarten präsent, stirbt schon 1980. Der Erzähler betrachtet sein damaliges Ich in der Distanz der 3. Person.
Der berüchtigtste Vorfahr, Großvater Baldur, scheint nur kurz in gespenstischem Licht auf. Der Autor begegnet einer Anwaltskollegin aus Kiew und erfährt, dass deren jüdische Großeltern aus Wien verschleppt und ermordet wurden. Baldur von Schirach war damals der verantwortliche Reichsgauleiter in Wien. Ob und gegebenenfalls wie der entsetzliche historische Zusammenhang thematisiert wurde, bleibt unerwähnt. Vielmehr wandern die Gedanken weiter zu Roland Freisler, dem Präsidenten des Volksgerichtshofs, und Fabian von Schlabrendorff, einem jungen Hitlerattentäter und späteren Richter am Bundesverfassungsgericht, schließlich zum Begriff der Würde des Menschen und der Bedeutung der Menschenrechte.
Anstatt packender Erzählungen von verstörenden Kriminalfällen also eine Sammlung sehr persönlicher Essays und Geschichten – konkrete Ereignisse als Kondensationskerne für mehr oder weniger ausführliche Betrachtungen über die Zeitläufte, Politik, Moral, Philosophie, Gesellschaft.
Das Erstaunliche ist, dass die kleinen textlichen Formen dieses Buches eine nicht minder wuchtige Wirkung hervorrufen als die großen Erzählungen. Denn von Schirachs bestechender Schreibstil ist derselbe geblieben. Seine markante Lakonie erinnert von jeher an Hemingway. Mit dem teilt von Schirach eine leicht fließende, scheinbar absichtslose Sprache, die Simplizität des parataktischen Satzbaus, die Reduktion auf das Notwendigste, den Verzicht auf Ausschmückung und Rhetorik, die große Präzision und Nüchternheit in der Wortwahl, die ohne Pathos auskommt. Wie bei Hemingway steigt aus diesem Textgewebe oft zarte, melancholische Poesie. »An einem winzigen Tisch saß die junge Frau. Sie weinte. Sie weinte, weil ihr Kind tot, sie eingesperrt und ihr Freund nicht mehr da war.«
Die Einfachheit ist Programm. »Das Komplizierte, so wird uns gesagt, sei das Wertvolle. Aber das ist Unsinn. In Wirklichkeit ist das Einfachste das Schwierigste.« Von Schirach zitiert Hemingway (aus »Paris, ein Fest fürs Leben«) und bewundert Michael Haneke – dessen Filme seien wie Haikus: »Sie sagen genau das, was sie sagen wollen, nichts anderes.« Ebenso ›funktionieren‹ ja auch von Schirachs Erzählungen: Sie berichten, was geschieht, mehr nicht. Sie dramatisieren nicht, bauschen nicht auf, kommentieren nicht einmal. Sie zeigen einfach ein Geschehnis, und es ist das geradezu wortlos Gezeigte, das den Leser erschüttert. Denn oft sind es schiere Abgründe.
Anders als Hemingway, für den ›große Worte‹ nach den entsetzlichen Kriegen und Ideologien seiner Zeit ›verbraucht‹ waren, scheut von Schirach vor ihnen nicht zurück, behandelt sie aber auch unpathetisch, grundsätzlich. Großartig die Ausführungen über Menschenwürde, die »kein Teil des Menschen wie ein Arm oder ein Bein« sei, sondern »nur eine Idee, sie ist zerbrechlich, und wir müssen sie schützen.« Die Menschenrechte, festgehalten in den »heutigen Verfassungen der freien Welt – das sind unsere Siege über die Natur, Siege über uns selbst.« Großartig die schlichte Klarheit der Thesen: »Heimat ist kein Ort, es ist unsere Erinnerung.« – »Hass ist die furchtbarste, die einfältigste und die gefährlichste Haltung zur Welt.« – »Sich selbst zu lieben, das ist zu viel verlangt. Aber die Form zu wahren, es ist unser letzter Halt.«
Ein lebenskluger, ein begabter Autor.
Ein weises, ein bereicherndes Buch.
 · Herkunft:
· Herkunft: