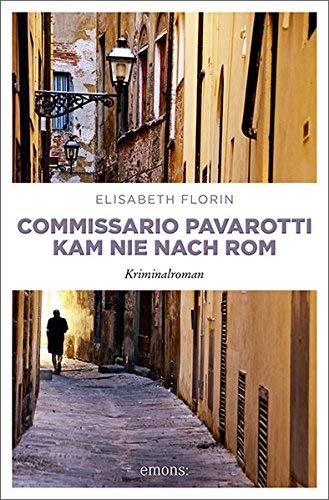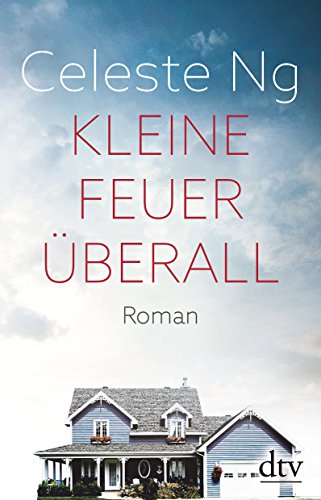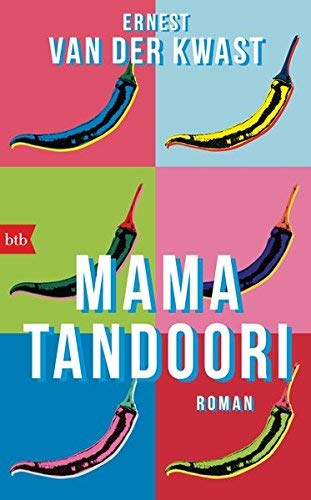
Mama Tandoori
von Ernest van der Kwast
Eine junge Inderin kommt 1969 in die Niederlande, heiratet einen angehenden Arzt und zieht mit ihm drei Söhne groß. Der jüngste schrieb dieses amüsante, respektvolle Porträt seiner unkonventionellen, um Überraschungen, Mut, Energie, Worte und manche Peinlichkeit niemals verlegenen Mutter.
Die Weltmeisterin der Vergleiche
Was ist die schönste Liebeserklärung, die ein Sohn seiner Mutter widmen kann? Der Niederländer Ernest van der Kwast weiß es. Er hat ein Buch über sie geschrieben. Es ist äußerst unterhaltsam, denn Veena Ahluwalia ist nicht nur eine unglaublich energische Persönlichkeit, sondern durch ihre Heirat mit dem Niederländer Theodorus Henricus van der Kwast prallen zwei Kulturen, ja Welten aufeinander, dass die Funken sprühen.
In zehn vergnüglichen Kapiteln wirft der Sohn Schlaglichter auf Mutter, Vater, Brüder, Onkel und Tanten. Er stützt sich auf eigene Erlebnisse und Beobachtungen sowie darauf, was ihm aus der Verwandtschaft zu Ohren gekommen ist.
Fürs Leben geprägt wurde Veenas außergewöhnliches Wesen durch ihre Kindheit und Jugend. Sie wurde kurz vor der Unabhängigkeit Indiens im späteren Pakistan geboren, als der Hass zwischen Hindus und Moslems beidseitig zu Verfolgungen und Gemetzel eskalierte. Die hinduistische Familie floh mit ihrem Säugling über Kashmir nach Indien, wo sie in einem kleinen Dorf Frieden zu finden hofften. Aber »Armut, Krieg und neun Geschwister haben mehr als nur einen Kratzer im Charakter meiner Mutter hinterlassen«: »etwas Elementares […], das nicht aufzuhalten war, eine Naturgewalt wie ein ausbrechender Geysir«.
Im Jahr 1969 kommt Veena Ahluwalia in die Niederlande. Sie will Krankenpflegerin werden und bezieht ein Zimmer im Schwesternwohnheim. Ein Student der Medizin verliebt sich in die aparte junge Exotin, ein paar Jahre später heiraten sie, erwerben ein Häuschen in der Bloemstraat und bekommen drei Söhne (den ersten 1977, den jüngsten, Ernest, 1981 in Bombay, wo die Schwangere gerade auf Verwandtenbesuch weilt). Der Vater ist Arzt, die Jungs haben »eine gute Kindheit«, die van der Kwasts werden eine ganz normale Familie, wie es von außen scheint.
Das Innenleben ist jedoch turbulent. Der Autor reiht Episode an Episode, die die wahren Verhältnisse offenlegen. Mehrere rote Fäden, running gags und stehende Wendungen ziehen sich durch die Kapitel, wie etwa bestimmte unangenehme Gerüche, Mamas ins Absurde übersteigerte Sparsamkeit, die trockenen Sprüche und feuchten Niesanfälle Ashirwads, des geistig behinderten Erstgeborenen, allerlei interkulturelle Divergenzen und das Nudelholz, das hier tatsächlich Zwecken dient, die man ansonsten nur aus Cartoons kennt. Neben seiner energiegeladenen Ehefrau ist der Vater zu Hause zur Bedeutungslosigkeit verdammt, was ihm immer wieder den Stoßseufzer »Wäre ich bloß eine Ratte in Delhi …« entlockt.
Das unangefochtene Zentralgestirn dieses Universums ist »Mama Tandoori«, wie Veena genannt wird, seit sie für Vater auf traditionell indische Weise Hühnchen zubereitet: »Tandoori Chicken«. In der Familie hält sie alle Fäden in der Hand, vor allem, wenn wichtige Entscheidungen anstehen und schon gleich, wenn es um Geld geht. »In einem anderen Leben wäre sie ein Diktator gewesen […]. In diesem Leben war sie nur meine indische Mutter.« Selbst Außenstehende hat die Matriarchin das Fürchten gelehrt. Lange bevor ihr Porträtist geboren war, soll der Mitbewohner eines Mietshauses das gemeinsame Leben unter einem Dach nicht mehr ausgehalten und mit den Worten »sie ist ein Teufel« das Weite gesucht haben.
Unschlagbar ist sie beim Handeln und Tauschen. Beinhart treibt sie jeden Preis in den Keller beziehungsweise in atmosphärische Höhen, bis sich ihr Gegenüber entwaffnet und sprachlos geschlagen gibt. Bis dahin hat Vater »Sprechverbot« und darf »lediglich atmen und nicken«, um seine Unterstützung zu signalisieren. So vergrößert sie stetig den Wohlstand der Familie, indem sie immer wieder schimmernde Teile aus ihrem materiellen Grundstock – zwei Koffer voller Schmuck, die sie mit nach Europa gebracht hatte – eintauscht, auf diese Weise das erste Häuschen erwirbt und gegen immer wertvollere einhandelt.
Die Kehrseite von »Mama Tandooris« kaufmännischem Geschick ist die extreme Sparsamkeit, mit der sie die Nerven ihrer Familie strapaziert. Um die Wasseruhr auszubremsen, sind die Mitglieder der jungen Familie gehalten, aus der Schule, dem Sportverein und vom Arbeitsplatz Wasser nach Hause zu schmuggeln. Später quillt das Haus über von palettenweise heimgekarrten Sonderangeboten und Objekten für gewinnbringende Tauschgeschäfte.
Eine starke Frau wie Veena verlässt nie die Hoffnung. Mit Ashirwad, ihrem Ältesten, zieht sie von Spezialist zu Spezialist und reist, als der medizinische Befund feststeht, nach Lourdes, davon ausgehend, dass dort ein Wunder geschehe. Dass es ausbleibt, muss sie schweren Herzens hinnehmen. Leider erfüllt auch ihr Jüngster nicht, was sie sich für ihn in den Kopf gesetzt hat. Das hyperaktive Kind tobt sich zwar erfolgreich in der Leichtathletik aus – »Jaldi, Jaldi!« (»Schneller, schneller!«), feuert sie ihn an –, doch nach dem Abitur gibt er das Wirtschaftsstudium auf, um Schriftsteller zu werden. Solch einen »Bösen Geist« kann nicht einmal sie mit einem in Brand gesteckten Müllsack verscheuchen.
Einfach witzig sind die kreativen Vergleiche, mit denen »Mama Tandoori« ihren Argumenten unwiderstehliche Würze verleiht (wenn auch keine zusätzliche Überzeugungskraft, so maßlos sind sie übertrieben). Die meisten beziehen sich auf die Lebensverhältnisse in ihrer fernen Heimat, deren Grundmotive sie blumig und flexibel variiert. »Dein Vater war so arm wie eine Ratte in Delhi.« Als Assistenzarzt verdient er gerade mal so viel »wie ein Rikschaläufer in Bangalore«. Egal wie wenig eine Ware kosten soll, weiß Veena van der Kwast: »In Indien bekommt man dafür hundert Etagenbetten!« Egal wie hoch ein Kaufangebot bereits ist, die eiserne Verkäuferin schmettert es verächtlich ab: »Zu diesem Preis bekommt man in Indien nicht mal eine Wellblechhütte!«
Ernest van der Kwasts Roman »Mama Tandoori«  (im niederländischen Original bereits 2010 erschienen und jetzt von Andreas Ecke ins Deutsche übersetzt) ist eine kurzweilige Sammlung zugespitzter Schoten, von denen nicht wenige zum Fremdschämen einladen (wobei man sich manchmal fragt, wer am ehesten Grund zum Schämen hat: Mutter, Vater, Sohn – oder keiner der drei?). In seinem Elan mag der Autor den humoristischen Bogen gelegentlich überspannt haben. Aber durchweg spürt man das tiefe Verständnis des Sohnes für die Eigenarten seiner Mutter und die Anerkennung dessen, was sie in allen Lebenslagen für ihre Familie erkämpft hat. Unter der bisweilen zum Schreien komischen Oberfläche spüren wir stets einen Grundton berührender Melancholie.
(im niederländischen Original bereits 2010 erschienen und jetzt von Andreas Ecke ins Deutsche übersetzt) ist eine kurzweilige Sammlung zugespitzter Schoten, von denen nicht wenige zum Fremdschämen einladen (wobei man sich manchmal fragt, wer am ehesten Grund zum Schämen hat: Mutter, Vater, Sohn – oder keiner der drei?). In seinem Elan mag der Autor den humoristischen Bogen gelegentlich überspannt haben. Aber durchweg spürt man das tiefe Verständnis des Sohnes für die Eigenarten seiner Mutter und die Anerkennung dessen, was sie in allen Lebenslagen für ihre Familie erkämpft hat. Unter der bisweilen zum Schreien komischen Oberfläche spüren wir stets einen Grundton berührender Melancholie.
 · Herkunft:
· Herkunft: