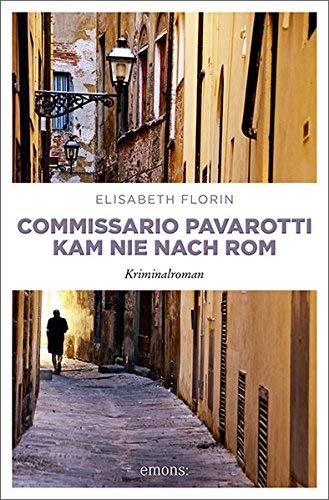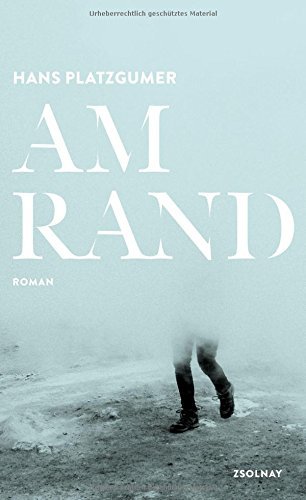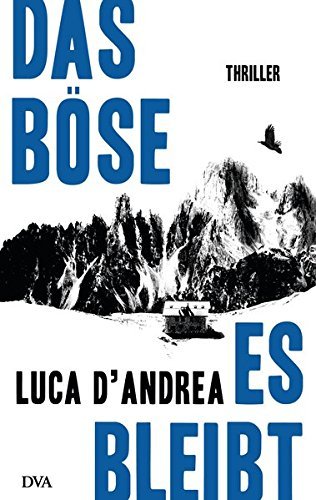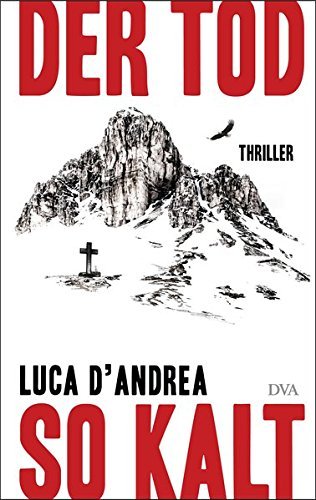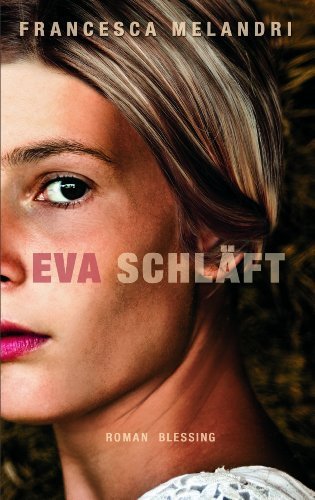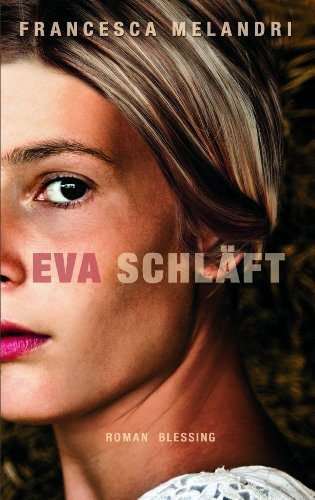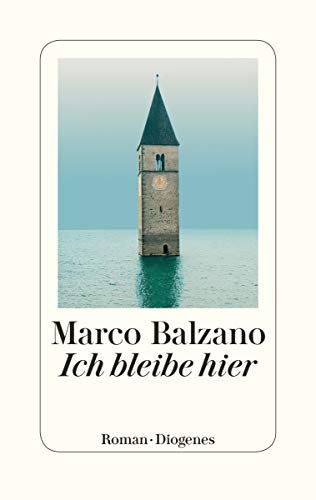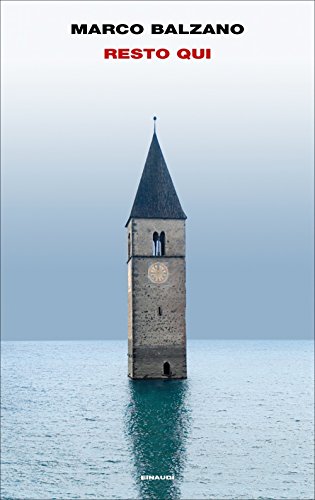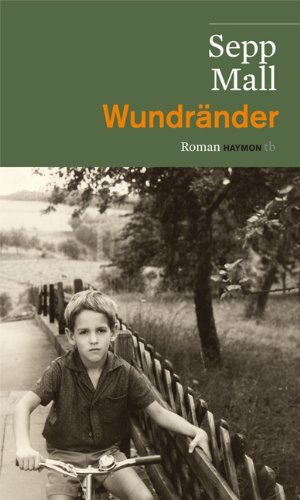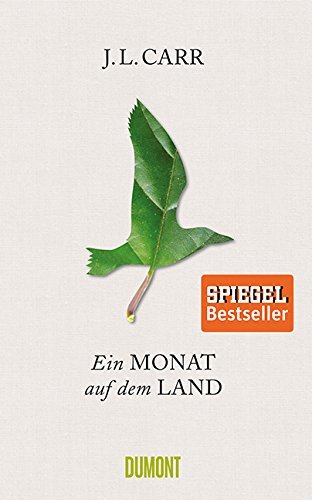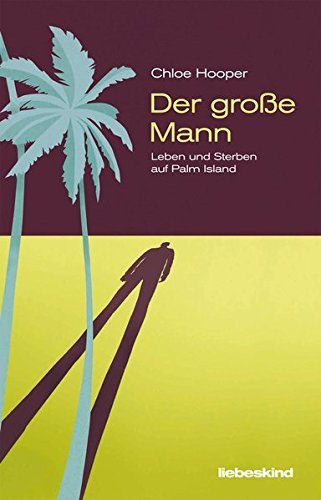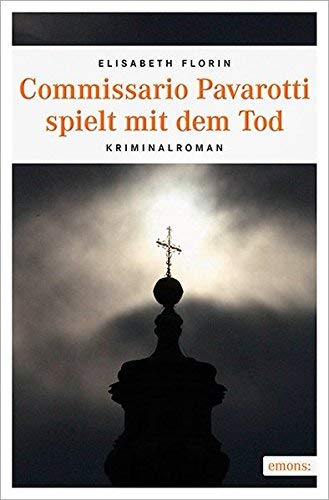
Alles auf Schwarz
Das Dorf Katharinaberg, etwa 25 Kilometer westlich von Meran, wird manchem Südtirol-Touristen, der Ruhe und Idylle sucht, ein Begriff sein. Es liegt abseits der Durchgangsstraßen hoch droben im Schnalstal, und man erreicht es am aufregendsten über den Meraner Höhenweg, dessen Name Programm ist. Kann sich ausgerechnet hier etwas ereignen, das Stoff für einen 350-Seiten-Krimi bringt?
Und ob. Elisabeth Florin hat nun schon den dritten Band einer Serie veröffentlicht, deren Held Luciano Pavarotti ist – weder verwandt noch verschwägert noch ein Wiedergänger des 2007 verstorbenen italienischen Opernsängers, sondern Commissario in Meran. Die Krimis spielen nicht nur in der Gegend, sondern auch mit manchen Vorurteilen und Klischees – was die Lektüre reizvoll macht, egal ob vor Ort oder im heimischen Wohnzimmer genossen.
Wie uns hier die Katharinaberger aus den letzten sechzig Jahren vorgestellt werden, straft jeden sonnig-bunten Tourismusprospekt Lügen. Die Autorin malt sie so düster, unfreundlich und feindselig, dass man sich nicht einmal in der Not zu ihnen verirren möchte. Da sind lauter psychisch und moralisch Angeschlagene und Psychopathen, und selbst als Seelsorger ist man nicht davor gefeit, zum brutalen »Prügel-Pfarrer« zu verkommen. Kurz: »Dieses ganze Dorf ist ... böse.«
Das ist gut für die Krimiatmosphäre, und die Touristen wissen's ja nicht. Damit das Örtchen für sie noch schöner wird, soll die Abrissbirne einem seit langer Zeit leerstehenden Wohn- und Wirtshaus den Garaus machen. Doch ehe sie richtig loslegen kann, wird die Baustelle stillgelegt, als in einem uralten verschlossenen Gang (vielleicht ein unterirdischer Fluchtweg der Ritterburg von Juval?) das Skelett eines kleinen Kindes gefunden wird.
Zügig rückt die Polizei aus Meran samt Spurensicherung an, geleitet von Commissario Pavarotti. Es braucht nicht viel, da kommt ihm ein Fall aus den Anfängen seiner Laufbahn in den Sinn, und es ist keine angenehme Erinnerung. Denn damals verschwand ein dreijähriger Junge spurlos. Pavarotti war da noch kein sonderlich durchsetzungsfähiger Beamter, eher ein Schluff, ein Versager (was ihm bis heute nachhängt), und sein Chef, schwer belastet durch familiäre Probleme, interessierte sich mehr für Alkohol als für Dienstliches. So verlief die Suche nach dem vermissten Jungen ziemlich schludrig und ohne Ergebnis.
Sollte es sich also bei dem gruseligen Fund womöglich um die Überreste des 1997 verschwundenen Johannes Zomba handeln? Um dieser Frage nachzugehen, muss Pavarotti auf zwei Zeitebenen recherchieren, in der Gegenwart und in der Vergangenheit, die bis ins Jahr 1955 zurückreicht. Dadurch erfahren auch wir erst später in die Reihe einsteigenden Leser etwas über das bewegte Vorleben des Commissario. Denn direkt vor Ort agiert eine ihm bestens vertraute Hobbyspürnase und langjährige Freundin. Liselotte von Spiegel (»Lissie«) ist eigentlich in Frankfurt am Main zu Hause. Schon seit Kindesbeinen erwanderte sie bei vielen Reisen mit ihrem Vater die Dolomiten und lernte die Region lieben. Als sie vor zwei Jahren ihren Job als Bankmanagerin in Frankfurt aufgab, zog sie nach Südtirol.
Wie sie damals – im wahrsten Sinne des Wortes – in Luciano Pavarottis Hände fiel, nicht nur ein Techtelmechtel mit ihm hatte, sondern sich sogar in seine Mordermittlungen einmischte, erschließt sich aus diesem dritten Teil der Romanserie nicht vollständig, was aber ohne Nebenwirkungen bleibt. Relevant ist, dass eine Kugel aus Pavarottis Dienstwaffe sie bei einer Verfolgungsjagd am Kopf traf und Teile ihres Gehirns zerstörte. Nach einem dreiviertel Jahr neurologischer Behandlung holte Pavarotti, von Schuldgefühlen gequält, Lissie im Krankenhaus ab, um sich um sie zu kümmern, doch sie erkannte ihn kaum wieder. Sein Angebot, bei ihm einzuziehen, schlug sie aus. Sie wollte partout lieber hinauf in das Dorf in den Bergen.
Liselotte von Spiegels Weg nach Katharinaberg ist zugleich der Weg zurück in ihre eigene lückenhafte Vergangenheit. Bis zum Ende des Romans wird nicht jede offene Stelle inhaltlich gefüllt. Gehen wir mal getrost davon aus, dass Elisabeth Florin mit ihrem Stammpersonal noch allerhand im Sinn und weitere Bände in der Pipeline hat, die manches Rätsel lösen könnten, das sich schon jetzt stellt. Übrigens entdeckt auch Liselotte die Schriftstellerei und macht sich an die Gestaltung der Geschichte einer Familie, über die sie aus den Kriminalakten und ihren eigenen Ermittlungen bereits Interessantes herausgefunden hat.
Fern jeglicher Idylle bleibt hier kein menschlicher Abgrund unbedacht. Familiäre Gewalt und Unterdrückung, Vergewaltigung, Tierquälerei, Rache, Hass und Selbstmord sind nur einige der Themen, die in diesem komplexen Roman mit seinen vielen Nebensträngen verarbeitet werden, und manche menschenverachtende Szene kann einem schier den Atem rauben.
Überdies ist der unterhaltsame Krimi effektvoll strukturiert. Den Anfang macht eine knallige bizarr-makabre Szene, die einen hellwach lässt, sollte man es sich zum Schmökern im Bett gemütlich gemacht haben. Im weiteren Verlauf zurrt die Autorin ihren Leser mit geschickt angelegten Cliffhängern fest an ihren Text.
Ihr eigenes kleines Späßchen hat Elisabeth Florin offenbar bei der Namensgebung ihrer Figuren. Neben der (etwas albernen) Benennung des Protagonisten nach einem längst verstorbenen fülligen Star-Tenor gibt es auch noch eine Anspielung auf Alberto Tomba, das Südtiroler Ski-Ass der Achtziger- und Neunzigerjahre. Alberto Zomba ist allerdings ein weitaus unangenehmerer, hinterhältigerer Patron als der x-fache Medaillengewinner »Tomba la bomba«.
Das Nachwort zieht endlich eine säuberliche Trennlinie zwischen Realität und Fiktion. Eine ganze Reihe historischer Ereignisse spielen in der Handlung eine Rolle – die Bauarbeiten am Vernagt-Staudamm nach dem Krieg, bei denen zahlreiche Arbeiter verunglückten, die Flutung des Tales im Jahr 1957, als uralte Höfe und das Leiterkirchlein in den Wassermassen versanken, schließlich die Errichtung des neuen Leiterkirchleins 1997.
Vor allem aber sorgt sich die Autorin nicht zu Unrecht um die Ehrenrettung des in ihrem Roman ziemlich verunglimpften Örtchens im Schnalstal. In der Tat kann es so viele Abgründe auf kleinstem Raum nur in der Fiktion geben. Wie viel schöner ist doch die Realität! Das echte Katharinaberg, weiß das versöhnliche Nachwort, sei vom Massentourismus noch verschont, die Leute dort seien ausgesprochen gastfreundlich und hilfreich. Die Prospektwelt ist wieder in Ordnung!
 · Herkunft:
· Herkunft: