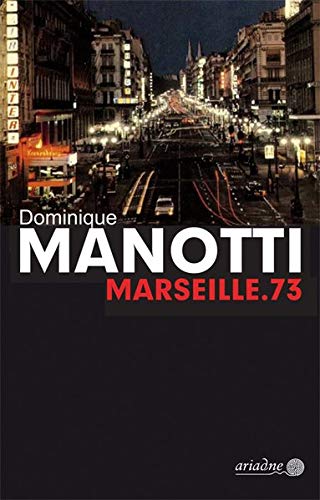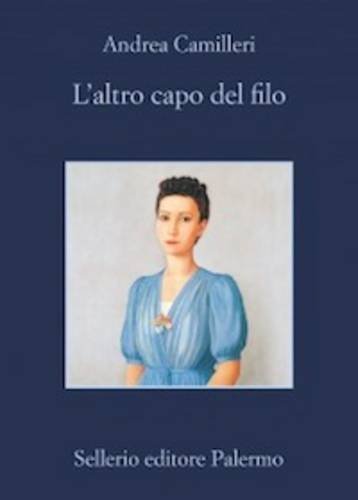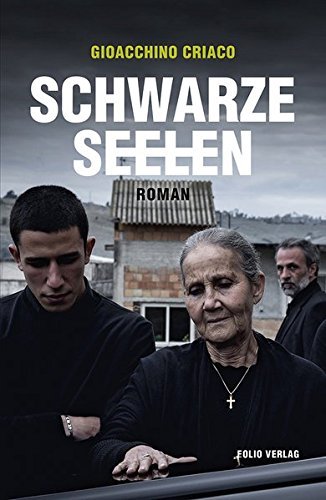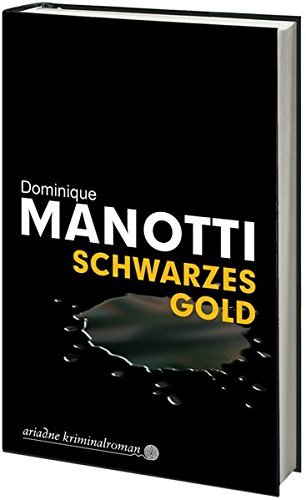
Mammutunternehmen
Kleine Brötchen mag Dominique Manotti nicht backen. Die gelernte Wirtschaftshistorikerin hat immer das große Ganze im Blick. In »Schwarzes Gold« rollt sie auf, wie in den Siebzigerjahren das globale Erdölgeschäft umgekrempelt wird. Bis dahin kontrollierten sieben Handelskonzerne – das »Kartell der Sieben Schwestern« – den Weltmarkt durch Preisabsprachen und Monopole. In den Sechzigern hatten sich jedoch etliche Erdöl produzierende Staaten zur OPEC zusammengeschlossen, um über die Vereinbarung von Fördermengen und die Besteuerung der Konzerne mehr Geld für ihre Länder abzuzweigen. Im Frühjahr 1973 liegt der Preis pro Barrel bei etwa drei Dollar, aber jeder kann sich ausrechnen, dass es dabei nicht bleiben wird. Schon 1980 würde er sich verzehnfacht haben.
Wo Milliarden abzuschöpfen sind, nehmen Gier und Egoismen zu, und die Bereitschaft, sich an Spielregeln zu halten, nimmt ab. So schert der Iran aus der OPEC-Strategie aus, um sein Öl auf eigene Rechnung anzubieten. Verhandlungen und Lieferungen müssen freilich geheim bleiben. Für so ein Unternehmen braucht man Spezialisten, und damit kommen noch ganz andere Kreise ins Spiel.
Etwa die bestens vernetzten Leute, die zwei Jahrzehnte lang unter tatkräftiger Beteiligung der Mafia Heroin aus dem Nahen Osten über Sizilien und Marseille in die USA vertrieben hatten. Diese »French Connection« wurde soeben zerschlagen, so dass die routinierten, derzeit unterbeschäftigten Drogenhändler für neue Aufgaben angesprochen werden könnten.
Oder der ehrgeizige New Yorker Rohstoffhändler Michael Frickx, der sich gerade selbstständig gemacht hat, um ebenfalls das Monopol der »Seven Sisters« anzugreifen. Beste Beziehungen rund um den Globus (darunter der Schah) sollen ihm bei der Umsetzung seiner Visionen helfen. Skrupel oder Hindernisse kennt er nicht. Im Notfall kann er sich auf diskrete Profikiller verlassen.
Ein Brennpunkt dieser Entwicklungen ist Marseille, ein Moloch im Umbruch, wo Schiffsbau und Schwerindustrie im Abwind sind, Arbeitslosigkeit und Armut um sich greifen, Immigranten aus den Ex-Kolonien zuströmen, jungen Männern nur Kleinkriminalität und Dealen als Verdienstquellen bleiben, während das große Geschäft durch blutige Bandenkriege aufgeteilt wird. Die Ordnungsmächte stehen dem radikalen Wandel und den sozialen Problemen hilflos gegenüber – wer korrupt genug ist, mischt selbst mit.
Hier beginnt Dominique Manottis Wirtschaftskrimi im März 1973, mittendrin in der hochkomplizierten Gemengelage mit zahlreichen Spielern, die als Einzelkämpfer oder im Interesse höherer Mächte agieren. Unsere Schlüsselfigur ist Commissaire Théodore Daquin, 27, der nach glänzendem Abschluss der Polizeihochschule in Paris jetzt seine erste Stelle antritt. Principal Courbet, der Chef des chronisch unterbesetzten Kommissariats, nimmt ihn herzlich auf und für den ersten Fall unter seine Fittiche. Im Problemviertel Belle de Mai hat es eine Schießerei mit zwei Toten gegeben. Schon am Tatort konstatiert Courbet, dass man die Sache getrost abhaken könne: »Abrechnung innerhalb des Milieus«, »italienische Auftragsmörder, die längst wieder zu Hause sind«. Später erläutert Inspector Grimbert, langjährig vertraut mit den Verhältnissen und ziemlich desillusioniert, dem neuen Kollegen die Hintergründe. Wo die Polizei Banditen festnimmt (oft nach Verrat durch Rivalen), hinterlässt sie ein Vakuum, um das sich die korsischen Mafia-Clans prügeln. So war dies bereits die fünfte »Abrechnung« in einem halben Jahr. Acht Tote, keine Spuren, keine Zeugen, keine Aufklärung. Doch wen schert es schon, »wenn die Banditen sich gegenseitig umbringen«?
Commissaire Daquin schert es, spätestens als Tags darauf ein Motorradfahrer vor dem Spielcasino in Nizza den prominenten Seefrachtunternehmer und ehemaligen Résistancekämpfer Maxime Pieri aus Marseille exekutiert. Zehn Kugeln haben ihn durchsiebt, ohne dass seiner jungen Begleiterin Emily, Gemahlin seines Geschäftspartners Michael Frickx, auch nur ein Haar gekrümmt worden wäre. Die Vorzeigeaktion verweist auf die fünf Jahre zurückliegende Hinrichtung von Antoine Guérini, angesehener Pate eines korsischen Clans, in dem Pieri vor seiner Reedertätigkeit kräftig mitgemischt hatte. Bestrafung, Revanche oder Warnung an den Guérini-Clan im Kampf um die Kontrolle der Casinos an der Côte d'Azur?
Daquin übernimmt nun zusätzlich die Ermittlung in Nizza, will sich aber durchaus nicht auf die auch dort favorisierte Theorie »Abrechnung im Milieu« eingrenzen lassen. Widerwillig räumt man dem Grünschnabel fünfzehn Tage für seine Ermittlungen ein, ehe man die Akte schließen wird. Schnell stellt er fest, dass Pieris Schiffe keineswegs nur harmlose Massengüter übers Mittelmeer schippern und dass ihr Boss drauf und dran war, mit geblähten Segeln in ganz neue, brenzlige Geschäftsbereiche vorzudringen. Was haben Emily und Michael Frickx damit zu tun? Glück scheint der Reederei jedoch nicht beschieden, denn bald stirbt Pieris Partner, dann einer ihrer Kapitäne eines gewaltsamen Todes.
Sollte Ihnen der Kopf schwirren, geht es Ihnen nicht anders als dem gründlichen Ermittler Daquin. Wie könnte er sich auch als ›kleiner Polizeibeamter‹ Durchblick verschaffen in dem gewaltigen dreidimensionalen Netz, das die Autorin geflochten hat – übrigens nicht aus reiner Fantasie, sondern eng an historische Realitäten angelehnt? Immer wieder neue Mitspieler, neue Namen, neue Gewebe aus Amtsträgern, Behörden, Geschäften, Organisationen und Unterweltbanden, fliegende Ortswechsel bis nach Istanbul, die Historie der korsischen Mafia bis zurück zum Zweiten Weltkrieg, dazu Politik und Geheimdienstaktivitäten im Nahen Osten, in Südafrika und in Nixons USA, die »sieben Schwestern« und die OPEC, Börsen, Trader, Drogen- und Waffenhandel, Korruption und Schwarzgeld, um schmutzige Kriege und Terroristen zu finanzieren, und der zeitgenössische Kunstmarkt als Geldwaschmaschine. Nach zwei Dritteln seiner Frist (und 264 der 384 Seiten) muss der arme Daquin feststellen: »Alle diese Elemente türmen sich nach wie vor ungeordnet auf meinem Schreibtisch, ohne dass ich dahinterkomme, wie sie zusammenpassen.«
»Or Noir«  (2015 erschienen und von Iris Konopik übersetzt) ist ein ungeheuer vielschichtiger Roman, dessen Autorin nicht weniger versucht, als die globalen Allianzen aus Politik, Wirtschaft und Verbrechen, die wir heute allzu oft zu beklagen haben (soweit sie denn überhaupt sichtbar werden), auf Ursprünge in den Siebzigerjahren zurückzuführen. Sie verpackt ihre Erkenntnisse in einem Mordfall, um sie dem Leser auf unterhaltsame Weise präsentieren zu können. Nach meinem Empfinden ist es allerdings quasi unmöglich, die beiden Absichten zwischen zwei Buchdeckeln zusammenzuführen.
(2015 erschienen und von Iris Konopik übersetzt) ist ein ungeheuer vielschichtiger Roman, dessen Autorin nicht weniger versucht, als die globalen Allianzen aus Politik, Wirtschaft und Verbrechen, die wir heute allzu oft zu beklagen haben (soweit sie denn überhaupt sichtbar werden), auf Ursprünge in den Siebzigerjahren zurückzuführen. Sie verpackt ihre Erkenntnisse in einem Mordfall, um sie dem Leser auf unterhaltsame Weise präsentieren zu können. Nach meinem Empfinden ist es allerdings quasi unmöglich, die beiden Absichten zwischen zwei Buchdeckeln zusammenzuführen.
Das liegt erstens an der Komplexität des Überbau-Stoffes. Je tiefer Manotti die Hintergründe der Morde ausbreitet, desto unübersichtlicher wird nun einmal die Gesamtstruktur, desto abstrakter werden die Zusammenhänge.
Zweitens kultiviert die Autorin einen betont reduzierten Schreibstil, der für Emotionen und Mitfiebern kaum Mittel bereitstellt. Sie formuliert sachlich-kühl und präzise, knapp und schmucklos, verzichtet weitgehend auf Adjektive und Beschreibungen. Durchgehendes Präsens, schlichte Hauptsätze und knappe Nebensätze können Tempo und lebhafte Eindrücke wie eine Vor-Ort-Reportage erzeugen. Das alles passt sehr gut zur Aufklärungsabsicht, aber für die Unterhaltung über so viele Seiten wünscht man sich mehr Dynamik und Varianz.
Drittens ist die Identifikationsfigur des Théo Daquin kein nachhaltiger Charakter, der zu Herzen ginge. Neben der robusten Konsequenz, mit der er seine schier endlosen Recherchen durchzieht, ohne sich jemals entmutigen zu lassen, bleibt seine Homosexualität als hervorstechendes Merkmal. In einer Macho-Metropole wie Marseille hat er's damit schwer – allein das Gerücht, er sei »eine Schwuchtel«, ruiniert den Ruf »eines Bullen« hier gründlicher als der Vorwurf, er sei korrupt oder unfähig. Also lebt Daquin seine Neigung im Geheimen, aber keineswegs ungeniert aus. Ansonsten ist er eine plausible, aber farblose Figur – nicht profilierter eben, als es für ihre Vermittlungsfunktion erforderlich ist.
Was Dominique Manotti über wirtschaftshistorische Zusammenhänge recherchiert, präsentiert und fiktional erweitert hat, ist also etwas anstrengend, aber dennoch lesenswert. Sie formuliert Aussagen, die sich in unseren Tagen bestätigen: »In der Unternehmenswelt gibt es nur ein einziges unumstößliches Gesetz: Geld zu verdienen. Die durch die Gesetzgebung gezogenen Grenzen sind sehr viel vager. Sie variieren je nach Land, je nachdem, welche Mehrheit an der Macht ist. Das Risiko, das man bei ihrer Übertretung eingeht, wird kalkuliert wie jedes andere Geschäftsrisiko, nicht mehr und nicht weniger. Und die Entscheidung, sie zu übertreten oder nicht, hängt von dieser Kalkulation ab, nicht von moralischen Prinzipien. Dabei kann man sich vertun, aber das ist dann ein Rechenfehler, keine moralische Verfehlung.« VW, die Deutsche Bank und ein paar andere lassen grüßen.
 · Herkunft:
· Herkunft: