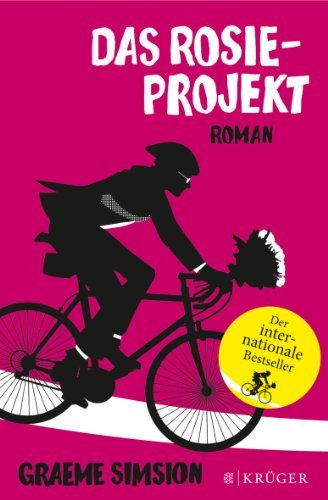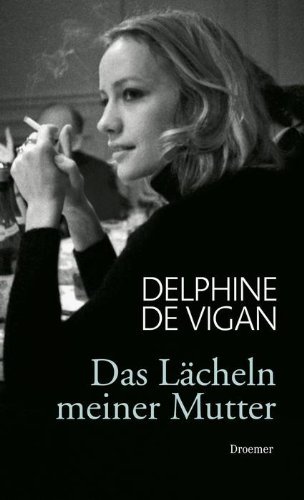
Das Unaussprechbare aufschreiben
Der Familie Poirier bleibt nichts erspart. Drei ihrer neun Kinder sterben, und die Überlebenden haben es schwer. Für Mutter Liane ist jede Schwangerschaft Erfüllung und Geschenk Gottes, zehrt aber auch an ihrer Substanz. Die Älteste, Lisbeth, 1944 geboren und jetzt fast zehn, hilft im Haushalt und passt auf die Kleinen auf. Vater Georges wechselt oft die Arbeit; sein Verdienst reicht kaum hin.
Die Drittgeborene ist Lucile, ein geheimnisvolles Kind mit besonderer Ausstrahlung. Die Achtjährige ist Vaters Augapfel, doch Liane findet keinen rechten Zugang zu ihr. Sie fühlt sich von ihr beobachtet, »in dieser Art, als wüsste sie alles, ohne etwas gelernt zu haben«, als ob sie »ein Parallelleben zu dem der anderen« führe. Gern würde sie das Mädchen besser lieben, »die Festung ihres Schweigens brechen«, aber die Kluft zwischen ihnen bleibt unüberbrückbar.
Nachdem Lucile als Kindermodel entdeckt wird, kommt Geld ins Haus. Endlich leidet die Familie keine Not mehr. Es bleibt sogar genug für rauschende Familienfeste und herrliche Sommerurlaube, zu denen die Kinder ihre Freunde mitnehmen dürfen.
1954 schlägt das Schicksal erstmals zu. Kinder, Vettern und Freunde toben im Garten, als schrille »Schreie des Entsetzens« gellen. Der sechsjährige Antonin und sein Vetter Tommy sind in die Tiefe eines mit Brettern abgedeckten Brunnens gefallen. Während Tommy an der Wasseroberfläche auftaucht, wird Antonin tot geborgen. Dem schmerzlichen Ereignis werden über die Jahre weitere folgen: »Von da an würde Antonins Tod nur noch eine unterirdische, seismische Welle sein, die lautlos immer weiterwirken würde.« Antonins Name darf nicht mehr erwähnt werden.
Kann man einen Menschen durch einen anderen ersetzen? Kurze Zeit später bringt der Vater einen fremden Jungen mit nach Hause. Der magere, mit Narben übersäte und verängstigte Jean-Marc hat offensichtlich nie Fürsorge erlebt. Er soll in Antonins Bett schlafen, seine Kleidung tragen und von nun an »ihr Bruder sein«. Die Kinder spüren, »dass wir austauschbar waren«. Einige Geschwister lehnen den Siebenjährigen ab, andere möchten ihn behutsam leitend an die Hand nehmen. Lucile erkennt Gemeinsamkeiten mit ihm: So wie er, der noch in der Geborgenheit seiner neuen Familie immer wieder unbewusst die Arme schützend über den Kopf hält, wird auch Lucile von Ängsten geplagt, die keiner nachvollziehen kann.
1962 wird Nesthäkchen Tom geboren. Wegen seines Down-Syndroms stecken Mutter und Vater fortan all ihre Kraft und Aufmerksamkeit in die Förderung ihres jüngsten Kindes.
Ein Jahr später dreht sich die »Katastrophenspirale« weiter: Jean-Marc wird in seinem Zimmer tot aufgefunden, nachdem er sich eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hatte.
Bald verlassen die Großen das elterliche Haus, um zu studieren, zu arbeiten, Familien zu gründen. Glücklich werden sie nicht. Lucile heiratet, erst achtzehn, aber sie ist ihrem Mann untreu, die Ehe zerfällt schnell; sie erhält das Sorgerecht für die Töchter Delphine (die Autorin) und Manon. Die alleinerziehende Mutter flüchtet sich in wechselnde Liebesbeziehungen. Niels, einer ihrer Geliebten, tötet sich 1970. 1978 erschießt sich ihr Bruder Milo mit 28 Jahren. Später folgt ihm ihr Vetter Baptiste in den Tod.
Am 25. Januar 2008 findet Delphine, inzwischen eine anerkannte Schriftstellerin, ihre Mutter tot in ihrer kleinen Pariser Wohnung auf. Die Tochter ist unansprechbar, unfähig zu schreien, unfähig zu verstehen. Als die Schockstarre sich langsam löst, beginnt sie mit ihrem Projekt, dem autobiografischen Roman »Rien ne s'oppose à la nuit«  (den Doris Heinemann nun übersetzt hat).
(den Doris Heinemann nun übersetzt hat).
Es wird ein komplexer, schmerzhafter Prozess. Was eine »Hommage«, »ein Sarg aus Papier« für ihre Mutter werden soll, entwickelt sich zu einer Suche »nach dem Ursprung des Leids«. Was hat den »Kern ihrer Persönlichkeit auf endgültige und nicht wiedergutzumachende Weise verletzt«? Delphines Mann spürt, welche Anspannung auf seiner Frau lastet, und fragt, ob sie denn wirklich über »das« schreiben müsse. Doch da gibt es für sie schon nichts anderes mehr, als das Unaussprechliche zu Papier zu bringen – als Selbsttherapie, um angesichts ihres eigenen Schmerzes nicht in Sprachlosigkeit und Selbstzerfleischung unterzugehen. Sie wird auch vieles über sich selber erfahren und prüfen.
Sie befragt ihre Schwester Manon, andere Verwandte, Freunde. Die Stimme der Mutter fehlt; sie hatte nie zusammenhängend aus ihrer Kindheit erzählt. Delphine kann sich an »fragmentarische Bemerkungen« erinnern, die hier und da gefallen waren; es schien, »als werfe (Lucile) mit Steinen, um uns mit voller Wucht zu treffen oder um sich vom Schlimmsten zu befreien«.
Delphine liest Tagebuchaufzeichnungen und Briefe, Polizeiprotokolle und psychiatrische Berichte, sie hört Kassetten, die ihr Großvater Georges besprochen hat. Sie stößt an Grenzen: »Habe ich das Recht zu schreiben, dass Georges ein schädlicher, zerstörerischer und demütigender Vater war, dass er seine Kinder in den Himmel gehoben, ermutigt, ... vergöttert und zugleich vernichtet hat? ... dass er zu bestimmten Töchtern zumindest zweideutige Beziehungen hatte?«
Von Seite zu Seite nähert sich die Tochter dem Wesen ihrer Mutter, die den Freitod als einzig gangbaren Weg sah. In der Rückschau beobachtet sie sie – mit immer neuen Liebhabern, wie sie sich in ihrem Schlafzimmer einigelt, raucht, Drogen nimmt, am Leben nicht teilnehmen kann, Geld, das sie selber dringend benötigen, an wildfremde Menschen verteilt, wie der Haushalt verkommt, wie sie mit ihren Töchtern immer wieder umzieht. Wie sie im Wahn Manon mit Akupunkturnadeln bedroht, nackt mit weißbemaltem Körper am Fenster sichtbar, so dass man die Polizei holt und sie in die Psychiatrie eingewiesen wird. Sie unterzieht sich einer Therapie – nicht um ihrer selbst, sondern nur um »unseretwegen« –, doch prallt alles an ihrer inneren Leere ab. Zwanzig Jahre kämpft sie mit ihrer bipolaren Störung. Medikamente, Therapien, Aufenthalte in Krankenhäusern, am Ende Lungenkrebs zermürben sie. In ihrem Abschiedsbrief bittet sie ihre Kinder, ihren Beschluss zu verstehen: »Ich möchte lieber lebendig sterben.«
 · Herkunft:
· Herkunft: