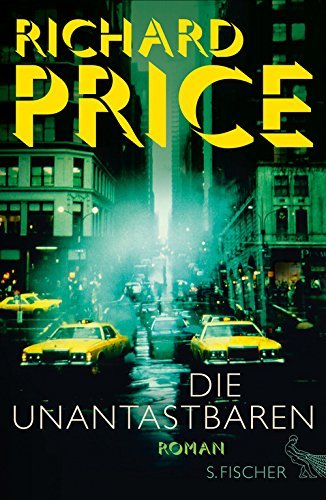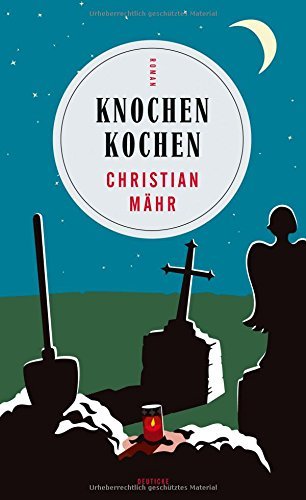
Gute Hausmannskost
»Sudor anglicus«, der Englische Schweiß, ist eine höchst ansteckende Infektionskrankheit mit meist tödlichem Verlauf. Mit den grippeähnlichen Symptomen – plötzliches Fieber, Schüttelfrost, Schwindel, Herzrasen, Kopf- und Gliederschmerzen – gehen schwere Angstgefühle einher. Nachdem die rätselhafte Seuche im 15. Jahrhundert erstmals in England auftrat, raffte sie Tausende Menschen dahin, sprang dann über den Kanal aufs Festland und verbreitete sich über Frankreich und Deutschland bis in die Schweiz und nach Österreich. Eine Arme-Leute-Krankheit war es nicht: Die Tudor-Royals wurden genauso geschlagen wie das österreichische Adelsgeschlecht derer von Seitenstetten-Markhartsburg.
Obwohl heute kaum einer mehr von der einstigen Volksplage weiß, sorgt sie noch über vier Jahrhunderte später für Aufregung. Sie betritt gewissermaßen in Gestalt des Erasmus von Seitenstetten das Gasthaus »Blaue Traube« in Dornbirn, und aus ist es mit der Vorarlberger Beschaulichkeit dortselbst. »Grüß dich, Lumpi« – drei Wörter des Barons bei seinem Eintreten genügen, und schon hat Matthäus Spielberger, der Wirt, die Faxen dicke. Der Spitzname »Lumpi« hängt ihm seit Unterstufenzeiten an wie eine Bazille, und jetzt entspringt er ausgerechnet dem Munde seines ehemaligen Mitschülers Erasmus. Dieser »Trottel« hat damals regelmäßig die Hausaufgaben bei ihm abgeschrieben. Wenn er jetzt extra aus Wien angereist kommt, überraschend und überfallartig, muss es ihm schon sehr pressieren mit einem Problem, für dessen Lösung mal wieder Matthäus herhalten muss.
Zur Einführung erteilt Erasmus dem Matthäus – in Geschichte eher desinteressiert – etwas Nachhilfe. In der Schlacht von Bosworth (1485) besiegte Henry Tudor (später König Henry VII.) Richard III. Im Feldlager erkrankten immer mehr Soldaten an der bislang unbekannten Schwitzkrankheit und verstarben, darunter auch der Seitenstetten-Vorfahr Ferdinand-Erasmus. Im Nachlass eines kürzlich heimgegangenen Onkels fand Erasmus einen Hinweis auf die Todesursache seines homonymen Ahnen.
Nun muss man wissen, dass der Erasmus im Gegensatz zum Matthäus – »schad, dass aus (ihm) nix Besseres geworden ist« – eine beachtliche Karriere hingelegt hat. Er ist Professor der Medizingeschichte an der Universität Wien. Obwohl die Liste seiner Veröffentlichungen in Fachjournalen einen halben Meter lang ist, muss er sich etwas einfallen lassen, um die akademische Karriere ein wenig anzukurbeln. Die Finanzlage der Uni ist »am Oarsch«, Stellung und Titel kann er sich »in die Hoar schmiern« – Eigeninitiative ist gefragt. In dieser Not recken sich dem Forscher die vermoderten Knochen jenes Ferdinand-Erasmus entgegen, damit er ihr Geheimnis mittels moderner DNA-Analyse entschlüssle. Das wäre ein Knüller, denn der »Sudor anglicus« ist nach wie vor ein großes Rätsel.
Mit seinen universitären Mitarbeitern mag Erasmus das Projekt freilich nicht angehen. Sein Assistent Laska, »der Pestfetzen, der zwidere«, würde ihm die Ergebnisse zum eigenen Nutzen klauen, die anderen (hauptsächlich weiblich) sind »ungeeignet fürs Praktische. Die wissen alle net, wo bei aner Schaufel vorn und hintn is«. Das allerdings ist eine Grundqualifikation, denn schließlich müssen die ollen Knochen zunächst einmal aus der Familiengruft des Adelsgeschlechts im Wienerwald ausgebuddelt werden. Matthäus und ein paar andere Dörfler können sowas ...
Matthäus rekrutiert seine besten Freunde (und Stammkunden), die drei Unruheständler Lothar Moosmann (Holzschnitzer), Franz Josef Blum (Buchhalter) und Dr. Lukas Peratoner (Chemielehrer) als wissenschaftliche Hilfskräfte und schwört sie auf äußerste Geheimhaltung ein. Hundert Euro pro Tag sollen für jeden herausspringen. Gleich am nächsten Tag besteigen die vier Verbündeten der »Spielberger-Bande« den Frühzug nach Wien, wo der Herr Professor mit seiner liebenswürdigen Amalie, so betucht wie exaltiert, in einer heruntergekommenen Gründerzeitvilla residiert. Allerdings pflegt die feine Baronin schon seit zwei Jahren ein intimes außereheliches Verhältnis. Die Pläne, die ihr der Gemahl vertrauensvoll ans Herz legt, macht sich die Untreue ganz ungeniert zunutze und spielt lieber ihr eigenes Spiel.
Mit Spitzhacke, Hammer, Meißel und Teleskopleiter geht es im Pickup in den Wienerwald. Bei heftigem Landregen steigt die konspirative Fünferbande mitten in der Nacht in die Gruft hinab. Leider müssen sie erfahren, dass sie nicht allein auf der Pirsch sind. Die Konkurrenz – zwei maskierte und bewaffnete Männer – schnappen ihnen weg, was vom altehrwürdigen Ferdinand-Erasmus noch aufzusammeln war.
Damit nimmt eine turbulente, chaotische Tour des Grabes, Grabens und Jagens ihren Lauf, ein knochenharter Ritt mit vielen Figuren, Schauplätzen und Nebenhandlungen, ein einziges Kuddelmuddel, abenteuerlich und kaum aufzudröseln. Die Fantasie des Autors kennt keine Grenzen, und er errichtet die kühnsten Handlungskonstrukte, damit bloß kein Einfall in den Papierkorb wandern muss. Beispielsweise sitzt der konvertierte Dschihadist Achmed (ehemals Alois Praxner) gerade in einer madrilenischen Bar, als er die Geschichte vom Leichenraub daheim in Österreich erfährt. Er erkennt sogleich die »Zeichen« und entwirft eine Aktion, die amerikanischen Thinktanks entsprungen sein könnte: die Tod bringenden Knocherln zu Pulver zermahlen und mit dem »Schutz des Allerhöchsten« unter den Ungläubigen verstreuen ...
Trotz drohendem Dschihad, einem Untergangsszenario im Dornbirner Messepark und furiosem Schluss mit tödlichem Schusswechsel kommt in Christian Mährs »Knochen kochen« keine wirklich prickelnde Spannung auf. Das muss auch nicht sein – schließlich ist es ein Heimatkrimi. Ohne platt zu werden, bewahrt er einen liebenswürdigen, bodenständigen Charakter vor allem in den harmlos skurrilen Figuren der Dornbirner Buben. Der Franz-Josef ist ein romantischer Schisser. Wenn Angstgefühle sich seiner bemächtigen, schmettert er zur eigenen Beruhigung Opernarien. Der Matthias wird von einer Art »Präkognition« heimgesucht. Träume, perfekt wie Videos, »in Farbe und 3-D«, zeigen ihm Ereignisse der nahen Zukunft, und die Wirklichkeit wird zum Déjà-vu.
Auch in der Nacht, bevor der Spezi Seitenstetten bei ihm aufgetaucht war, hatte Matthäus wieder mal geträumt. Deutlich vernahm er die markanten Stimmen seiner Freunde, die mit Spaten und Hacken durch einen Wald marschierten, offenbar um etwas auszugraben. »Aber was? Und warum?« Mähr erzählt es uns und lässt dabei seine Helden munter im heimatlichen Dialekt palavern. Bis auf wenige Ausnahmen versteht das auch jeder »Piefke«, und zur Not – »Schpompanadeln«? – hilft ein Spezialwörterbuch.
Wie bei diesem Genre zu erwarten und erwünscht, tropfen altbekannte Klischees aus den Seiten. Den österreichischen Lesern wird die seit Generationen kultivierte Vorarlberger Hassliebe für Wien vertraut sein. Die snobistischen Provinzler sind entweder »Wien-Fans« oder »Wien-Hasser« – »dazwischen gab es nichts«. Die »Piefkes« dürfen sich dafür über Seitenstettens »urwienerische, baroneske Aura aus Verschrobenheit, Jovialität und leichter Trottelei« amüsieren und an ›exotischen‹ Schauplätzen wie Frastafeders und seiner seit vierhundert Jahren verschwundenen Burg erfreuen, sofern sie sich nicht lieber im Dornbirner Messepark, Vorarlbergs Shopping-Center Nr. 1, zwischen all den roten »Sale«-Schildern bei der Schnäppchenjagd tummeln.
»Knochen kochen« ist gut gemachte Unterhaltung aus der Region, eine Art literarischer Schweinsbraten mit Knödel und Kraut.
 · Herkunft:
· Herkunft: