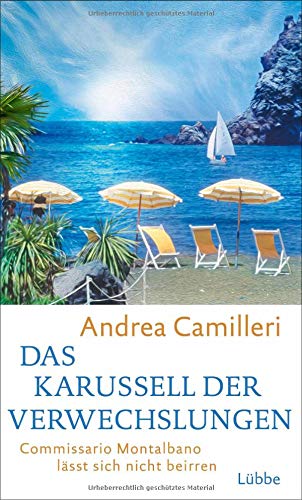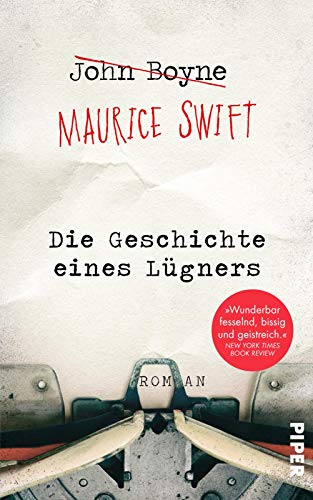Das Gewicht von Schnee
von Christian Guay-Poliquin
Zwei Fremde verschlägt es binnen einiger Monate in ein abgelegenes, isoliertes Dorf, wo nach einer Katastrophe und wegen permanenten Schneefalls große Not herrscht. Sie müssen sich mit den Bewohnern arrangieren, aber auch miteinander auszukommen lernen.
Gestrandet und ausgeliefert
Im Sommer muss sich irgendeine nicht näher erläuterte Katastrophe ereignet haben. Nach und nach fiel im Land der Strom aus, Benzin und Lebensmittel wurden knapp. In den Städten brach die Zivilisation zusammen, Chaos griff um sich. In dem abgelegenen Dorf, wo sich die erzählte Handlung zuträgt, setzt nun Schneefall ein und lässt nicht mehr nach. Auch hierher kommt nichts mehr, was man zum Leben braucht. Manche Bewohner haben den Ort verlassen, die Verbliebenen suchen in den leerstehenden Häusern nach Verwertbarem, verbrennen, um nicht zu erfrieren, was sie entbehren können, und die knappen Nahrungsvorräte werden gehortet und zugeteilt.
Im Frühsommer ist ein alter Mann namens Matthias angereist. Wegen eines Schadens an seinem Auto saß er nun fest, denn ohne Strom konnte ihm niemand helfen. Es werde aber nicht lange dauern, sagte er, dann werde seine Nachbarin kommen und ihn abholen. So lange durfte er ein leeres Haus oben am Waldrand beziehen. Doch die Dame kam niemals an.
Als schon der Schnee fällt, ereignet sich ein folgenreiches Autounglück. Nach dem Unfall zieht man den Fahrer mit zerquetschten Beinen unter dem Wrack hervor. Niemand gibt ihm eine Überlebenschance, und der Apotheker rät angesichts seiner Qualen, dem Schicksal seinen Lauf zu lassen und »die Sache zu beenden«. Doch die Tierärztin und der »Patrouillenmann« (eine Art Wachmann oder Polizist?) sind hoffnungsvoller, dass der Verunglückte gerettet werden könne. Überdies war sein Vater der geschätzte Automechaniker des Dorfes. Der junge Mann war auf dem Weg, ihn nach mehr als zehn Jahren einmal wieder zu besuchen, hatte aber nicht erfahren, dass der Vater zwischenzeitlich verstorben ist.
Hätte man angesichts der eigenen Notlage für einen Wildfremden, und sei es ein Leidender, keinen Gedanken verschwendet, geschweige denn ihn aufgenommen, wird dieser Schwerverletzte nun ins Dorf gebracht, wo er freilich nicht der Allgemeinheit zur Last fallen soll. Jetzt wäre vielmehr die Gelegenheit, dass der alte Matthias sich bei der Dorfgemeinschaft revanchiert. Sie hat ihm schließlich auch Unterkunft gewährt, teilt ihm Lebensmittel zu, und er ist vital und rüstig genug, um ihr die Aufgabe abzunehmen, sich um den Verletzten zu kümmern. Bewährt er sich, kann man ihm in Aussicht stellen, bei einer ins Auge gefassten Expedition mitfahren zu dürfen. Man will dann erforschen, wie die Lage im Lande ist, und Matthias könnte nach seiner kranken Ehefrau suchen.
Damit beginnt ein schmerzvoller Prozess des Auskommens zwischen den beiden Außenseitern, dem namenlosen Ich-Erzähler und dem Alten, die der Zufall in der Fremde aneinander gefesselt und in einer Schneewüste eingesperrt hat. Die äußere Handlung ist karg, der Informationsfluss, den uns der Autor zukommen lässt, spärlich und diffus wie die Nachrichten aus der Welt, die die beiden Männer, die Dörfler und uns Leser erreichen, und wie die Konturen der Welt, die sich im Weiß des immerwährenden Schneetreibens verlieren. . Erstaunlicherweise ist dieser Roman, dessen Kapitel gemäß der täglich gemessenen Schneehöhe in Zentimetern voranschreiten (»achtunddreißig« bis »zweihundertdreiundsiebzig«), dennoch so spannend zu lesen wie ein Krimi.
Wir folgen dem Tagesablauf der beiden unterschiedlichen Männer, dessen Monotonie nur gelegentlich unterbrochen wird, wenn jemand mühselig auf Schneeschuhen aus dem Dorf heraufgestapft kommt. Mit dem Wenigen, das er im Rucksack mitbringt, müssen die beiden für lange Zeit auskommen. Matthias, von seinem Erscheinungsbild her »ein verrückter Wissenschaftler«, ist der »Herr über Zeit und Raum«. Am frühen Morgen beginnt er mit einem Gymnastikprogramm, heizt den Ofen, verlängert den öligen Kaffee, backt aus Buchweizen und Melasse haltbares Schwarzbrot, kocht aus den knappen Vorräten die immergleiche »Endlossuppe«, spricht das Tischgebet, wäscht, näht die Kleidung. Mit dem Einzug des jungen Mitbewohners, dessen Beine mit Holzstecken geschient sind, kommt die Versorgung seiner Wunden hinzu.
Faszinierender ist, wie sich das Verhältnis zwischen den beiden entwickelt. Lange Zeit spricht der traumatisierte neu Einquartierte kein Wort, siecht in seinen Schmerzen dahin, starrt von seiner Lagerstatt, zu Passivität und Abwarten verurteilt, mit einem Fernrohr auf die Messlatte vor dem Fenster. Wie sie den Naturgewalten ausgeliefert sind, so sind sie auch auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen, »zwei Häftlinge derselben Strafkolonie«, und »jeder von uns ist der Gefangene des anderen«. Der nutzlose und pflegebedürftige Gast kommt Matthias, der ganz andere Pläne hat, äußerst ungelegen. Beide haben ihre Geheimnisse, ihre Gefühle schwanken zwischen Anteilnahme und Argwohn, Hass und Zuneigung, Überdruss und Freundlichkeit. Doch sie haben ein gemeinsames Ziel: überleben. So sind sie gezwungen, miteinander zu kooperieren, gehen sie achtsam, gelegentlich fast liebevoll miteinander um, beäugen sich aber auch immer wieder mit Misstrauen und halten ihr unfreiwilliges Zusammensein manchmal kaum aus.
Der franko-kanadische Autor Christian Guay-Poliquin, 1982 in Saint-Armand (Québec) geboren, hat mit »Le poids de la neige« (übersetzt von Sonja Finck und Andreas Jandl) ein atmosphärisch dichtes Werk erschaffen, das seit seinem Erscheinen 2016 mit etlichen Literaturpreisen ausgezeichnet wurde. In einem zeitlosen, apokalyptischen Setting trägt sich ein höchst spannungsgeladenes Kammerspiel zu, das wie ein psychologisch-philosophisches Experiment wirkt. Den Menschen werden plötzlich ihre Lebensbasis und alle Gewissheiten entzogen, sie werden von Ressourcenverknappung, Krankheit und Tod bedroht. Wie reagieren sie in dieser konstruierten Situation auf Erfahrungen von Klaustrophobie, des Nicht-Entkommenkönnens, des Aufeinanderangewiesenseins, der Ungewissheit und Hoffnungslosigkeit?
Die sprachlich karg anmutende Gestaltung passt vorzüglich zum Konzept. Kurze, prägnante Aussagesätze versinnbildlichen die Stimmung des Unabwendbaren (»Alle müssen sich mit der Lage abfinden.«). Dialoge sind ohne Satzzeichen in die Erzählung integriert. Dann wieder überraschen einige Stellen mit ungewöhnlicher Poesie: »Die Menschen in ihren Häusern sind von der eisigen Liebkosung des Winters aufgewacht.« – »Die Stille des Winters ist ohrenbetäubend.« – »Der Schnee ist ein Bett aus spitzen Kristallen […]. Die Nacht ist hungrig. Die Flocken gieren nach frischem Menschenfleisch.«
Geschickt erweitert der Autor bisweilen über Seiten die Perspektive. Der Ich-Erzähler beobachtet den Alten, wie er vor sich hinbrummelt, und erschließt seine mäandernde Gedankenrede: »Als spräche er im Schlaf zu mir […] Du hast meine Pläne durchkreuzt, du bist mir ein Klotz am Bein […] du hast Angst vor dem, was kommt […] ich erzähle dir was […] von dem Buch, das ich gerade lese […] du bist mir ausgeliefert, du Jammerlappen […] du misstraust mir […] du beneidest mich. Weil ich stehen und laufen kann […] Alles wird gut.«
Mysteriös bleiben Anspielungen auf Bibel und Mythologie. Die meisten Dörfler tragen Namen biblischer Herkunft, die mit dem Buchstaben »J« beginnen (Joseph, Jacob, Jonas, Jannick, Judith, Jean, Joëlle). Aus dem Raster fallen nur Matthias und Maria, die Tierärztin. Mit den zentralen Begriffen und Protagonisten der Ikarus-Sage und kurzen Texten dazu sind die sieben Hauptteile des Romans überschrieben (»Das Labyrinth«, »Dädalus«, »Ikarus«, »Die Flügel«, »Die Sonne«). Offensichtlich sind die Themen, die der Roman mit dem Mythos teilt – wie Gefangenschaft, Mut, Tatkraft, Entkommen, Scheitern –, aber eine überzeugende Parallele zu Ikarus’ waghalsigem Übermut und den durch ihn ausgelösten Untergang kann ich nicht finden.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2021 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: