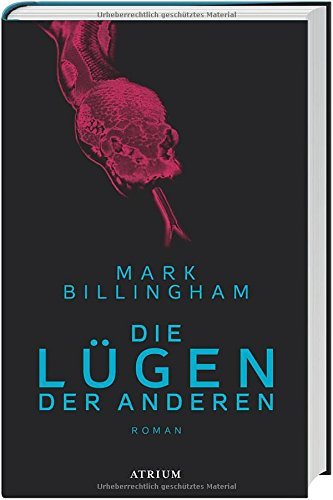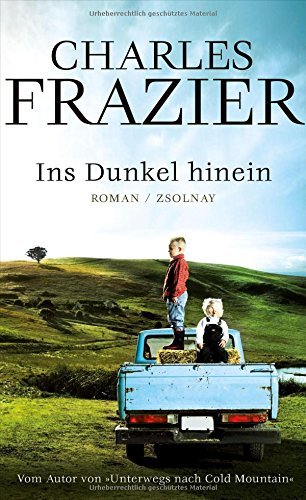
Eine elementare Erziehung
Luce, kaum dreißig, hat schlechte Erfahrungen mit den Menschen hinter sich. Ihre »triste Vergangenheit« hat sie zwar nicht trist gemacht, doch vor allem gelehrt, »dass man auf niemanden zählen konnte«. Also hat sie ihre Verbindung zu den Menschen gekappt und sich auf Stubblefields Lodge zurückgezogen. Dort führt sie ein genügsames Leben, beschränkt auf »die Landschaft, das Wetter, die Tiere«. Von der Welt, die einem nur »schadet«, und dem Treiben der Menschen vernimmt sie nur sanfte Geräusche aus der Ferne – das Feuerwerk zum Fourth of July, das Footballspiel am Freitagabend. »Ein leises Ausatmen war zu hören, wenn die Heimmannschaft einen Punkt machte.«
Die Lodge war einmal die noble Sommerresidenz eines Eisenbahnmillionärs, idyllisch am Bergsee gegenüber der Kleinstadt gelegen. Jetzt ist sie heruntergekommen, wird bald von gefräßigen Schlingpflanzen überwuchert sein. Luce, die für ein paar Dollar als eine Art Hausmeisterin fungiert, sind die oberen Stockwerke unheimlich, und auch von den vielen Räumen im Erdgeschoss nutzt sie nur die große Eingangshalle mit Kamin, »mehltaugefleckten Möbeln, den großen vollen Bücherregalen und dem riesigen Radiostandgerät«. Abends zieht sie ihre Liege von der Veranda dort hinein, und »magische Sänger, die ins Dunkel hinein von Hoffnung und Verzweiflung kündeten«, leisten ihr Gesellschaft, bis sie einschläft.
Was wird jetzt aus ihr werden, wo der alte Stubblefield gestorben ist? Seinen gesamten Grundbesitz hat er seinem »nichtsnutzigen einzigen Enkel« vermacht. Ihr mickrige Bezahlung ist ausgesetzt.
Manchmal zieht es sie zur liebenswerten alten Maddie, die in ihrem Haus mit dem verwunschenen Blumengarten in einer seit einem halben Jahrhundert unveränderten eigenen Welt lebt. Wenn sie ihr ihre immergleichen Moritaten vorsingt – »geschwängerten Mädchen wurde der Schädel eingeschlagen, sie wurden erstochen oder erschossen und dann in der kalten Erde verscharrt oder in den tiefen schwarzen Fluss geworfen« – muss Luce unwillkürlich an ihre jüngere Schwester Lily denken. Auch die wurde schwanger, heiratete aus Hunger nach Liebe John Gary Johnson, genannt Bud. Der konnte die Familie nicht ernähren, war aber zu stolz, das einzugestehen. Als Lily eine Arbeit annahm, begann er sie zu verprügeln; vor kurzem hat er sie getötet.
Derlei ist Luce nicht fremd. Sie und Lily stammen schon aus einer verwahrlosten, lieblosen Familie. Ihre schöne Mutter Lola war viel zu jung für ihre Aufgaben. Mal schlug sie blind auf die »armselige[n] kleine[n] Schlampen« ein, dann erstickte sie sie mit ihren Umarmungen. Schließlich haute sie einfach ab, segelte »unbekümmert einem blauen Horizont entgegen«. Vater Lit, traumatisierter Weltkriegsveteran, steuerte seine Befindlichkeit nach Bedarf mit Amphetaminen und Alkohol. Als stellvertretender Sheriff erledigte er die Drecksarbeit für seinen korrupten Chef. Nachdem Luce vergewaltigt worden war und ihr Vater ihr von einer Anklage abgeraten hatte, brach sie für immer mit ihm.
An einem Hochsommertag erreicht Lilys Schicksal Luce in ihrem Refugium. Ein Auto fährt vor, heraus klettern zwei etwa sechsjährige Zwillinge. Dolores und Frank sind Lilys Kinder. Die Behörden laden sie mit Sack und Pack hier ab, damit Luce sich ihrer annimmt. Der Beamte, der sie nach langer Fahrt abliefert, belässt es bei Andeutungen – »sie haben eine schwere Zeit hinter sich«, sie sind »nicht ganz richtig im Kopf«, weil sie »gesehen haben, was sie gesehen haben« –, doch Luce versteht schon. Die Kinder waren dabei, als ihre Mutter unter den Händen ihres Vaters sterben musste. Während er im Gefängnis seinen Prozess erwartet, waren sie im Methodistenheim untergebracht.
Luce nimmt »die bedürftigen Wesen« an, ohne zu ahnen, wie sie mit ihnen über die Runden kommen soll, noch was sie erwartet. Schon wie die hübschen Kleinen sich nebeneinander aufgestellt haben, erkennt Luce ihren »Konfrontationskurs mit der Welt«: »Raubtierhaft, die Augen dominant in den Gesichtern ... Füchse, die sich in einen Hühnerstall schleichen«.
Eine »schwere Zeit« hat die unfreiwillig vereinte Kleinfamilie auch vor sich. Was immer die unzugänglichen, stummen Kinder in die Finger bekommen, sie stecken es in Brand. Luce kommt kaum nach, die Herde zu löschen. Wie ist es nur möglich, dass so kleine Hände so grausam töten können? Sie findet »Federn, einen schuppigen Fuß«, aber nicht den »Rest des Gockels«. Die Kleinen mit »dünnem Weidenzweig« zu versohlen, gibt sie bald auf, als sie erkennt, dass sie hinter »mörderischer Miene« nicht nur böse sind, sondern auch Angst haben: »Sie begruben jeglichen Schmerz ... tief in ihrem Innersten und weigerten sich zu weinen«. Luce fürchtet, die Kinder würden einmal in der Todeszelle enden wie sicherlich ihr Vater nach dem Prozess – es sei denn, sie kann sie verändern. Zur Mutter fühlt sie sich nicht berufen, aber vielleicht kann sie ihnen eine konsequente Lehrerin sein. Und ganz pädagogisch korrekt, wie aus dem Lehrbuch, konzipiert und realisiert sie ihre nächsten Schritte: konsequent Freundlichkeit ausstrahlen, motivieren, ermuntern, anschaulich schildern, fragen, bestätigen, loben, danken, nachfragen, lächeln, nicht verurteilen ...
Wie das Essen auf den Tisch kommt, dass man ein Huhn nicht schlecht behandeln darf, wenn man seine Eier verwerten will, das zeigt und erklärt sie ihnen als erstes. Dann den Gemüsegarten, die Obstbäume, den Regenwald mit seinen Lebewesen, die alles im Gleichgewicht halten, schließlich das Feuer, dessen gefährlicher Faszination sich auch Luce nicht entziehen kann. Lektion für Lektion, Regel für Regel (»eine wichtige Fähigkeit, um mit anderen Leuten auf der Welt zusammenzuleben«) begleiten die Kinder sie, doch offenkundig teilnahmslos, stumm und ohne ein Zeichen der Veränderung durch Luce' »Gequassel«. »Sie waren ziemlich verkorkst.«
Bei ihren gemeinsamen Wanderungen durch Feld und Flur begegnen sie eines Tages Maddie. Ein angeschirrtes Pony trottet im Kreis herum und treibt damit eine Holzkonstruktion, die Zuckerrohr auspresst. Den Saft kocht Maddie in einem großen Kessel über einem Holzkohlenfeuer aus. Überraschung: Nicht das Feuer, sondern die alte Stute zieht die Kinder magisch an. Sie dürfen sie reiten, zusammen »wie normale Kinder«, und ihr Name ist das erste Wort, das sie nachsprechen: »Sally«.
Während es Luce mit ihrem Naturtalent langsam gelingt, Zugang zu den Kindern aufzuschließen, taucht der junge Erbe Stubblefield auf. Er spürt Luce' besondere Ausstrahlung und Verletzlichkeit. Mit viel Einfühlungsvermögen gewinnt er behutsam ihr Herz. Doch es ist »ein schlechter Zeitpunkt, was Liebe anbelangte«; noch erfordern die Kinder Luce' volle Aufmerksamkeit. Aber Stubblefield kann sich zurückhalten.
Fast zeitgleich erscheint ein zweiter Mann auf der Bildfläche. Lilys Mörder Bud ist nach kurzer Haft entlassen worden, denn da war niemand, der gegen ihn aussagte, und das soll auch so bleiben. Dazu muss Bud die beiden Augenzeugen seines Verbrechens dauerhaft zum Schweigen bringen.
Zwischen empfindsamer Beziehungsgeschichte und Thriller bewegen wir uns somit auf den Showdown in Kapitel III zu, der sich hoch in den schneebedeckten Bergen anbahnt. Im szenischen Präsens geschildert, erstarrt unser Blut von Szene zu Szene ...
Charles Fraziers Roman »Nightwoods«  – Anette Grube hat ihn übersetzt – fasziniert auf vielfältige Weise. Die Atmosphäre ist eher düster und melancholisch, aber nicht ohne Hoffnung und Optimismus. Der dichte, bildstarke Stil erfasst den Leser von der ersten Seite an und führt wie auf Geisterbahnschienen durch abenteuerliche, makabre, zarte, befremdliche, uramerikanische Szenen, in denen wir teils kruden und schmierigen, aber originellen, authentisch wirkenden Charakteren begegnen. Sie sind Produkte der rauen natürlichen Gegebenheiten und Opfer ihrer sozialen Verhältnisse. (Die Handlung ist in den Sechzigerjahren angesiedelt.) Harte Burschen knallen Bären in Bergwäldern ab; »Suffköpfe« schießen Rotwild aus dem Auto heraus; keiner schert sich mehr als notwendig um den anderen. Die Protagonistin behält bei all dem einen klaren Kopf; nur ihre Redeweise klingt manchmal etwas zu abgeklärt, zu lehrerhaft.
– Anette Grube hat ihn übersetzt – fasziniert auf vielfältige Weise. Die Atmosphäre ist eher düster und melancholisch, aber nicht ohne Hoffnung und Optimismus. Der dichte, bildstarke Stil erfasst den Leser von der ersten Seite an und führt wie auf Geisterbahnschienen durch abenteuerliche, makabre, zarte, befremdliche, uramerikanische Szenen, in denen wir teils kruden und schmierigen, aber originellen, authentisch wirkenden Charakteren begegnen. Sie sind Produkte der rauen natürlichen Gegebenheiten und Opfer ihrer sozialen Verhältnisse. (Die Handlung ist in den Sechzigerjahren angesiedelt.) Harte Burschen knallen Bären in Bergwäldern ab; »Suffköpfe« schießen Rotwild aus dem Auto heraus; keiner schert sich mehr als notwendig um den anderen. Die Protagonistin behält bei all dem einen klaren Kopf; nur ihre Redeweise klingt manchmal etwas zu abgeklärt, zu lehrerhaft.
 · Herkunft:
· Herkunft: