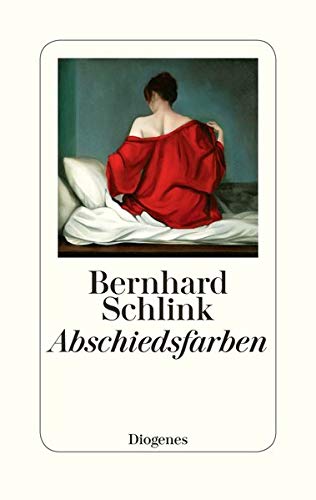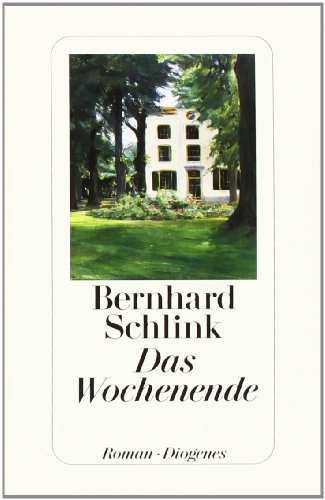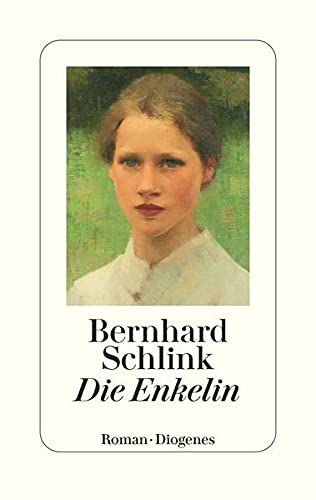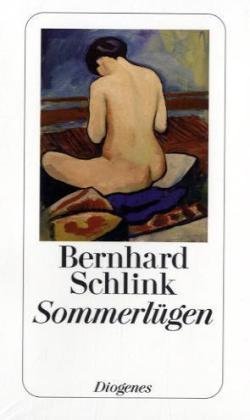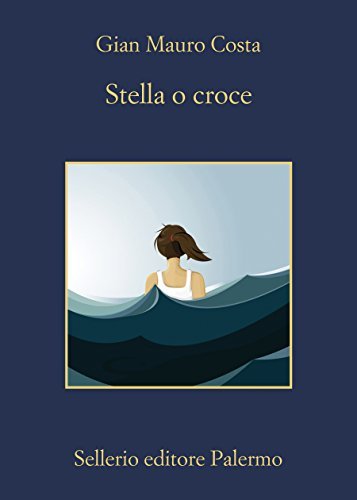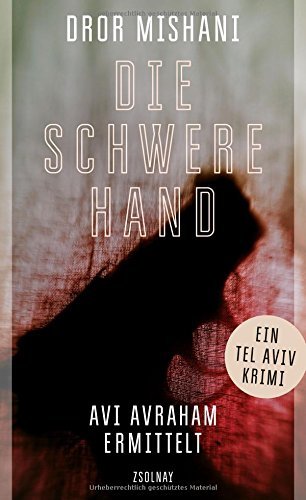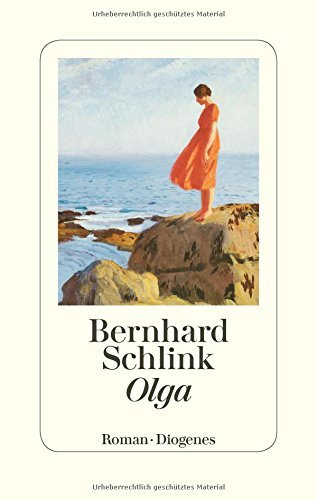
Olga
von Bernhard Schlink
Aus bescheidensten Anfängen erkämpft sich Olga mit gesundem Menschenverstand und Ehrgeiz ihren Weg durch neun deutsche Jahrzehnte. Ihr Geliebter aus feinen Kreisen träumt von Größe und Heldentum in der Ferne – und scheitert an den Realitäten. Ferdinand, in dessen Familie Olga ihre letzten Jahre verbrachte, rekonstruiert ihre Lebensgeschichte.
Menschliche Größe gegen Größenwahn
Olga Rinke ist ein kantiges Kind mit vielen Eigenschaften. Weil sie ihre Eltern früh verlor, nimmt die hartherzige, ärmliche Großmutter sie zu sich. In dem Dorf in Pommern müssen alle Kinder auf dem Feld und im Garten mithelfen. Aber Olga, ein »trotziges, ungezogenes, undankbares Kind« und ehrgeizig dazu, will »mehr« als die anderen – mehr lernen, mehr wissen, mehr können, und im Lehrer, im Organisten, im Pfarrer findet sie Förderer ihrer Talente.
Herbert Schröder bedarf solcher Unterstützung nicht. Der Sohn des reichen Gutsbesitzers und seine Schwester Viktoria werden von Hauslehrern unterrichtet. Kleidung, Manieren und Sprache sondern sie vom gemeinen Volk ab. Ihre Privilegien verleihen ihnen die »hochmütige Furchtlosigkeit derer, die in ihrem Leben kein Leid zu erdulden noch zu befürchten haben«, machen sie aber auch einsam. In ihrer Abgesondertheit und in ihrer Strebsamkeit gleichen sie dem Mädchen am anderen Rand der Dorfgesellschaft. Diese Verwandtschaft führt Olga und Herbert zusammen. Aus Gleichgesinntheit und Freundschaft reift Liebe, doch jegliches formelle Bündnis ist gesellschaftlich inopportun. Da droht Enterbung, da wird schweres Geschütz aufgefahren, um die Verbindung zu sprengen.
Derweil hat Olga Schulen und Lehrerseminar absolviert und eine Stelle an ihrer ursprünglichen Dorfschule angetreten. Viktoria setzt alle Hebel in Bewegung, damit sie ganz weit weg von Herbert in ein Kaff nördlich von Tilsit versetzt werde. Aber nicht Enterbung, nicht Entfernung kann die Liebe brechen.
Wäre da nicht Herberts Sehnsucht nach Größerem. Er hat Nietzsche gelesen, und da beschließt er, ein »Übermensch zu werden«. Olga findet dieses Gerede zwar »hohl«, bewundert aber andererseits Herberts stattliches Erscheinungsbild und seine rigorose Entschlossenheit. Seinen großmäuligen Reden und seinem Herrenmenschen-Gebaren hat sie nichts entgegenzusetzen. Im Innersten zieht es ihn in unendliche Weiten, in leere Wüstenlandschaften, in die Extremregionen der Arktis, und seine Motivation verlangt das Äußerste: »Deutschland groß zu machen und mit Deutschland groß zu werden, auch wenn es ihm Grausamkeiten gegen sich und andere abverlangte«.
Bald bietet ihm die Expansionspolitik des Kaiserreichs Gelegenheiten der Bewährung. Mit »Hurra« geht es 1904 nach Deutsch-Südwest. Mit Kavallerie, Artillerie und Maschinengewehr bekämpft das deutsche Wesen heldenhaft die armseligen Herero (»ein Menschenschlag, der noch auf tiefster Kulturstufe steht«) und entzieht ihnen ihre Lebensgrundlagen, so dass die »schwarzen Teufel« zu Tausenden verdursten und verhungern. Doch der Ausflug in die finsteren Tiefen des Kolonialismus kann Herberts Durst nach Größe und Weite nicht stillen. Er bricht zu unzähligen weiteren Fernreisen auf, hält Vorträge darüber, gewinnt Sponsoren, bis er sich nach langer Vorbereitung der arktischen Herausforderung stellt: Nordostpassage und Nordpol. 1913 bricht die Expedition auf, aber zurück kehrt Herbert (der übrigens ein gleichnamiges historisches Vorbild hat) nie.
Über lange Zeit hofft Olga noch auf die Rückkehr des Geliebten. Während all der Jahre zuvor hat sie sich von den Details seiner Abenteuer ferngehalten und ihr eigenes Glück in erzieherischen Aufgaben gesucht, als Schullehrerin, in kulturellem Engagement im Dorf, in der Förderung eines zweijährigen Findelkindes (aus dem ironischerweise später ein SS-Folterer wird). Mit 53 Jahren verliert Olga ihr Gehör, wechselt an eine Gehörlosenschule, übernimmt Näharbeiten.
In der Zwischenzeit ist Europa im Kriegschaos versunken. Zwei Weltkriege spült der Autor im Schnellwaschgang durch, wobei er seiner tauben Protagonistin die grauenvolle Geräuschkulisse der Panzer, Tiefflieger, Bombenexplosionen und schreienden Sterbenden erspart und den anderen Sinnen umso mehr Wucht verleiht (»die Explosion der Lokomotive war ein tonloser, farbenprächtiger Feuerball«).
Den Neuanfang nach dem Krieg markieren ein neuer Romanteil, ein neuer Ort und ein neuer Erzähler, jüngster Sohn einer Pfarrerfamilie am Neckar, in deren Haushalt sich Olga ihr täglich Brot erarbeitet. Bis zu ihrem Tod bleibt der brave, etwas langwelige und farblos bleibende Ferdinand ihr ständiger Begleiter und Zuhörer. Er wird zum Bewahrer ihres Schatzes – der vielen Geschichten aus ihrem eigenen Leben, von Herberts Abenteuern und von ihren Briefen, deren Adressat sie möglicherweise nie zu lesen bekam. Letztlich ist es Ferdinand, der Olgas Biografie, wie wir sie im ersten Teil zu lesen bekamen, rekonstruiert.
Eben jene Briefe enthält dann der dritte Teil des Romans. Das Wissen um sie hat Ferdinand nicht ruhen lassen, bis er sie im norwegischen Tromsø zu kaufen bekommt. Jetzt klärt sich manches Rätsel, das den Leser bis dahin bewegt hat, manch geahntes Geheimnis, und manches Verhalten Olgas gerät im Rückblick in ein fragwürdiges Licht. Hätte sie ihrem Herbert sein tödliches Schicksal womöglich ersparen können? Hatte sie eine Chance, ihn von seinem bornierten Ideal, als Held für eine große Sache zu sterben, abzubringen? Hätte sie nachdrücklicher um ihn kämpfen müssen, anstatt die Augen vor den Gefahren zu verschließen? Hat sie Schuld auf sich geladen, indem sie nicht alles offenlegte, was sie wusste?
All das erzählt der erfolgsverwöhnte Autor und Jurist in gekonnt präziser, feiner, kühler, distanzierter Manier. Unter die Haut geht die Geschichte dem Leser aber nicht. Die Figuren bleiben zu sehr auf Distanz, als dass sie und ihre schwierige Liebe emotional anrühren könnten. Der Plot bietet tragische Elemente, bewirkt aber keine erschütternde Katharsis. Die Handlung – weit ausgreifend und stellenweise packend – ist durch ihre Strukturierung notgedrungen reich an Redundanzen: In allen drei Teilen wiederholen sich umfängliche Inhalte, wenn auch immer in ein anderes Licht gerückt, aus anderer Perspektive formuliert. Literarisch passt das, bedarf aber des Erzähltalents eines Bernhard Schlink, um den Leser nicht gelangweilt wegdösen zu lassen.
Um der Liebesbeziehung seiner beiden Protagonisten von Anfang an Knüppel zwischen die Beine zu werfen, bedient sich Schlink des Klischees des unüberwindlichen Standesunterschiedes, das (inklusive intriganter Blutsverwandter) zum Kernrepertoire der Trivialliteratur gehört und dort seit jeher, in unendlichen Variationen breitgetreten, zuverlässig Tränenströme auslöst. Musste dieser Tiefschlag sein?
Zu Recht gibt Olga den Titel des ganzen Romans. Gegen alle Schwierigkeiten ihrer neunzig Lebensjahre ist sie eigenständig und entschieden ihren Weg gegangen. Bis zum Schluss überragt die stolze, aufrechte Frau alle Höhen und Tiefen des Geschehens geradezu vorbildhaft. Sie ist die Stimme der Vernunft, der Geradlinigkeit, des gesunden Menschenverstandes, der Bürgerlichkeit, gewappnet gegen Propaganda, billige Parolen und wohlfeile Moden. Eine wie sie, die sich Bildung erkämpfen musste und bis an ihr Lebensende musisch und kulturell weiterentwickelt hat, bringt kein Verständnis auf für moderne pseudo-rebellische Verweigerungshaltungen (»nicht zu lernen, wenn man lernen konnte, war dumm, verwöhnt, anmaßend«). Ihre Kritik an der jüngeren Generation (die gern »moralisiert«, es aber »zugleich gemütlich« haben wolle), am Holocaustdenkmal, an der Europapolitik und der Globalisierung macht neugierig auf mehr von ihren Ansichten, auch aus den Kriegsjahren und der Nachkriegsgeschichte. Aber eine Ausweitung dieser Phasen und Themen hätte wohl die Gewichte verschoben oder das gesamte Konzept umgeworfen.
 · Herkunft:
· Herkunft: