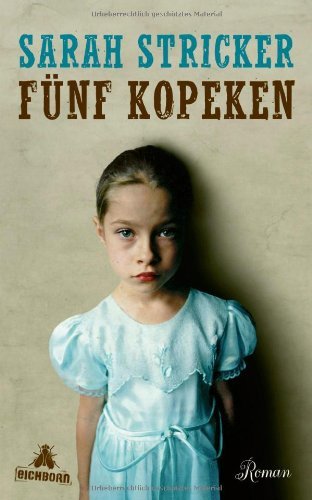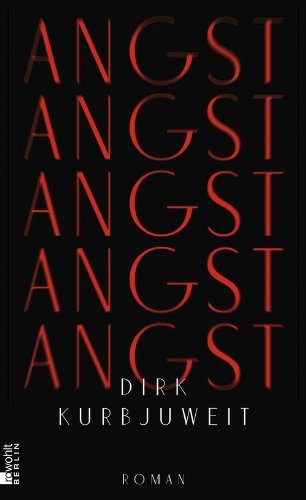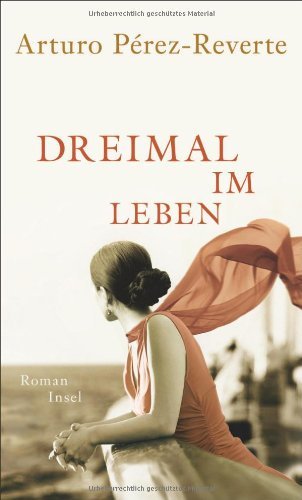
Immer zu Diensten – le chevalier servant
Einen angenehmen Beruf hat Max Costa erwählt und perfektioniert. Die Grundvoraussetzungen verdankt er der Natur: Attraktivität, Charisma, Musikalität und Anmut; das kleine Einmaleins dazu hat ihm ein adliger Kamerad sieben Jahre zuvor beigebracht: kultiviertes Benehmen, Tanzschritte und Galanterie.
Jetzt – im November 1929 – reist der Sechsundzwanzigjährige auf dem Luxusdampfer Cap Polonio über den Atlantik gen Buenos Aires und unterhält die feine Damenwelt an Bord als charmanter Salontänzer. Dafür erhält er freie Kost und Logis, ein kleines Salär, gutes Taschengeld und natürlich manch anderes Plaisir.
»Mit dem ruhigen Auge eines erfahrenen Jägers« seziert Max den Typ Mann, der soeben seine Dame in den Ballsaal geleitet. Aus seinem Verhalten ihr gegenüber, seiner Kleidung und seinen Accessoires lassen sich wertvolle Schlüsse ziehen und weiterführende Pläne schmieden, »vom Salontanz zu lukrativeren Tätigkeiten«. »Eine Frau ist niemals nur eine Frau ... Sie ist auch und vor allem die Männer, die sie hatte, hat und haben könnte«, hatte ihm sein Lehrmeister mit auf den Weg gegeben, als »Schlüssel zur Schatzkammer«.
Natürlich hat Max nicht versäumt, rechtzeitig die Liste der Tischreservierungen zu studieren. Der Herr im Visier ist der berühmte Komponist Armando de Troeye (43), neben ihm schwebt elegant seine schöne Ehefrau Mercedes Inzunza (29, genannt »Mecha«) herein. Sie logieren in einer exklusiven Suite der ersten Klasse.
Nach dem festlichen Diner bittet Max die Señora zum Tanz. Ihr schulter- und rückenfreies, violett changierendes Abendkleid, dessen Decolleté ein edles Perlencollier schmückt, erregt allgemeines Aufsehen. Mit »respektvoller Distanz« führt der Profi sie durch die komplizierten Schrittkombinationen des Tangos, und sie folgt mit grazilen, geschmeidigen Bewegungen. Dann geleitet Max sie zurück zu ihrem Tisch, wo sie von ihrem Gatten – fein distinguierter Oberlippenbart, selbstsicher, intelligenter Ausdruck – erwartet wird.
Selbstverständlich ist Armando de Troeye nichts von dem entgangen, was sich auf der Tanzfläche abspielte. Allerdings ist sein Interesse beruflich bedingt. Denn ausgerechnet er, ein Nichttänzer, will einen »unvergesslichen« Tango komponieren. Nicht so einen sittsamen Modetanz, wie er seit dem ersten Weltkrieg über den Atlantik in die Salons von Paris schwappte und dann ganz Europa eroberte; sein »Tango de la Guardia Vieja« soll die ursprüngliche leidenschaftlich-frivole Kunst aufnehmen, die in Argentiniens Bordellen und Spelunken ihren Anfang genommen hatte. Dort kennt Max sich aus; schließlich wurde er in Buenos Aires geboren und wuchs da auf, bis er mit seinem Vater nach Spanien übersiedelte. Deshalb bittet Armando de Troeye Max um Einhilfe. Er soll ihn in die einschlägigen Viertel und Kreise seiner vitalen Geburtsstadt bringen, wo er sich umsehen, umhören und lernen möchte. Und auch Mecha zieht es dorthin ...
Bei der gemeinsamen Exkursion in die gefährlichen Hafenviertel voller verruchter Kneipen, Bars und Freudenhäuser finden sie rasch ein passendes Etablissement, wo sinnliche Animierdamen lasziv tanzen. Armando, von Alkohol und Kokain befeuert, kommentiert ihre Bewegungen (»fast erregend«, »herrlich versaut«) ebenso wie die Qualitäten der Musik. Die heiße Umgebung lässt die drei Besucher nicht unberührt: Armando (den Max widerlich findet und zutiefst verachtet) lässt sehr spezielle sexuelle Vorlieben erkennen, und Mecha scheint willens, an diesem Abend ihre eigenen Grenzen zu übertreten. Sie benutzt Max für sexuelle Spielchen, weiß ihn aus der sicheren Distanz ihrer Oberschichtzugehörigkeit zu reizen und obsessiv in Besitz zu nehmen. Doch Max ist klar, dass er nach diesen Diensten schnell wieder fallengelassen wird; er holt sich sein Preisgeld auf seine Art und verschwindet anschließend spurlos von der Bildfläche.
Sieben Jahre später kreuzen sich Max' und Mechas Wege zufällig in Nizza. Er hat sich zu einer schillernden Gestalt entwickelt. In den Nobelhotels europäischer Haupt- und Vergnügungsstädte bestiehlt der »chevalier servant« reiche Damen und hat mit einem befreundeten Panzerknacker-Profi auch schon diverse Tresore ausgeraubt. Aber dank venezolanischem Pass, guter Beziehungen in jede Richtung und unverblichenem Charme muss er die französische Polizei nicht fürchten und ist in erlesenen Kreisen nach wie vor ein gern gesehener Gast. Doch nun wurde der Gigolo in eine heikle Spionageaffäre hineingezogen. Geheimdienstler erpressen ihn mit seinen Raubzügen und verlangen, dass er für sie als »Einbrecher im Smoking« Unterlagen aus einem Safe beschafft. Jetzt geht es um Leben und Tod.
Zum dritten Mal in ihrem Leben begegnen sich Max und Mecha 1967 in Sorrent. Er ist 64 Jahre alt, und der Lack ist ab. Seine Missetaten füllen pralle Polizeiakten in Europa und Amerika. Jetzt arbeitet er als Hausmeister und Chauffeur eines italienischen Psychologen, bei dem er sich mit gefälschten Referenzen eingeschlichen hat. Auf der Piazza sieht er einen jungen Mann in Begleitung zweier Damen flanieren; die ältere scheint ihm der »Abglanz eines längst vergessenen Bildes«. Tatsächlich ist es Mecha, die sich mit ihrem Sohn Jorge und seiner Freundin Irina anlässlich eines bedeutenden Schachturniers im Nobelhotel Vittoria einquartiert hat. Und noch immer weiß Mecha Max für sich einzuspannen. Obwohl er eigentlich zu alt für ihren Auftrag ist, nimmt er ihn an – nicht etwa aus Liebe zu Mecha, sondern weil er sich selber noch einmal beweisen möchte ...
Arturo Pérez-Reverte hat mit »El tango de la Guardia Vieja«  (übersetzt von Petra Zickmann) einen bildstarken, poetischen Roman mit beeindruckendem Detailreichtum verfasst. Die Figuren sind differenziert und überzeugend gezeichnet, und am Ende krönt die prickelnde Präzision eines Schachspiels den Handlungsverlauf. Besonders reizvoll sind die atmosphärisch dichten Schilderungen der höchst unterschiedlichen Schauplätze zwischen verruchten Kaschemmen und mondänen Hotels und des (längst verwehten) Zeitgeistes der jeweiligen Epochen. Die primäre Erzählebene ist die der Sorrentiner Episode; parallel zu ihr lässt der Autor die Vergangenheiten einfließen – die Schiffspassage, die wenigen Tage in Buenos Aires und den spannenden kleinen Agentenplot in Nizza.
(übersetzt von Petra Zickmann) einen bildstarken, poetischen Roman mit beeindruckendem Detailreichtum verfasst. Die Figuren sind differenziert und überzeugend gezeichnet, und am Ende krönt die prickelnde Präzision eines Schachspiels den Handlungsverlauf. Besonders reizvoll sind die atmosphärisch dichten Schilderungen der höchst unterschiedlichen Schauplätze zwischen verruchten Kaschemmen und mondänen Hotels und des (längst verwehten) Zeitgeistes der jeweiligen Epochen. Die primäre Erzählebene ist die der Sorrentiner Episode; parallel zu ihr lässt der Autor die Vergangenheiten einfließen – die Schiffspassage, die wenigen Tage in Buenos Aires und den spannenden kleinen Agentenplot in Nizza.
Ist »Dreimal im Leben« die Geschichte einer Liebe? Wenn überhaupt, so ist die Beziehung ambivalent und äußerst ungleichgewichtig. Max Costas lebenslange tänzerische, amouröse und kriminelle Machenschaften sollten in erster Linie sein Überleben sichern, ihn aber auch ein bisschen an der Welt der Reichen und Schönen teilhaben lassen. Mecha dagegen gehört zu jener Welt. Am Ende behauptet sie, den »perfekten Gentleman« Max mit seinem »Salontänzerlächeln« immer geliebt zu haben – indes was ist bei ihr Wahrheit, was Strategie? Immerhin gab es Situationen, wo sie ihn ans Messer hätte liefern können und dann doch loyal zu ihm stand.
Max ist ein gebranntes Kind. Zeitlebens wird ihm die beschämende Missachtung einer reifen Dame in Erinnerung bleiben, die den siebzehnjährigen Pagen im Barcelona Ritz für Liebesdienste aufs Zimmer lotste. Schlimmer als die paar Peseten, mit denen sie ihn danach abspeiste, demütigte ihn, wie sie empört ihr Gesicht abwandte, als er ihr einen Abschiedskuss geben wollte. Daraus hat er gelernt. Er hat zwar viele Frauen verführt, aber wahrhaftige Liebe jenseits seiner bezahlten Dienste niemals zugelassen; zu groß war die Gefahr, enttäuscht zu werden. So hatte er auch Mecha, wiewohl er sie leidenschaftlich geliebt hatte, nach kurzer Zeit »bereits vergessen«.
 · Herkunft:
· Herkunft: