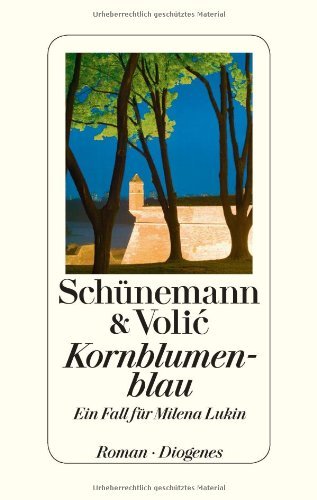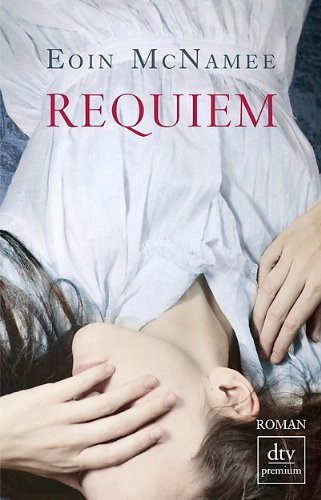Zuviel des Guten
Dies ist unbestritten ein literarisches Meisterwerk des Autors und seiner Übersetzerin Maralde Meyer-Minnemann, die in gewiss mühseliger Arbeit eine wahrhaft mächtige, Respekt verdienende sprachliche Nachschöpfung von »O Arquipelago da Insonia« erbracht hat. Das Meisterliche dieses Romans ist, wie allein die höchst eigenwillige, von Sinn-Bildern pralle Erzähltechnik Themen, Charaktere, Atmosphäre und Handlung trägt.
Der Plot ist schlicht, eigentlich kaum nacherzählbar. Der Ich-Erzähler ist der Enkel eines Gutsbesitzers, der das Landgut am Tejo, gegenüber von Lissabon, einst begründet, mit seinen eigenen Händen aufgebaut und über Jahrzehnte mit eisernem Willen und Härte gegen sich und alle anderen vergrößert hat. Neben und nach diesem Patriarchen kann niemand aufblühen: »Mein Großvater schuf um sich herum eine Aura der Angst« . Die Arbeiter des Gutes gehorchen stumpf, »wie Tiere sich aus Gewohnheit oder aus Angst unterwerfen «. Am nächsten steht ihm wohl der Verwalter, aus ähnlichem Holz geschnitzt, ihm skrupellos ergeben, zu brutalen Eingriffen bereit. Der leibliche Sohn hingegen findet keine Nähe zum Vater und auch nicht zu seinen beiden eigenen Söhnen, weder dem legitimen und von allen bevorzugten, noch zum Erzähler, unehelich und merkwürdig, einem Autisten. Der Großvater verachtet sie alle (»Idiot«).
Die Schauplätze sind auf unspezifische Chiffren reduziert (Lagune, Gassen im Dorf, Fenster, Kornspeicher, das obere Stockwerk), ebenso die Tiere (Tauben, Kaninchen, Milane und Tukane, das Pferd des Vaters), und selbst die meisten Personen bleiben namenlos (Großvater, Mutter, Enkel, der Bruder, die Mägde, der Verwalter, sein Gehilfe). Wie Fresken-Heilige gewinnen die Figuren ihre Identität durch Attribute – der mit der Mütze vor der Brust ist der Verwalter, der mit der Schere im Hals ist der Urgroßvater, der mit dem Pferd ist der Vater -, durch immer gleiche Utensilien, Gesten und Phrasen.
Die Frauen führen ein Dasein am Rande, sind eingeschüchterte, verkümmerte Wesen. Die Großmutter im Salon wird nur durch das Klirren ihrer Teetasse auf der Untertasse wahrgenommen, die Dienstbotinnen sind willenlos dem gefräßigen Herrn ausgeliefert, der sich ihrer auf rohe Weise bedient (»Komm mit«). Eine von ihnen ist die Mutter des Erzählers; weniger eindeutig ist die Vaterschaft: »Von wem von uns beiden ist das der Sohn vom Idioten oder von mir?« »Der da ist wessen Sohn?«
»Der da«, der Ich-Erzähler, versucht, sich und das, was ihn umgibt, zu verstehen. Nach außen sprachlos (»der ich nie gesprochen habe«), in seiner Gedankenwelt jedoch niemals rastend, tut er das nicht analytisch, sondern wird getrieben von Fragmenten (Fotos, Orte, Gesichter, jenen Gesten, Redefetzen …), die assoziativ verknüpft durch seinen Geist rasen. So formen sich Plot-Stücke: Szenen des Landlebens, der Jagd, des Sterbens, des Beisammenseins im Salon, des derben Miteinanders in den Scheunen, der ewigen Natur; ein Priester wird erschossen, einem zu aufmüpfigen Zimmermann das Knie zerschmettert, keimende Liebe bleibt unerfüllt.
Lobo Antunes’ Intention ist es, die (er)drückende Stimmung zu fassen, die hoffnungslose Permanenz der alles erstickenden archaischen Hierarchie. »Es gibt hier nichts Neues, alles ist alt … der gleiche Wind und die gleichen Geräusche, die mein Vater als Kind gehört hatte und mein Großvater vor ihm und der Vater meines Großvaters … diese gestaute Stille, Stunden, die sich, ohne je voranzuschreiten, wiederholten …«. In der Zeitlosigkeit, der Simultaneität erscheint jede Individualität, Chronologie, Kausalität aufgelöst.
Diesen Eindruck transportiert der Erzählstil, der ein wenig an James Joyce und Virginia Woolf erinnert. Im Gegensatz zu deren stream of consciousness – dem unvermittelten Nachvollziehen des menschlichen Gedankenstroms – handelt es sich hier aber um ein gezielt konstruiertes, symbolbeladenes Artefakt.
Die Erzählung ist ein breiter, ruhig, aber kraftvoll dahinziehender Fluss von sprachlichen Preziosen, Erinnerungen, Alltagsszenen, Traum- und Zerrbildern, mittendrin Gesprächsfetzen – wörtliche Reden ohne ein einziges Verb des Sagens: »Verlass mich nicht«, »Bring deine Sachen nach oben«, »Chef«, »Senhor«, »Nicht mal sterben kannst du Idiot«. In gleicher Weise treiben immer wieder gewisse Gegenstände vorbei, deren zentrale Bedeutung oder symbolische Zeigekraft sich in der Wiederholung verdichtet: die klirrende Teetasse, der Duft der Truhen voller Wäsche, der anschwellende Tropfen an der Decke, die Wanduhr. Besonders sinnfällig finde ich das Motiv von Gesichtern, die sich im zitternden Wasserspiegel eines Brunnens zersetzen und wieder zusammenfügen, indem er sich beruhigt.
Trotz sehr präzise erfasster Impressionen bleiben die Bedeutungen und Zusammenhänge unscharf, denn einem »ich weiß« folgt sogleich ein »ich weiß nicht«. Die Welt des Ich-Erzählers ist befremdlich, so wie er selber ein Rätsel bleibt: »Wenn sie mich wenigstens durch eine Geste, einen Seitenblick, eine Haltung des Körpers verstehen würden, der mir nicht gehorcht, entgleitet, die Männer vom Auto [fragen:] – Was will er denn jetzt?«
In den Teilen II und III (ab S. 107 bzw. 217) löst sich die bisher schon spärliche Ordnung weiter auf. Der Ich-Erzähler wurde von seinem Bruder in eine Klinik eingeliefert. Wie die Syntax bricht – mitten im Wort (!) drängen sich andere Gedanken dazwischen -, überlagern sich die diversen Zeit- und Bedeutungsebenen, und selbst die »Ich«-Perspektive verschwimmt zwischen der des Autisten und der von Maria Adelaide, der Frau des Bruders, als probiere er verschiedene Realitäten oder Sichtweisen der Wirklichkeit aus (»der Bleistift des Arztes [notiert:] – Sie leben von Stimmen umgeben«).
Warum dann nur 3 Sterne?
Weil die Wirksamkeit dieser virtuosen Erzähltechnik nach spätestens einhundert Seiten erschöpft ist.
Weil die explosive Fülle von Handlungsatomen – jedes für sich faszinierend – in der Summe verpufft.
Weil das Lesen immer mehr zu einem tranceartigen Prozess gerät, bei dem die Details verschwimmen, untergehen, nur noch peripher verarbeitet werden.
Weil die Lektüre für Leser, die auch Unterhaltung suchen, anstrengend wird. Aus dem träge dahinfließenden Strom von Redundanzen tauchen nur spärlich neue Handlungselemente und neue Erkenntnisse auf.
Kurzum: zuviel des Guten.
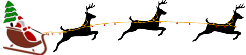 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: