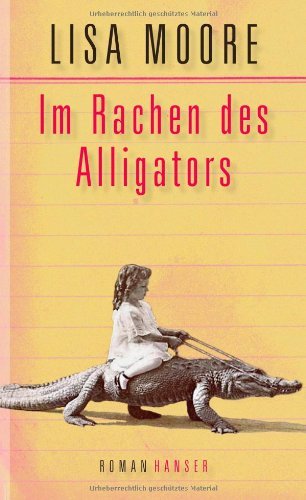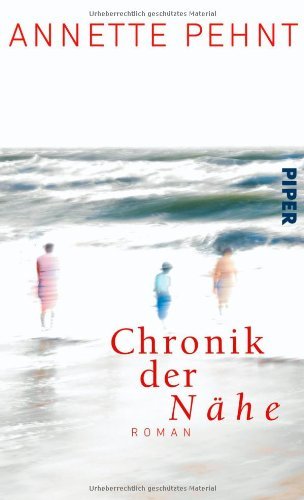
Schmerzvolles Tasten
Annette Pehnt ist eine Meisterin der lakonischen Prägnanz und des feinen Sezierens von Kommunikation. Sie erfasst in ihren Romanen mit unnachahmlicher Treffsicherheit, was zwischen, hinter und über den Wörtern vorgeht, die die Menschen einander im Alltag zureden (Absichten, Erwartungen, Assoziationen, Enttäuschungen, Annäherung, Befremden …), und bannt alle Nuancen und Ebenen in einen halb naturalistischen, halb monologisierenden Erzählstil, der geradezu minimalistisch daher kommt – kein Wort zuviel – und auf Anführungszeichen und Fragezeichen weitgehend verzichten kann.
Mit diesem Prozedere, das einen scheinbar leichtfüßigen, transparenten Ton kreiert, hat Pehnt schon unterschiedliche Sujets überzeugend bearbeitet, beispielsweise Begegnungen im Altersheim (»Haus der Schildkröten«, 2006) und »Mobbing« (2007 erschienen und 2013 mit Susanne Wolff und Tobias Moretti für die ARD ergreifend verfilmt). In ihrem neuesten Roman »Die Chronik der Nähe« (2012) erzählt sie die Beziehungen zwischen drei Frauen (Großmutter, Mutter, Tochter), die die Nähe der anderen suchen und doch kaum finden können.
Die Erzählsituation ist abgesteckt durch die wenigen Tage, die die Tochter (die namenlose Ich-Erzählerin) am Krankenbett ihrer sterbenden Mutter Annie verbringt. Sie will, ehe endgültiges Schweigen eintritt, Klarheit darüber gewinnen, was das Verhältnis zwischen ihnen so erschwert hat. Die Ich-Erzählerin hat schon lange alles versucht, ihre Mutter dazu zu bewegen, sich zu öffnen (»Anfänge aller Art, weißt du noch, Mama.«; »Ich habe ja auch keine Ahnung, wie es für dich war.«), doch die verweigerte sich (»ach komm, wischst du alles weg, komm, das sind doch nur alte Geschichten, jetzt bohr doch nicht immer so.«). Zuletzt hat die Tochter all ihre Überredungskünste aufgeboten, um Annie für eine Reise nach Rügen zu gewinnen – sie beide allein, um endlich mal etwas aus der Vergangenheit, den harten Kriegsjahren und über Großmutter zu erfahren.
Wenn Annie stirbt, wird ihre Tochter mit der schmerzlichen Distanziertheit weiterleben müssen, ohne jemals Frieden zu finden, ohne die Vergangenheit wirklich begraben zu können.
Aus den stillen Monologen der Tochter erfährt der Leser die relevanten Lebensstationen und markanten Stressszenen der drei Frauen in der ferneren und näheren Vergangenheit. Im Mittelpunkt steht Annie, die weder zu ihrer Mutter noch zu ihrer Tochter ein ungetrübtes Verhältnis zu pflegen in der Lage war. Sie ist Opfer und Verursacherin. Grundhaltungen, Charakterzüge und Schlüsselerlebnisse wirken sich bis in die Generation der Erzählerin aus.
Die Großmutter war spröde und offenbar unfähig zu Empathie. Ihre Worte befremdeten und verletzten nicht selten die Angesprochenen durch ihre unverblümte Direktheit, was man ihr als unbedachte Taktlosigkeit oder Leichtfertigkeit nachsehen könnte; in Wirklichkeit schien sie Wörter wie Nadelspitzen und Messerklingen einzusetzen, um ihre Umgebung zu manipulieren. Die Wunden, die sie bei ihrer eigenen Tochter schlug, verheilten nie.
Unter der Unmöglichkeit der Nähe zu dieser Frau litt Annie bereits in der Kindheit. Wie oft hatte Großmutter ihr Kind allein gelassen, in den Kriegsjahren seinen Ängsten überlassen? Noch im Alter schreckte Annie hoch, wenn irgendwo eine Polizei- oder Feuerwehrsirene aufheulte. Damals brachen der Kleinen vor Angst die Beine weg, als Großmutter sie bei nächtlichem Fliegeralarm aus dem Bett hochriss, um sie beide im Bunker in Sicherheit zu bringen. Aber statt Trost und Schutz erntete Annie Vorhaltungen: »Du quälst mich. Du bringst uns beide um.« Großmutter entschied dann, das Kind solle in einem »halbsicheren Keller« in Hausnähe verbleiben; von da an konnte sie ihre »Puddingbeine« jede Nacht auf einer Holzpalette zwischen Vorratskisten ausstrecken, war aber im Dunkel allein, hinter verschlossener Tür.
Annies Vater, wesentlich älter als seine Frau, war Landschaftsmaler; seine Lieblingsmotive waren die knorrigen Kopfweiden und Mohnfelder zwischen Pappelgruppen am Niederrhein. Als er kurz nach dem Krieg plötzlich auf dem Feld niedersank und starb, musste Großmutter allein nicht nur für Annie und sich selber, sondern auch noch für einen Onkel Hermann sorgen. Zusammen mit dem alten, Annie unbekannten Mann zogen sie aus den Bombenruinen in eine Ein-Raum-Baracke, »weit außerhalb des Ortes«.
Im Nachkriegswirrwarr wächst Großmutter an Stärke und Unabhängigkeit; im Überlebenskampf streift sie jegliche verbliebene Emotionalität ab.
Tagelang lässt sie Annie allein, verschwindet, um Nahrung und Kleidung zu beschaffen. Einfallsreich kämpft sie ums Überleben in der entbehrungsreichen Zeit. Der Zweck heiligt die Mittel, darunter wohl auch die eine oder andere Liebesleistung. Sie »kann nicht ganz ohne die Männer.« Kommt Annie unplanmäßig nach Hause, erwischt sie Mutter in eine Ecke gedrängt mit einem Lehrer, einem Beamten oder einem völlig Fremden.
Dagegen wird Annie, die stets um die Liebe der Mutter buhlt und sich nach Nähe sehnt, kühl und reserviert auf Distanz gehalten. Auch in der Mutter-Tochter-Beziehung nimmt die Liebe Warencharakter an, wird verhandelt: Mutter bringt erste Wirtschaftswundergeschenke mit (Mantel, Schultasche), und Annie entgilt sie ihr, indem sie ein Ritual des Freudezeigens aufführt, dessen Spielregeln so subtil angelegt sind wie Albrecht Dürers Locken auf einem Zehnmarkschein: Sie holt »Glanz in die Augen«, dreht sich mit dem Mantel im Raum, und bald folgt der Höhepunkt, die aus Tuchfühlungsnähe geflüsterten Worte »Ich liebe dich sehr« (nachdem sie den ersten Entwurf »du bist die Liebste« sogleich als zu billig verworfen hat). Wenn all das als »gültige Währung durchgeht«, besiegelt die Mutter das Geschäft mit einem Kuss »auf den Mund« – ein Moment des Triumphes, den Annie »zugleich verabscheut und herbeisehnt«; ist es die Intimität, die sie da verachtet, oder aber die Scheinheiligkeit, die Künstlichkeit, die Materialisierung der Gefühle?
In diesem infamen, vertrackten Spiel um erzwungene Bindungen, die doch nichts als kalte, hohle Worte sind, eskalieren mit den Jahren die Mittel. Die alternde Großmutter kann ihre Tochter in unausweichliche Situationen manövrieren, sie eiskalt erpressen, um ihr eine Liebesbezeugung (die Zauberworte »Mutter, ich liebe dich«) zu entlocken: »Mutter bedroht Annie mit dem Tod, das kann sie gut.« »Ich sterbe, sagt sie zunächst leise.« »,Ganz allein bin ich‹, stöhnt Mutter«, und Annie weiß, was sie nun zu tun hat. »,Du bist meine Tochter‹, murmelt Mutter, ›du lässt mich nicht allein.‹« Am Ende des Tanzes wird sie auch »diesmal wieder nicht sterben« und Annie erschöpft an ihrer Schulter niedersinken.
Es verwundert nicht, dass Annie, ein intelligentes Mädchen mit Sprachtalent, auf der schrägen Klaviatur des Manipulierens auch selbst virtuos zu spielen lernt. Sie wird Übersetzerin, heiratet ihren Chef, gebärt eine Tochter (die Ich-Erzählerin) – und vergiftet auch dieses neue Mutter-Tochter-Verhältnis mit einem Repertoire von offenen Vorhaltungen, ominösen Anspielungen, spitzen Provokationen, gemeinen Spielen mit Erwartungen und eingeimpftenSchuldgefühlen, dreister Verleugnung der eigenen Verantwortung. Ins Absurde übersteigerte, bösartige Unterstellungen rücken die andere ins Unrecht und stärken die eigene Position der moralischen Überlegenheit; die Rolle der Bemitleidenswerten, Unterdrückten macht unangreifbar. Die Ich-Erzählerin erfährt, dass sie »so ein anstrengendes Kind« gewesen sei; doch »das war kein unschuldiges Schreien, das war schon fast, also, man darf das ja bei Babys nicht sagen, das ist ja tabu, aber das war schon fast ein bösartiges Geschrei, ja eigentlich Folter, so. Jetzt ist das mal gesagt. Schlafentzug als Folter.«
Belastet durch die problematische Mutter-Tochter-Beziehung geht auch die Ich-Erzählerin ihren Weg. Sie heiratet einen Promovierten, bekommt zwei Kinder. Dass auch sie sich ständig vor Geräuschen, Fremden, dem Alleinsein ängstigt, stößt ausgerechnet bei Annie auf Unverständnis: »Woher hast du das bloß, also von mir hast du es nicht … Im Krieg Angst haben, das ging nicht.«
Nun sitzt die Ich-Erzählerin also an Annies Krankenbett. Sie will die alte Geschichte vom Schreikind nochmal hören, wissen, »ob sie stimmt«. Aber vielleicht ist es jetzt schon zu spät und die Szene der entscheidenden Auseinandersetzung zu verfahren. »Das kann sich keiner vorstellen, da hat sich auch keiner für entschuldigt«, sagt Annie, und die Tochter versteht nicht, was sie damit meint. Sicher will sie ihrer Tochter die Schuld dafür anhängen, dass sie auf die Welt gekommen ist, war sie doch schon von ihrer eigenen Mutter gewarnt worden: "Die Jungs haben sich nicht in der Hand, die schießen los, und wer hat die Scherereien. Krieg bloß kein Kind, das versaut dir das ganze Leben."
Annette Pehnts psychologisch packender Roman über die schmerzvolle Unmöglichkeit der Nähe zwischen Müttern und Töchtern, die sich bis in die nächsten Generationen fortsetzt, besticht durch die unmittelbare Gestaltung der Situationen und der subtilen Emotionen, der indirekten Kommunikation, die ohne Körperlichkeit auskommen muss (»Umarmungen sind undenkbar«), der seltenen Momente behutsamer Zärtlichkeit, mit denen die beiden Töchter – und nur die – eine Annäherung wagen.
 · Herkunft:
· Herkunft: