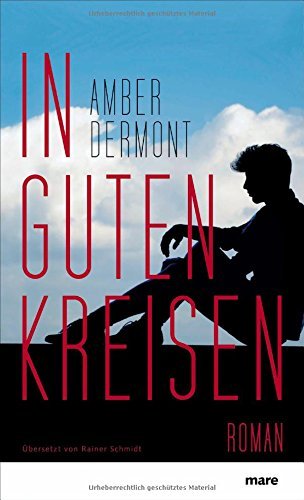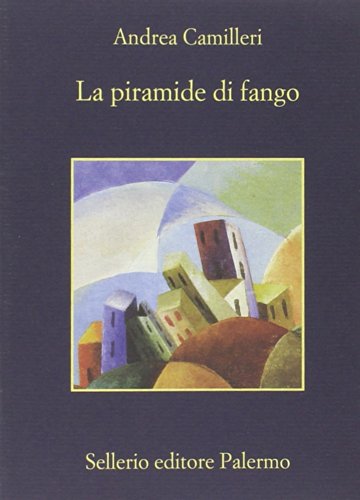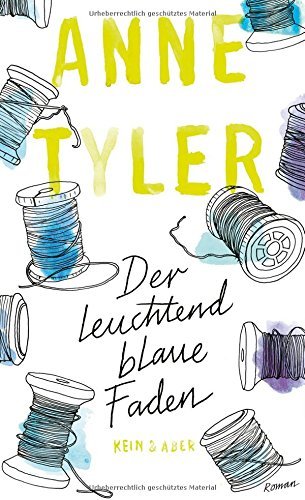
Eine ganz normale Familie
Das Stammhaus der Whitshanks steht in der Bouton Road in Baltimore. Bis kurz nach der Weltwirtschaftskrise gehörte es den Brills. Die beauftragten Großvater »Junior« Whitshank mit diversen Sanierungsarbeiten. Allerdings provozierten Mrs Brills Sonderwünsche (Kristallleuchter, samtbezogene Tapeten ...) seinen »Widerwillen gegen Protz« derart, dass er sich seiner Auftraggeberin offen widersetzte. Nach einem diffusen Einbruch, bei dem der nie identifizierte Täter »eine ganz normale Handwerkertasche« zurückgelassen hatte, war Mrs Brills Interesse an ihrem Heim dahin, denn jetzt fürchtete sie sich darin. Aber Junior sah sich am Ziel seiner Träume angekommen, als man ihm die Immobilie zum Kauf anbot, und zog mit Ehefrau Linnie Mae und den Kindern Merrick und Redcliffe (»Red«) ein.
Nach dem schrecklichen Unfalltod der Eltern im Jahre 1967 übernahm Sohn Red mit seiner Frau Abigail (»Abby«) das Anwesen, in dem er eine paradiesische Kindheit verbracht hatte. Seine Schwester Merrick legte keinen Wert darauf; sie heiratete einen wohlhabenden Mann in Sarasota. Doch die gute Partie enttäuschte sie. Die Ehe blieb kinderlos, Ehemann Trey erwies sich als egoistisch, kalt und rüpelhaft, die Schwiegermutter als unausstehlich.
Die Whitshanks sind dagegen eine Bilderbuchfamilie. Ihre angesehene Bau- und Sanierungsfirma floriert über Jahrzehnte. Red und Abbys lange Ehe wird mit vier Kindern gesegnet, die ihren Ausbildungsweg gehen, heiraten und ihnen Enkel schenken. Obwohl kein einziges Familienmitglied mit irgendeiner Eigenschaft den Durchschnitt überragt, kultivieren sie ein leicht überzogenes Selbstbewusstsein. Sie erwecken nach außen hin gern den Anschein, »etwas Besonderes zu sein«, können das freilich nur an Banalitäten wie ihrem vermeintlich »besseren Geschmack« festmachen. Selbst der schlichte Zufall, dass die beiden Töchter Männer gleichen Vornamens geehelicht haben, gereicht ihnen zur Ehre. In ihrer Überheblichkeit tangiert sie das Schicksal anderer kaum; auch die weitläufige Sippschaft kann weder ihr Interesse erregen noch Engagement hervorrufen, und selbst Merricks Sorgen entgehen ihrer Aufmerksamkeit. Dessen ungeachtet engagiert sich Abby in der gemeindlichen Sozialarbeit, bewirtet beispielsweise großzügig Obdachlose und Arme.
Denn das Heile-Welt-Image will gepflegt sein. Tagtäglich bemüht man sich, »so zu tun, als ob alles bestens wäre«. Dazu muss man einige Dinge herunterspielen, vertuschen, wegdrücken. Das hat sich insbesondere Mutter Abby zur Lebensaufgabe auserkoren und sich damit gleichzeitig ihr größtes Problem aufgehalst. Ausgerechnet ihr Lieblingssohn Denny, das dritte (und bestaussehende) der vier Kinder, nimmt eine schwierige charakterliche Entwicklung und gerät zum schwarzen Schaf der Familie. Der Grund ist weniger die Dominanz seiner beiden älteren Schwestern, der herrschsüchtigen Amanda und der wilden Jeannie, als Douglas, das Pflegekind, das die Whitshanks zu sich nahmen, als Denny vier Jahre alt war. Sein Vater, einer von Reds Bauarbeitern, war gestorben, seine Mutter abgehauen, kein Verwandter aufzutreiben. Ihn in ein Heim abzugeben, wie Red es bevorzugt hätte (»wir lieben ihn nicht«), bringt Abby nicht übers Herz (»eher sterbe ich«). An den Behörden vorbei schleust sie den verschüchterten Jungen in ihre Obhut. Wegen seines »zarten, stielartigen« Halses nennt sie das Kind »Stem«.
Die Konkurrenz mit dem zwei Jahre jüngeren Pflegebruder bekommt Denny schlecht. Er wird bockig, verschlossen und faul. In der Schule gibt es Ärger. Als Jugendlicher trinkt und raucht er, nimmt Drogen, wird von der Polizei erwischt. Respekt ist ihm fremd: Er stöbert in Mutters Akten, liest die Tagebücher der Geschwister, beleidigt Gäste. In der Öffentlichkeit präsentiert er sich in einem »Schmuddel-Look«, der dem Ansehen der Familie Whitshank, »einer dieser beneidenswerten Familien mit besonderer Ausstrahlung«, provokant widerspricht. Sind dies Hilferufe eines jungen Mannes, der sich vernachlässigt fühlt? Jedenfalls nimmt sie niemand als solche wahr.
Nachdem Denny seine Schulkarriere abbricht, nimmt Red ihn (wie auch Stem) in die Firma auf, in der Hoffnung, dies könne den Sohn für etwas Sinnvolles begeistern. Doch während Stem seine Aufgaben zu Reds vollster Zufriedenheit erledigt und sich die Gunst des Pflegevaters erwirbt, verscherzt sich Denny seinen Vertrauensvorschuss. Seine arrogante Art, mit Kunden umzuspringen, macht ihn für den Betrieb untragbar.
Nach einer abgebrochenen psychiatrischen Therapie, einem kurzen Ausreißer-Abenteuer mit einem Mädchen und zwei Jahren Zwangsaufenthalt in einem Internat für schwer erziehbare Jugendliche in Pennsylvania kehrt Denny mit einem Abschluss in den Schoß seiner Familie zurück. Da haben die heftigen Auseinandersetzungen um seinen Werdegang die Partnerschaft zwischen seinen Eltern schon lange zermürbt. Red glaubt, Abby habe den Jungen zu sehr verwöhnt, Abby wirft sich vor, ihren Sohn nicht ausreichend geschützt zu haben, und unterstellt Red unterschwellig, sich nicht genug für ihn engagiert zu haben. Die Schuldzuweisungen haben zu tiefem gegenseitigem Hass geführt; aus purem Selbstschutz vermeiden die beiden das Thema.
In dieser Phase ihrer Familiengeschichte lernen wir die Whitshanks kennen. Als Einstieg zu Anne Tylers Roman dient ein provokanter abendlicher Telefonanruf. Kurz und bündig teilt Denny seinen Eltern mit, er sei schwul, und legt gleich wieder auf. Abby und Red sind fassungslos, denn lebt Denny nicht in einer festen Beziehung und hat eine Tochter? Was also bezweckt er mit dieser sie tief beunruhigenden Nachricht?
In vier Kapiteln erzählt »A Spool of Blue Thread« ein leises Epos über drei Generationen (übersetzt von Ursula-Maria Mössner). Die Zeitebenen wechseln nach Belieben, die Handlung wird nicht einfach chronologisch weiterentwickelt. Vielmehr fügt sich aus episodenhaften Erinnerungen der Eltern, Rückblenden und Gesprächen der Familienmitglieder Puzzlesteinchen für Puzzlesteinchen das Bild einer ziemlich farblosen Familie aus Neuengland zusammen, die sich mit den Fährnissen des Lebens auseinandersetzen muss. Ihre Sorgen sind nicht schlimmer, die Risse in ihrer sorgsam gepflegten Fassade nicht schockierender als die vieler anderer Familien. Keine Tragik, keine Schuld, keine wirkliche Katastrophe, keine soziale Not, keine schwere Krankheit trifft sie.
Was die Handlung in Bewegung hält, sind die komplizierten emotionalen und psychologischen Relationen zwischen den Mitgliedern (Geltungsbedürfnis, Neid, Eifersucht, Schuldgefühle ...), aber unterm Strich haben die Eltern dann doch gar nicht so sehr versagt, ein gewisser Familiensinn verbindet sie alle und ist stark genug, dass sie sich am Ende irgendwie zusammenraufen.
Im Jahr 2012 angekommen, beratschlagen die Kinder, wie es weitergehen soll mit den Eltern und dem Haus. Red (74) trägt ein Hörgerät und hat einen Herzinfarkt überwunden. Abby (72) ist leicht tüddelig geworden, irrt schon mal im Nachtkleid durch die Nachbarschaft. Sollen die beiden das Haus verkaufen und in ein Seniorenheim ziehen oder eine Haushälterin anstellen? Nach allem, was sie für ihn getan haben, glaubt Stem, es ihnen schuldig zu sein, dass er mit seiner Frau Nora und ihren Kindern zu ihnen ins Haus zieht. Das war zu erwarten. Überraschender ist, dass es auch Denny zurückzieht in die Geborgenheit des familiären Mikrokosmos, aus dessen vermeintlichem Gefängnis er so heftig auszubrechen versuchte.
Jetzt sind zwar alle wieder beisammen, aber Friede kehrt natürlich nicht ein. Die Schwestern rechnen mit Denny wegen seines Bestrebens ab, die Liebe der Mutter exklusiv für sich zu erzwingen. Der über Jahre schwärende Hass zwischen Denny und seinem mutmaßlichen Rivalen Stem, dem Eindringling, der ihm den ersten Platz an Vaters Seite geraubt hat, kulminiert in einer heftigen Prügelei.
Was aber hat das alles mit dem Textil zu schaffen, das den Titel gibt? Das biedere Nährollen-Cover spielt ja mit der Erwartung einer altmodischen Heimeligkeit, für die Sie in der bisherigen Darstellung keinerlei Anlass gefunden haben werden. Es gibt sie auch im Buch nicht. Der »leuchtend blaue Faden« kommt erstmals und nur am Ende des letzten Kapitels zum Vorschein – und selbst da nur als Katalysator für eine sehr späte versöhnliche Einsicht.
So unspektakulär wie die Whitshanks und die Handlung ist Anne Tylers formale Gestaltung ihres Romans. Da gibt es keine Aufregung, keine Spannung, wohl aber ungewöhnlich ausführliche Beschreibungen alltäglicher Situationen, liebevolle Hinwendung zum Detail (ein Buick nähert sich, man steigt ein und fährt los) und allerhand Symbolik (ein alter Tulpenbaum wird für ein Hochzeitsfoto gefällt). Die Sprache ist leise, wohlgesetzt, sachlich-unprätentiös (»Abby starb an einem Dienstag, am Mittwoch wurde sie eingeäschert«).
Die Geschichte einer ganz normalen Familie mit kleinen dunklen Geheimnissen, von einer großen Schriftstellerin intensiv erzählt. Mir fehlt das Prickeln.
 · Herkunft:
· Herkunft: