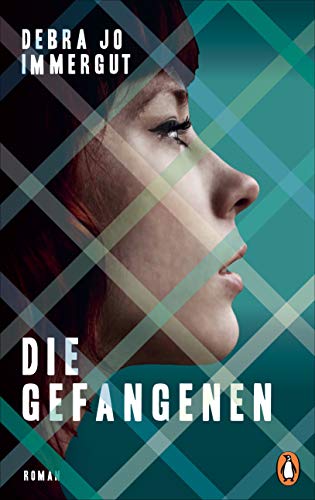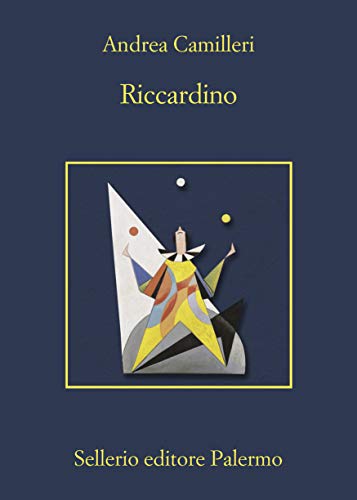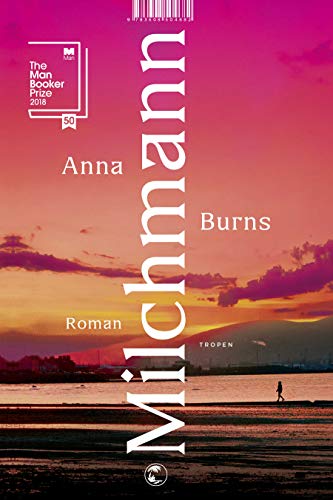
Milchmann
von Anna Burns
Im Nordirland der Siebzigerjahre, wo eine ganze Generation nichts anderes kennt als brutal und heimtückisch geführte Auseinandersetzungen und wo die Menschen sich in ihren jeweiligen Vierteln und hasserfüllten, konservativen Weltanschauungen eingeigelt haben, wird eine junge Frau von einem älteren Mann bedrängt. Sie weiß sich abzusetzen.
Leben im Sumpf
Anna Burns hat seit 2001 drei Bücher geschrieben, die kaum beachtet wurden. Für ihren vierten Roman erhielt sie 2018 überraschenderweise die wichtigste britische Literaturauszeichnung, den Man Booker Prize, und seither überschlagen sich Kritiker mit Lobeshymnen. Weite Teile des Lesepublikums finden »Milkman«  hingegen zähflüssig, gekünstelt, unverständlich. Um es gleich vorwegzunehmen: Berechtigt sind die Einwände ebenso wie die anerkennenden Worte.
hingegen zähflüssig, gekünstelt, unverständlich. Um es gleich vorwegzunehmen: Berechtigt sind die Einwände ebenso wie die anerkennenden Worte.
»Milchmann« (von Anna-Nina Kroll ins Deutsche übersetzt) wirft uns in eine surreal und hermetisch erscheinende Welt, die zu verorten uns Nicht-Briten schwer fällt. Personen und Schauplätze tragen keine Namen, sondern nur Etiketten, die Eigenarten oder Funktionen benennen: »Atomjunge«, »Tablettenmädchen«, »Vielleicht-Freund«, »Chefkoch«, »Themenfrauen«, »das Land auf der anderen Seite der Grenze«, »das Land auf der anderen Seite der See«. Die Bevölkerung ist in sich tief gespalten. Was »Wir« und »Die« trennt, ist die Religion (»deren« und »unsere«) sowie die damit verknüpfte politische Glaubensrichtung. Beides definiert das Leben des Einzelnen vom Wohnort (»unsere Seite der HauptStraße« – »die auf der anderen Seite der HauptStraße«) über das Fernsehprogramm (Wer eine »falsche« Sendung einschaltet, verrät die eigene Sache.) bis zum Einkauf: »Es gab die richtige Butter. Die falsche Butter. Den Treue-Tee. Den Verräter-Tee. Überall und mit allem, was man tat, gab man ein politisches Statement ab, ob man wollte oder nicht.« Ständig begegnet man Kontrolleuren, Volkszählern, Sicherheitskräften, Polizei, Armee und Paramilitärs. Jeder bespitzelt jeden. Die Überwachung ist rigoros und konsequent. Bei Vergehen ordnet ein Wortführer oder eine improvisierte Gerichtsverhandlung rasch eine Sanktion an, weswegen man überall »Leute mit blauen Augen, Blutergüssen und fehlenden Fingern « sieht. Übleren Verrätern drohen mittelalterliche Strafen (»Prügel, Brandmarkungen, Teeren und Federn«), wenn nicht der Tod.
Die allgemeine Intoleranz und Feindseligkeit, das grundsätzliche Misstrauen, die Abwesenheit allseits akzeptierter Instanzen, die Gefahr, jederzeit willkürlich festgenommen, verletzt oder getötet zu werden, hat die Gesellschaft zermürbt, atomisiert und verunsichert, so dass der Einzelne sich nicht einmal innerhalb der eigenen Gruppe sicher fühlen darf. Dennoch finden alle die irrwitzigen Lebensbedingungen normal, denn sie kennen nichts anderes und wollen nichts anderes kennenlernen.
Aha, eine Dystopie. Vielleicht eine Art Hochrechnung, was aus unseren Demokratien in nicht allzu ferner Zukunft werden kann, wenn all die populistischen Strömungen ihr gesellschaftliches Zersetzungswerk erfolgreich fortführen können? Wenn jedes Grüppchen sich kommod in seiner Blase aus Richtig und Falsch einnistet und jegliche Inbetriebnahme des eigenen Gehirns, jede Bemühung, eine andere Sichtweise auch nur zu verstehen, als Verbrechen geahndet wird?
Nein, eine warnende Zukunftsprojektion hat die Autorin (1962 in Belfast geboren) nicht im Sinn. Sie bewältigt vielmehr eine (auch ihre) konkrete Vergangenheit. Jeder Brite entnimmt dem Text problemlos, dass die Handlung im Nordirland der Siebzigerjahre spielt. Diese Provinz war nach der Gründung der Republik Irland in den Zwanzigern beim Vereinigten Königreich verblieben. Im Wesentlichen stehen sich bis heute die protestantischen Unionisten (die für den Verbleib im UK kämpfen) und die katholischen Republikaner (die den Anschluss an Irland befürworten) unversöhnlich gegenüber, und obendrein sind beide Parteien in unterschiedlich radikale Gruppierungen zersplittert. Das Gezerre um diese Provinz war in einen fragmentierten Bürgerkrieg ausgeartet, dessen Verhärtung und Brutalität für Außenstehende kaum nachvollziehbar ist. Man umschrieb ihn so verharmlosend wie schamvoll als »the Troubles«.
Sehr überzeugend verdeutlicht Anna Burns, die die Verhältnisse aus eigenem Erleben kennt, wie das Milieu den Menschen prägt, in diesem Fall in seinem ideologischen Sumpf seiner Sinne beraubt, einengt, ein Leben lang gefangen hält. Die Autorin tut dies aus der Ich-Perspektive einer eigensinnigen katholischen Achtzehnjährigen in Belfast, die sich einen Antrieb erhalten hat, den Kopf aus dem Dunkel ihres Habitats zu strecken, sich umzuschauen, nachzudenken. Auf Unterstützung darf sie nicht hoffen, sie ist auf ihre Intelligenz und Autodidaktik angewiesen. Sie ist gern allein, joggt, liest ständig, selbst im Gehen (Romane des 19. Jahrhunderts – das 20. Jahrhundert mag sie nicht), lernt Französisch.
Natürlich beargwöhnt ihr Umfeld das Verhalten der unsozialen Außenseiterin. Wo schon ein unbedachtes Lächeln an der falschen Stelle Verdacht erregt, leben Individualisten, die sich Freiheiten herausnehmen, gefährlich. So findet es auch die Erzählerin »einfacher, nicht aufzubegehren«. Dem Kreislauf aus Gewalt und Gegengewalt, den überall lauernden Falschmeldungen und Denunziationen, der Paranoia ihrer Umwelt weicht sie aus, indem sie »am besten gar nichts war; am besten auch gar nichts dachte«. Nicht einmal ihren Namen erfahren wir, unter neun Geschwistern ist sie einfach die »Mittelschwester«.
In den etwa zwei Monaten, die die erzählte Zeit umfasst, spielt sich eine schlichte Handlung ab. Hintergrund sind die erztraditionellen Geschlechterrollen in diesem »Ich Mann, du Frau«-Gebiet. Starke Männer demonstrieren ihre Macht, indem sie sich allerlei übergriffige Freiheiten herausnehmen. Missbrauch und Abtreibungen sind an der Tagesordnung. Mädchen haben stillzuhalten, »mit sechzehn zu heiraten, ab siebzehn Babys zu kriegen und sich mit zwanzig zum Sterben vor den Fernseher auf die Couch zu setzen«. Ein fast fünfundzwanzig Jahre älterer, verheirateter Mann von Einfluss im politischen Kampf (der vielleicht Sprengstoff in Milchkästen verteilt) stellt der jungen Ich-Erzählerin nach. Er spricht sie ein paar Mal an, formuliert forsch, als gehöre sie ihm, schüchtert sie ein. Obwohl er sie nicht einmal berührt, verunsichert und zermürbt sie sein Verhalten, und es bringt sie in Verruf. Selbst ihre Mutter glaubt jedem absurden Gerücht mehr als ihrer Tochter, und so wird sie in kürzester Zeit als Lügnerin, Hure, Terroristen-Groupie abgestempelt, ein schlechtes Vorbild für ihre minderjährigen Schwestern.
So weit, so gut. Zur Vermittlung all dieser Beobachtungen, Erinnerungen, Erlebnisse und Überlegungen gibt die Autorin ihrer aufgeweckten, scharfsinnigen, lustigen, unverwüstlichen Protagonistin eine originelle, frische Sprache. Authentischerweise schert sich »Mittelschwester« nicht um traditionelle Ästhetik und Strukturen, sondern plaudert drauflos, assoziativ springend, in endlosen Monologen, voller Reihungen und Redundanzen (»gewaltige, schwere, drängende, satte, ansteckende, Schwarze-Wolken-Krähen-Raben-Dohlen-haufenweise-Särge-metertiefe-Katakomben-zu-ihren-Gräbern-kriechende-Skelette-klappernde-Knochen-Depressionen«). Ihr Ton ist nicht sonderlich empathisch, eher fatalistisch, aber sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Dialoge finden wir selten, Witz und Esprit häufig. Vielleicht gehört auch das Anonymisierungs- und Verrätselungsspiel (»falscher Milchmann« – »echter Milchmann«) zum intellektuellen Spaß. Es setzt gleich mit dem ersten Satz ein – »Der Tag, an dem Irgendwer McIrgendwas mir eine Waffe auf die Brust setzte, mich ein Flittchen nannte und drohte, mich zu erschießen, war auch der Tag, an dem der Milchmann starb.«
Die ungewohnte Mixtur aus Stoff und Aufbereitung kann bei engagiertem Lesen und hinreichenden Vorkenntnissen verstörende Erkenntnisse über Nordirland und ein tieferes Verständnis für die geschundene Region bewirken, steht ästhetischem Vergnügen aber eher entgegen. Burns’ Thema und Anliegen verdienen Respekt, aber die Form konterkariert die Absicht. Die verkomplizierte Lektüre strengt an und verlangt Ausdauer.
Nie zuvor ging der Man Booker Prize nach Nordirland. Die Jury betont, dass weder #MeToo noch der Brexit ihre Wahl beeinflusst habe. Dennoch haben die Brexit-Querelen Nordirlands bittere Zerrissenheit wieder ins Rampenlicht gerückt, denn wie seine Grenze zur Republik Irland (zukünftig eine Außengrenze der EU) gestaltet werden soll, ist eines der am schwierigsten zu lösenden Probleme. Die Begründung des Jury-Vorsitzenden verweist jedenfalls in erster Linie auf die psychosoziale Relevanz des Romans (»the daily violence of her world … the power of gossip and social pressure in a tight-knit community … put in the service of a relentless campaign of individual sexual harassment … universal experience of societies in crisis.«).
Sind Sie offen, experimentierfreudig und bereit, für eine innovative Leseerfahrung unter Umständen Frustrationen (durch Langeweile, Rätsel, schwer Verständliches) hinzunehmen? Dann stellen Sie sich ruhig der Herausforderung dieses Romans. Wenn Sie jetzt verschreckt sind, dann lassen Sie es lieber.
 · Herkunft:
· Herkunft: